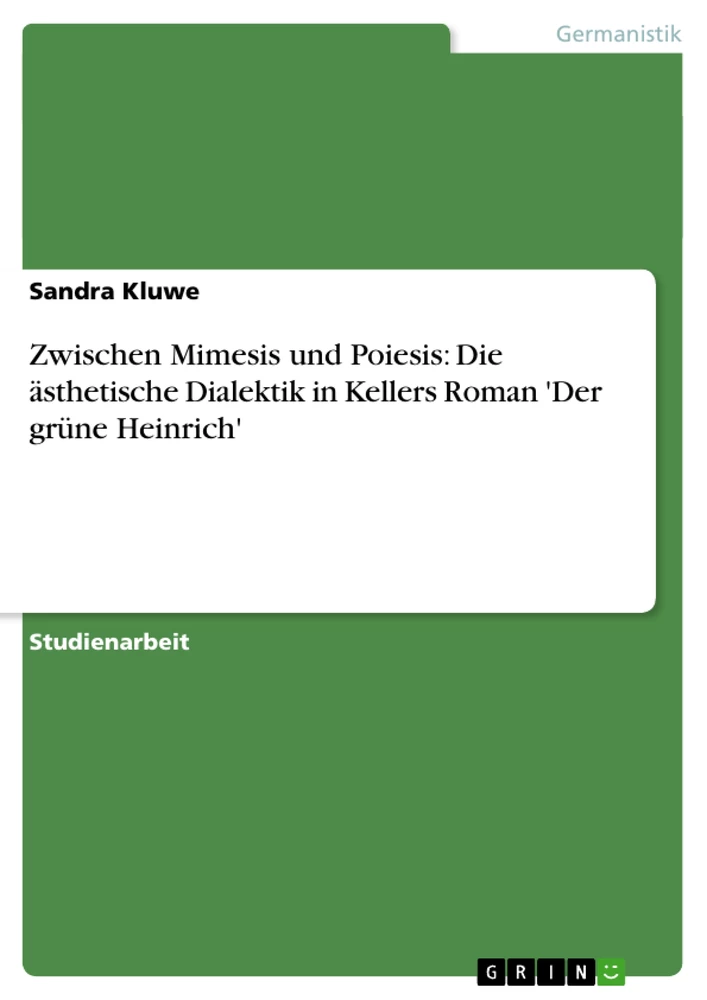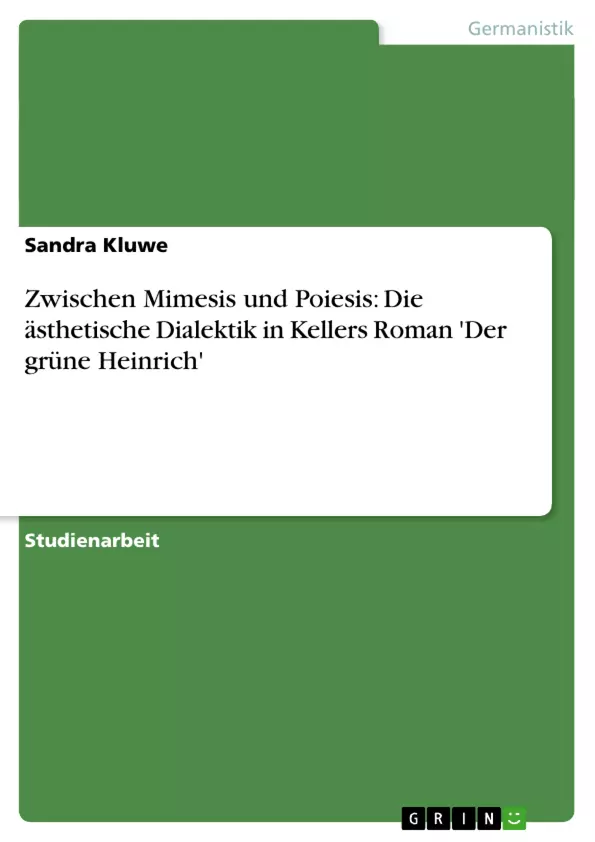"Wahr und treu" malen und "aus seinem Innern selbst hervorbringen", dies sind die Pole, zwischen denen die Ästhetik des grünen Heinrich oszilliert: auf der einen Seite Nachahmung der konkreten Wirklichkeit, Imitation des sinnliche Wahrnehmbaren, auf der anderen Seite Vermittlung von Ideen, Umsetzung innerlich geschauter in allgemein denkwürdige Wahrheiten; hier Mimesis, da Poiesis. In Kellers Roman entfaltet dieser Dualismus eine dialektische Dynamik, die zumindest das Postulat nach einer Synthese in sich birgt. Gewährsmänner der Poiesis sind die subjektivistischen Landschaftsmaler um Samuel Gessner, der Dichter Jean Paul, die Romantiker in ihrer Gesamtheit, während als gedankliches Substrat der Idealismus Hegels durchschimmert. Unter den Romanfiguren ist es Habersaat, der Heinrich in dieser Richtung beeinflusst. Als Vertreter des Mimesis-Pols erscheinen in der Personenkonstellation Wilhelms Oheim und der Graf, in der Malerei Ruisdael, in der Philosophie Feuerbach. Vermittelt wird der ästhetische Dualismus durch Goethe und die Heinrich durch Römer vorgestellte Klassizität Homers. Was Goethe gelingt, muss für Heinrich allerdings Utopie bleiben: Er bleibt Gefangener einer eindimensionalen Todesästhetik, die sein gesamtes Sein und Werden durchdringt.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Hauptteil
- I. Poiesis: Heinrich im Bann einer subjektivistischen Scheinwelt
- 1. Manier und Spiritualismus
- 2. Variation über Hegels Dictum vom Ende der Kunst
- II. Mimesis: Rückkehr „auf die reale Bahn“?
- 1. Einfache Nachahmung der Natur
- 2. Der Einfluss Feuerbachs
- III. Mimetische Poesie
- 1. Römer
- 2. Die Goethe-Reflexionen
- 3. Der Dualismus von Repräsentations- und Produktionsästhetik bei Goethe
- C) Schluss
- 1. Eine Synthese mit ontologisch-gnoseologischer Dimension
- 2. Heinrichs Scheitern an der Synthese: Ausblick und Rückblick
- 2.1 Heinrichs Kindheit als „Vorspiel des ganzen Lebens“
- 3. Individualität und allgemeine Relevanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die ästhetische Dialektik in Gottfried Kellers Roman „Der grüne Heinrich“. Im Zentrum steht der Spannungsbogen zwischen Mimesis und Poiesis, zwischen Nachahmung der Realität und schöpferischer Gestaltung. Dabei beleuchtet die Arbeit die verschiedenen Einflüsse, die auf Heinrichs ästhetisches Selbstverständnis einwirken, von den subjektivistischen Malern um Gessner und Jean Paul bis hin zum Einfluss Feuerbachs und Goethes.
- Die ästhetische Dialektik zwischen Mimesis und Poiesis im Roman
- Der Einfluss verschiedener Künstler und Denker auf Heinrichs ästhetisches Selbstverständnis
- Die Rolle von Goethes ästhetischer Theorie in der Synthese von Mimesis und Poiesis
- Die Bedeutung von Heinrichs Scheitern an der Synthese für die Interpretation des Romans
- Die Frage nach der individuellen und allgemeinen Relevanz von Heinrichs ästhetischem Kampf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die grundlegende Thematik der ästhetischen Dialektik im Roman „Der grüne Heinrich“ einführt und die zentralen Pole Mimesis und Poiesis vorstellt. Anschließend wird im Hauptteil die Poiesis als einflussreiche Kraft in Heinrichs künstlerischem Schaffen beleuchtet. In diesem Kontext werden die Rolle des „dipingere di maniere“ und die Bedeutung der subjektivistischen Einflüsse von Künstlern wie Gessner und Jean Paul sowie Hegels Einfluss auf Heinrichs ästhetische Ansichten analysiert. Das zweite Kapitel des Hauptteils widmet sich der Mimesis, dem Streben nach realistischer Nachahmung der Natur, und betrachtet dabei den Einfluss von Feuerbachs Materialismus sowie die Prägung durch Heinrichs Umfeld. Schließlich wird in Kapitel drei die Synthese von Mimesis und Poiesis durch die Goethe-Reflexionen und die Rezeption der Klassizität Homers untersucht. Abschließend werden im Schlussteil die tragischen Gründe für Heinrichs Scheitern an der Synthese und die Bedeutung seiner künstlerischen Entwicklung für den Roman beleuchtet.
Schlüsselwörter
Der grüne Heinrich, Mimesis, Poiesis, Ästhetische Dialektik, Gessner, Jean Paul, Hegel, Feuerbach, Goethe, Klassizität, Homer, Scheitern, Synthese
- Quote paper
- Sandra Kluwe (Author), 1996, Zwischen Mimesis und Poiesis: Die ästhetische Dialektik in Kellers Roman 'Der grüne Heinrich', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77640