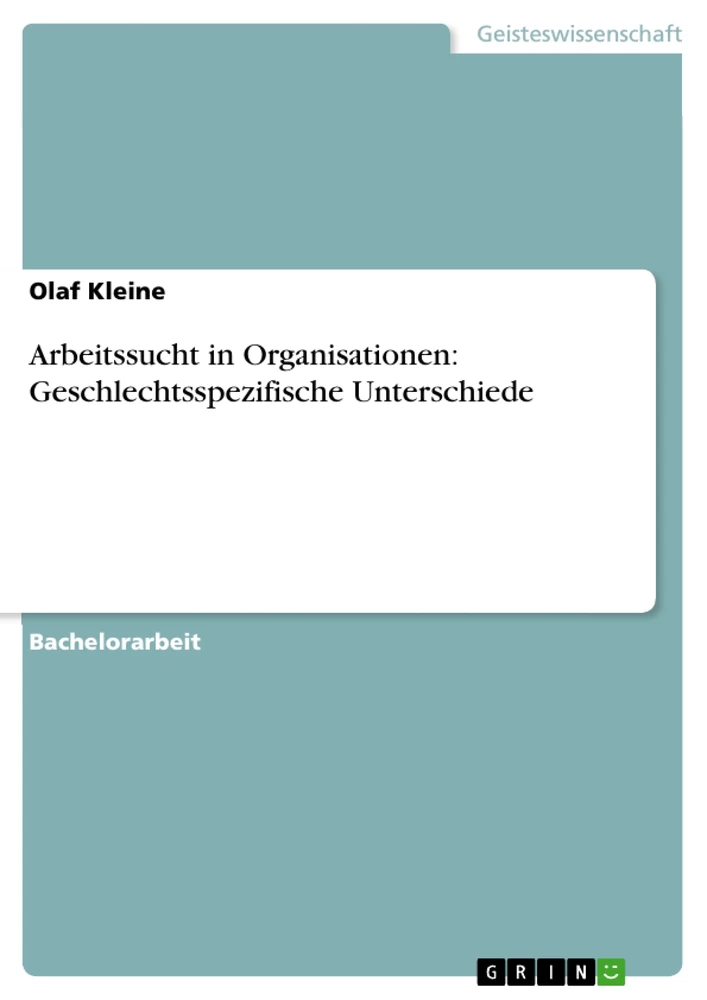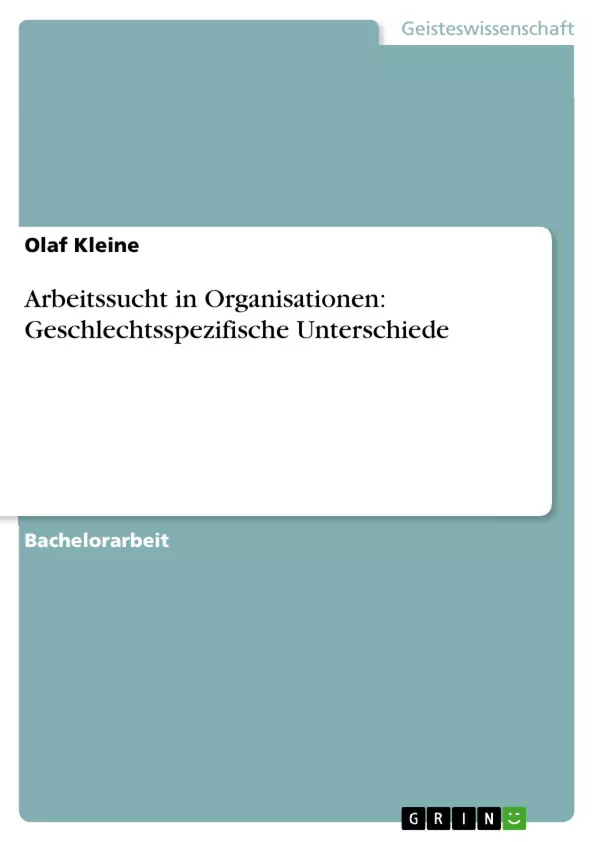Gegenstand dieser Arbeit ist das Phänomen der Arbeitssucht. In der Suchtforschung geht man davon aus, dass jegliches Verhalten süchtig entgleisen kann. Daher scheint eine Übertragung auf das menschliche Arbeitsverhalten nicht fernzuliegen. Tatsächlich ist für manche Menschen Arbeit eine Droge mit allen Konsequenzen einer Suchtkrankheit. Obwohl in der populärwissenschaftlichen Literatur immer häufiger über Arbeitssucht berichtet wird, ist dieses Phänomen in den traditionellen Forschungsfeldern für Sucht bisher eher vernachlässigt worden. Aus diesen Gründen ist es wenig verwunderlich, in der Literatur oft widersprüchliche Meinungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen über Arbeitssucht zu finden.
Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, der Arbeitssuchtforschung in Deutschland Impulse und Anknüpfungspunkte für weitere Studien zu geben, um die Auseinandersetzung mit dieser Verhaltenssuchtform in gesundheits- und gesellschaftspolitischer Hinsicht ernsthafter voranzutreiben. Dabei werden zwei Schwerpunkte gesetzt. Ein Schwerpunkt liegt in der Erforschung potenzieller Genderdifferenzen bzw. geschlechtsspezifischer Wahrnehmung von Arbeitssucht und arbeitssüchtigem Verhalten in Deutschland. Weiterhin will die vorliegende Arbeit auch ein neuentwickeltes Erhebungsinstrumentarium, das bereits einmalig in Deutschland eingesetzt worden ist, durch Replikation validieren. Es handelt sich dabei um die „Workaholism-Scales-D” von Jungkurth (2005), welche für die defizitäre deutsche Arbeitssuchtforschung neues und innovatives empirisches „Handwerkzeug” hinsichtlich der Definition und Diagnose von Arbeitssucht sowie einer Profilbildung betroffener Individuen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Hintergründe zum Phänomen Arbeitssucht
- 2.1 Arbeitssucht - Historischer Abriss, Begriff und Forschung
- 2.2 Arbeitssucht als Verhaltensucht
- 2.3 Zur geschlechtsspezifischen Wahrnehmung der Arbeitssucht
- 2.3.1 Forschung über Arbeitssucht unter dem Genderaspekt
- 3 Zielsetzung einer möglichen Untersuchung
- 4 Konzeption und Design einer möglichen Untersuchung
- 5 Methoden zur Erfassung von Arbeitssucht
- 5.1 Das Modell von Spence und Robbins (1992)
- 5.2 Erhebungsinstrumente für eine mögliche Untersuchung von Arbeitssucht in Deutschland
- 5.3 Die Operationalisierung der möglichen Untersuchung
- 5.4 Beschreibung einer möglichen Stichprobe
- 6 Kritische Betrachtung der vorgestellten Untersuchung
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Arbeitssucht, insbesondere mit geschlechtsspezifischen Unterschieden in ihrer Wahrnehmung und Ausprägung. Ziel ist es, die Forschung zu diesem Thema in Deutschland zu fördern und die Auseinandersetzung mit Arbeitssucht in gesundheits- und gesellschaftspolitischer Hinsicht anzustoßen.
- Erforschung potenzieller Genderdifferenzen in Bezug auf Arbeitssucht und arbeitssüchtiges Verhalten in Deutschland
- Validierung eines neuentwickelten Erhebungsinstruments zur Messung von Arbeitssucht in Deutschland
- Verifizierung von Schlussfolgerungen, die aus vorherigen Erhebungen mit dem Instrumentarium gezogen wurden
- Einarbeitung in die theoretischen Grundlagen der Arbeitssuchtforschung
- Entwicklung eines Forschungskonzepts zur Untersuchung der Arbeitssucht in Deutschland unter Berücksichtigung des Genderaspekts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung präsentiert das Thema Arbeitssucht und erläutert die Bedeutung der Forschung in diesem Bereich. Die Arbeitssuchtforschung wird in Deutschland als unzureichend betrachtet, und es wird die Notwendigkeit für weitere Studien betont. Die Arbeit fokussiert auf die Erforschung potenzieller Genderdifferenzen bei Arbeitssucht und die Validierung eines neuentwickelten Erhebungsinstruments. - Kapitel 2: Theoretische Hintergründe zum Phänomen Arbeitssucht
Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Arbeitssucht, einschließlich der Begriffsbestimmung und der Forschungsergebnisse. Es beleuchtet den Mangel an geeigneten Definitionen und operationalisierbaren Messinstrumenten für Arbeitssucht und versucht, eine geeignete Definition für die vorliegende Arbeit zu finden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Arbeitssucht, Genderaspekte, Verhaltenssucht, Erhebungsinstrumente, Operationalisierung und Forschungsdesign in Deutschland. Die Forschungsarbeiten von Wayne Oates, Gerhard Mentzel, Spence und Robbins sowie Jungkurth spielen eine wichtige Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Arbeitssucht im Sinne dieser Forschungsarbeit?
Arbeitssucht wird als eine Form der Verhaltenssucht betrachtet, bei der das menschliche Arbeitsverhalten zwanghafte Züge annimmt, ähnlich einer stoffgebundenen Sucht.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Arbeitssucht?
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Erforschung von Genderdifferenzen und der geschlechtsspezifischen Wahrnehmung von arbeitssüchtigem Verhalten in Deutschland.
Was sind die „Workaholism-Scales-D“?
Dies ist ein nach Jungkurth (2005) entwickeltes Erhebungsinstrumentarium zur Definition, Diagnose und Profilbildung von arbeitssüchtigen Individuen in Deutschland.
Welche Rolle spielt das Modell von Spence und Robbins?
Das Modell dient als methodische Grundlage zur Erfassung von Arbeitssucht und wird im Rahmen der Operationalisierung der Untersuchung herangezogen.
Warum ist die Arbeitssuchtforschung in Deutschland gesellschaftspolitisch relevant?
Da Arbeitssucht oft vernachlässigt wird, soll die Forschung Impulse für gesundheitspolitische Maßnahmen geben, um die Folgen dieser Sucht ernsthafter zu behandeln.
- Quote paper
- Olaf Kleine (Author), 2007, Arbeitssucht in Organisationen: Geschlechtsspezifische Unterschiede, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77644