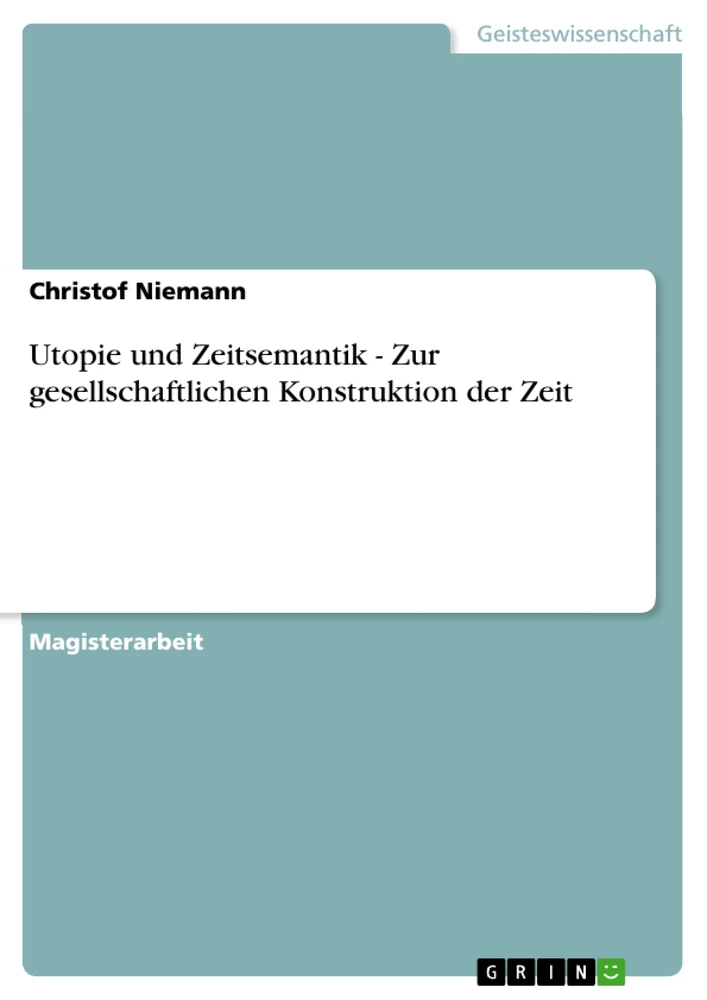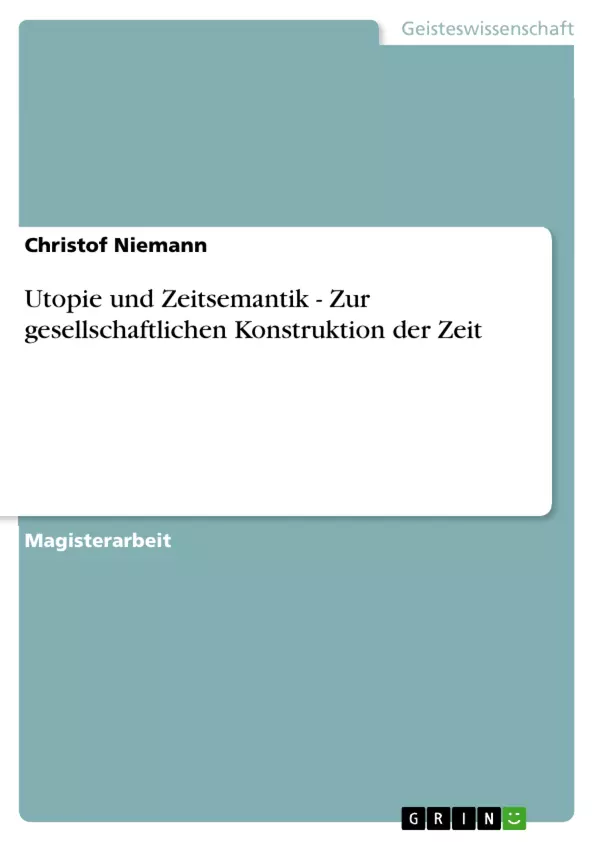Was traut der Mensch sich zu? Wie definiert er seine Rolle in der Geschichte? Die Debatten über „das Ende der Geschichte“, über den „Kampf der Kulturen“ und selbstverschuldeten Klimawandel, über die „neue Unübersichtlichkeit“, die Individualisierung und das Auseinanderdriften von gesellschaftlichen Sub- und Staatensystemen scheinen das Damoklesschwert über dem menschlichen Selbstbewusstsein schweben zu lassen. Wer will, findet ohne weiteres eine Vielzahl von Indizien, die den Schluss nahe legen, „wir“, also die Menschen, hätten den „göttlichen Auftrag“ einer vernünftigen Weltbemächtigung und –bestellung verfehlt oder zumindest noch nicht vollendet. Die Suche nach einem Ausweg aus dem Dilemma führt zu einem altbekannten Wettstreit, nämlich dem zwischen den konservativen und den nach Fortschritt eifernden Kräften. Die einen suchen in der Vergangenheit und in tradierten Vorstellungen nach Lösungen, die anderen glauben an einzigartige Herausforderungen, die nur mit neuen Entwürfen gemeistert werden können. Auch heute erhitzen derartig antagonistische Positionen, beispielsweise in Gestalt der Bestrebungen zur Reaktivierung der mittelalterliche Landwirtschaft („biologischer Landbau“) gegen die Umsetzung „fortschrittlichen“ Gen-Foods, die Gemüter und liefern den Stoff für nicht selten polemische Auseinandersetzungen. Muss es also weitergehen oder sollte es wie früher sein?
Eine erschöpfende Antwort auf diese Frage wird wohl nicht möglich sein. Aber tatsächlich ist zu beobachten, dass in den meisten Abschnitten der Geschichte eines der beiden Topoi den Zeitgeist bestimmt hat. Das menschliche Selbstvertrauen – wie auch sein Selbstmisstrauen – wächst und schwindet im Einklang mit den Blüte- und Wartezeiten der Historie, wobei es insgesamt durch einen in der Vorstellungskraft zunehmend überblickbaren, zeitlichen Horizont eine größere Projektionsfläche bekommt. Damals wie heute wird mit solchen Projektionen – optimistischen wie pessimistischen Visionen – Politik gemacht, also mit gesellschaftlich vermittelten Ideen Gesellschaft geformt. Das vorherrschende Konzept von Zeitlichkeit ist im pragmatischen Ringen um Lösungen als (vielleicht) Voraussetzungsloses oft auch das nicht explizit Miteinbedachte. Es strukturiert das Denken und das Denkbare unbemerkt, stillschweigend, solange es nicht zum Gegenstand von Reflexionen wird (wobei auch diese durch eine vorgeschaltete Zeitkonzeption strukturiert sind). Vielleicht traut sich der Mensch umso mehr zu, je mehr er die Zeit zu beherrschen oder wenigstens zu verstehen glaubt. Als Zirkelkonstruktion, die als Selbstgeschaffenes das Schaffen strukturiert, um dann wiederum das Geschaffene zu verzeitlichen, hat sie jedenfalls einfache wie komplexe Antworten zum Problem „Werden und Vergehen“ inspiriert. Außerdem ist die Konzeption, welche der Mensch von Zeit hat, ein mächtiges – wenn nicht das mächtigste – Strukturmerkmal seiner individuellen wie auch sozialen Existenz. Der Letzteren widmet sich diese Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel und Gegenstand der Arbeit
- 1.2 Aufschlüsselung der Quellen: Die tabellarische Übersicht
- 1.3 Vergleichbare Untersuchungen
- 1.4 Theoretische Ausrichtung
- 2 Theoretisch-Methodische Grundlegung
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Hypothesenbildung und Nahtstellen der Analyseebenen
- 2.3 Darstellung von Zivilisationstheorie und strukturierender Inhaltsanalyse
- 2.3.1 Der Zivilisationsbegriff
- 2.3.2 Norbert Elias: Die Zivilisationstheorie
- 2.3.3 Mannheim und Elias: Die Konfigurationsanalyse
- 2.3.4 Grundannahmen
- 2.3.5 Der Prozess der Zivilisation
- 2.3.6 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3 Operationalisierung von Zivilisationstheorie und strukturierender Inhaltsanalyse
- 3.1 Anwendung der Zivilisationstheorie in dieser Untersuchung
- 3.2 Anwendung der strukturierenden Inhaltsanalyse in dieser Untersuchung
- 3.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 3.2.2 Vorverständnis, Entstehungssituation und formale Struktur
- 3.2.3 Bestimmung relevanter Textbestandteile; Ankerbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die gesellschaftliche Konstruktion von Zeit anhand einer Analyse von Thomas Mores Utopia. Ziel ist es, die Konzeption von Zeitlichkeit in Mores Werk zu ergründen und deren Einfluss auf die Gestaltung gesellschaftlicher Vorstellungen und Strukturen aufzuzeigen. Die Arbeit verknüpft dabei die Zivilisationstheorie von Norbert Elias mit Methoden der strukturierenden Inhaltsanalyse.
- Die gesellschaftliche Konstruktion von Zeit
- Die Rolle von Utopien in der Gestaltung von Zeitvorstellungen
- Anwendung der Zivilisationstheorie auf die Analyse von Utopien
- Methodische Aspekte der strukturierenden Inhaltsanalyse
- Der Einfluss von Zeitkonzeptionen auf gesellschaftliche Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Konstruktion von Zeit ein und beleuchtet die Relevanz der Fragestellung vor dem Hintergrund aktueller Debatten über Fortschritt, Wandel und gesellschaftliche Herausforderungen. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und die verwendeten Quellen, insbesondere Thomas Mores Utopia. Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen und das Ziel der Arbeit dar, das darin besteht, die Konzeption von Zeitlichkeit in Mores Utopia zu analysieren und deren gesellschaftlichen Einfluss zu untersuchen.
2 Theoretisch-Methodische Grundlegung: Dieses Kapitel legt die theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Zivilisation und Zeitlichkeit und beschreibt die Hypothesen, die die Analyse leiten. Ein wichtiger Teil dieses Kapitels ist die detaillierte Vorstellung der Zivilisationstheorie von Norbert Elias und ihrer Anwendung auf die Untersuchung von Utopien. Weiterhin wird die strukturierende Inhaltsanalyse als Methode zur Analyse von Thomas Mores Utopia erläutert und begründet. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Theorie und Methode, um ein solides Fundament für die anschließende Analyse zu schaffen.
3 Operationalisierung von Zivilisationstheorie und strukturierender Inhaltsanalyse: In diesem Kapitel wird die konkrete Anwendung der in Kapitel 2 vorgestellten Theorie und Methode auf das Ausgangsmaterial (Thomas Mores Utopia) operationalisiert. Es werden die spezifischen Schritte der Inhaltsanalyse detailliert beschrieben, inklusive der Auswahl des Materials, der Bestimmung relevanter Textbestandteile und der Entwicklung von Ankerbeispielen. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Zivilisationstheorie konkret auf die Analyse der Zeitkonzeption in Utopia angewendet wird und wie die Ergebnisse der Inhaltsanalyse interpretiert werden sollen. Die Operationalisierung stellt sicher, dass die Analyse systematisch und nachvollziehbar durchgeführt wird.
Schlüsselwörter
Gesellschaftliche Konstruktion von Zeit, Utopie, Thomas Morus, Zivilisationstheorie, Norbert Elias, Strukturierende Inhaltsanalyse, Zeitsemantik, Fortschritt, Gesellschaftsgestaltung, Konfigurationsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Magisterarbeit: Gesellschaftliche Konstruktion von Zeit in Thomas Mores Utopia
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die gesellschaftliche Konstruktion von Zeit anhand einer Analyse von Thomas Mores Utopia. Das zentrale Ziel ist es, die Konzeption von Zeitlichkeit in Mores Werk zu ergründen und deren Einfluss auf die Gestaltung gesellschaftlicher Vorstellungen und Strukturen aufzuzeigen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verknüpft die Zivilisationstheorie von Norbert Elias mit Methoden der strukturierenden Inhaltsanalyse. Die strukturierende Inhaltsanalyse dient der systematischen Analyse von Thomas Mores Utopia, während die Zivilisationstheorie den theoretischen Rahmen für die Interpretation der Ergebnisse liefert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gesellschaftliche Konstruktion von Zeit, Utopie, Thomas Morus, Zivilisationstheorie, Norbert Elias, Strukturierende Inhaltsanalyse, Zeitsemantik, Fortschritt, Gesellschaftsgestaltung, und Konfigurationsanalyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vorstellt; ein Kapitel zur theoretisch-methodischen Grundlegung, das die Zivilisationstheorie und die strukturierende Inhaltsanalyse detailliert beschreibt; und ein Kapitel zur Operationalisierung, in dem die Anwendung der Theorie und Methode auf Thomas Mores Utopia erläutert wird.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Konstruktion von Zeit ein, beleuchtet die Relevanz der Fragestellung und skizziert den methodischen Ansatz. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen und das Ziel der Arbeit dar: die Analyse der Zeitkonzeption in Mores Utopia und deren gesellschaftlichen Einfluss.
Was wird im Kapitel zur theoretisch-methodischen Grundlegung behandelt?
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Zivilisation und Zeitlichkeit, beschreibt die Hypothesen der Analyse und stellt die Zivilisationstheorie von Norbert Elias und deren Anwendung auf Utopien detailliert vor. Es erläutert die strukturierende Inhaltsanalyse als Methode und verbindet Theorie und Methode für ein solides Fundament der Analyse.
Was wird im Kapitel zur Operationalisierung behandelt?
Hier wird die konkrete Anwendung der Theorie und Methode auf Thomas Mores Utopia operationalisiert. Die spezifischen Schritte der Inhaltsanalyse werden detailliert beschrieben, inklusive Materialauswahl, Bestimmung relevanter Textbestandteile und Entwicklung von Ankerbeispielen. Es wird gezeigt, wie die Zivilisationstheorie auf die Analyse der Zeitkonzeption in Utopia angewendet und die Ergebnisse interpretiert werden.
Welche Hypothesen werden in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit formuliert Hypothesen, die die Analyse leiten, jedoch sind diese im gegebenen Textauszug nicht explizit aufgeführt. Diese sind im vollständigen Text der Magisterarbeit zu finden.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle der Arbeit ist Thomas Mores Utopia. Die Arbeit verweist außerdem auf vergleichbare Untersuchungen und relevante Literatur zur Zivilisationstheorie und Inhaltsanalyse (genaue Quellenangaben sind im vollständigen Text enthalten).
Wo finde ich den vollständigen Text der Magisterarbeit?
Der vollständige Text der Magisterarbeit ist nicht in diesem Auszug enthalten. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit des vollständigen Textes müssten separat eingeholt werden.
- Citation du texte
- Christof Niemann (Auteur), 2007, Utopie und Zeitsemantik - Zur gesellschaftlichen Konstruktion der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77764