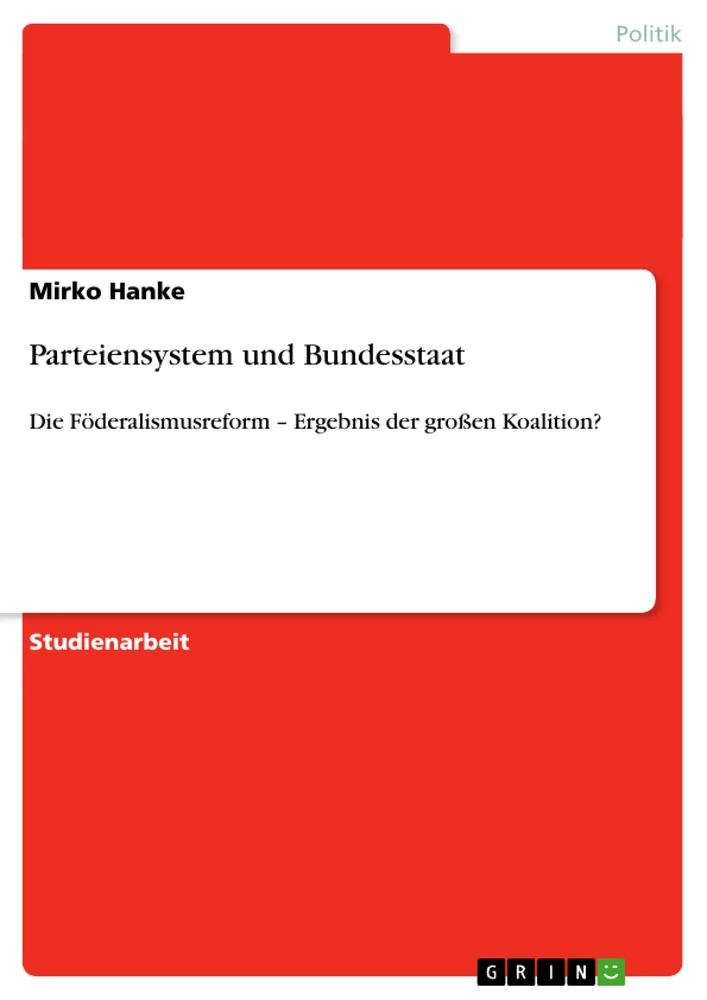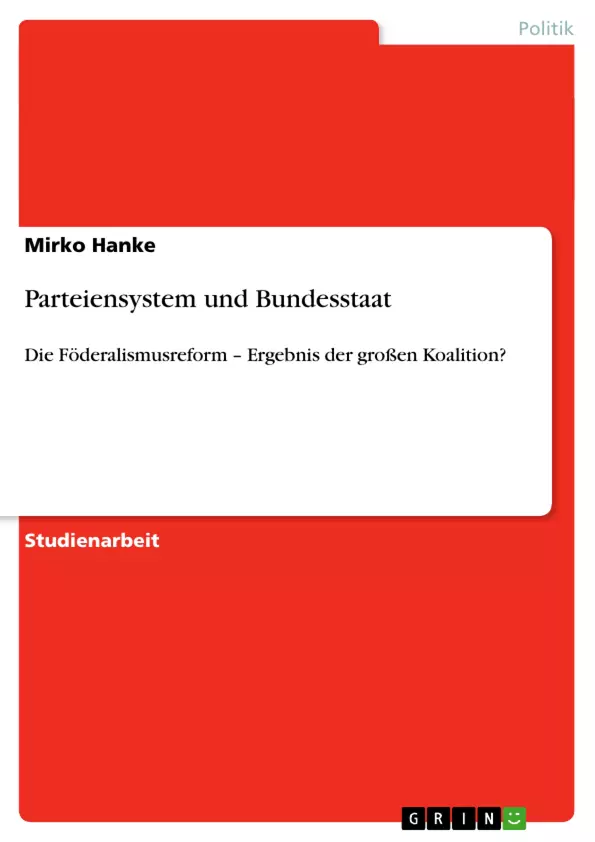Ausgehend von der Frage, warum der erste Versuch der Reform im Jahr 2004 scheiterte, wird untersucht, welche Faktoren im Parteienwettbewerb und im bundesstaatlichen System sich so geändert haben, dass eine Reform im Jahr 2006 plötzlich möglich wurde. Dabei liegt es natürlich nahe, von der Arbeitshypothese auszugehen, die, für das vereinigte Deutschland bisher einzigartige, große Koalition aus SPD und CDU/CSU auf Bundesebene sei dafür verantwortlich. Dies scheint sich mit Lehmbruchs Arenentheorie sowie der Theorie der Regelsysteme zu decken. Der Autor versucht jedoch, sich dem Problem so zu nähern, dass die Bildungspolitik als einzelner Konflikt herausgegriffen wird, um das Verhalten der wichtigsten Akteure zu analysieren und strukturiert an der o.g. Fragestellung zu prüfen. Die Bildungspolitik als solche ist ein weiter Rahmen, der sich bis zum Kinder- und Jugendhilferecht verzweigen kann, daher wird es in dieser Arbeit nur um die streitrelevanten Fragen der Bildungsplanung, der Rahmengesetzgebung, des Hochschulbaus und der Forschungsförderung gehen.
Daran anknüpfend wird die Frage behandelt, warum es gerade eine originäre Länderkompetenz war, die den ersten Versuch einer Reform hat scheitern lassen. Wie ist dies im Zusammenhang mit Lehmbruchs Arenentheorie zu sehen und welche Erklärung gibt es für die schnelle Einigung zu Beginn des Jahres 2006, wenn man das Verhalten der Parteien in den Mittelpunkt rückt? Um diese Fragen zu klären, wird ein vergleichender Ansatz gewählt. Zwei Zeiträume, die erste Diskussion um die Reform ab 2003 und die letztendliche Debatte 2005/2006, werden mit der Betrachtung des Akteursverhaltens verbunden. Dabei sind vor allem die politischen Parteien der großen Koalition zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Einführung
- Die Reformdebatte 2003/2004
- Bund, Länder und Parteien zu Beginn des Föderalismusstreits
- Die Bundesstaatskommission – Entwicklung der Argumentation
- Fazit der Reformbemühungen 2003/2004
- Die Reformdebatte 2005/2006
- Die Parteien in der großen Koalition
- Parteipolitik und Verhandlungsergebnis
- Gesamtfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These von Gerhard Lehmbruch über die Inkongruenz von Parteienwettbewerb und Bundesstaat im Kontext der Reformdebatte um die bundesstaatliche Ordnung. Sie analysiert die Gründe für das Scheitern des ersten Reformversuchs im Jahr 2004 und untersucht die Faktoren, die eine Reform im Jahr 2006 ermöglichten. Dabei steht die Rolle der großen Koalition aus SPD und CDU/CSU im Vordergrund.
- Analyse der Inkongruenz von Parteienwettbewerb und Bundesstaat nach Lehmbruch
- Bedeutung der großen Koalition für die Reform
- Vergleich der Reformbemühungen 2003/2004 und 2005/2006
- Analyse des Akteursverhaltens der Parteien, Länder und des Bundes
- Anwendung der Arenentheorie von Lehmbruch auf die Reformdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage und die theoretische Grundlage der Arbeit, die auf Lehmbruchs These der Inkongruenz basiert. Das erste Kapitel führt in das Thema der Reformdebatte um den Föderalismus ein und erklärt die Kernpunkte von Lehmbruchs Arenentheorie.
Das zweite Kapitel analysiert die Reformdebatte 2003/2004, die mit dem Scheitern der Bundesstaatskommission endete. Es beleuchtet die Positionen der Akteure, insbesondere die Rolle der Parteien, und zeigt die Gründe für die Blockade der Reformbemühungen auf.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Reformdebatte 2005/2006, die im Kontext der großen Koalition stattfand. Es untersucht die Veränderungen im Parteienwettbewerb und im Bundesstaat, die zu einer Einigung führten.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Parteienwettbewerb, Bundesstaat, Inkongruenz, große Koalition, Reformdebatte, Arenentheorie, Lehmbruch, Bildungspolitik, Länderkompetenz, Handlungslogik, Akteursverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Föderalismusreform im Jahr 2004?
Der erste Reformversuch scheiterte vor allem an Konflikten über Länderkompetenzen, insbesondere in der Bildungspolitik, und an Blockaden im Parteienwettbewerb.
Welche Rolle spielte die Große Koalition für die Reform 2006?
Die Koalition aus SPD und CDU/CSU ermöglichte es, die strukturelle Inkongruenz zwischen Parteienwettbewerb und Bundesstaat zu überbrücken und so eine Einigung herbeizuführen.
Was besagt Gerhard Lehmbruchs Arenentheorie?
Die Theorie beschreibt die Spannung zwischen der Arena des Parteienwettbewerbs und der Arena des föderalen Verhandlungssystems, die oft zu politischen Blockaden führt.
Warum wurde die Bildungspolitik als zentraler Konfliktpunkt gewählt?
Bildung ist eine Kernkompetenz der Länder. An Fragen wie Bildungsplanung und Hochschulbau ließ sich das Verhalten der Akteure und die Problematik der Kompetenzverteilung besonders gut analysieren.
Was unterscheidet die Debatte von 2003/04 von der von 2005/06?
Während 2003/04 die Bundesstaatskommission an parteipolitischen Differenzen scheiterte, führte die veränderte Machtkonstellation der Großen Koalition 2006 zu einem schnellen Verhandlungsergebnis.
- Citation du texte
- Mirko Hanke (Auteur), 2006, Parteiensystem und Bundesstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77793