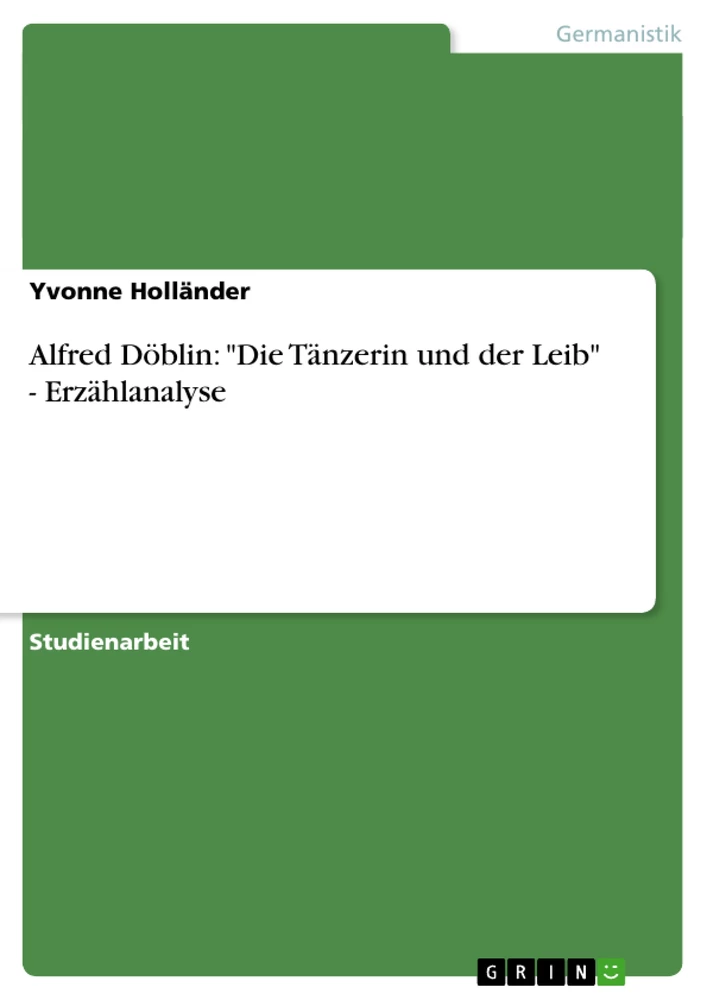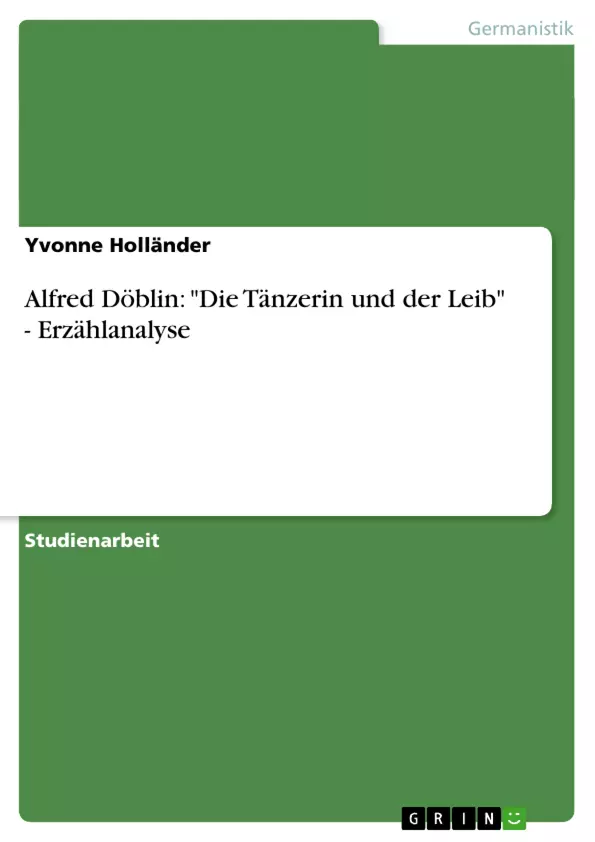Bei beinahe keinem Autor scheint die Struktur eines Textes dermaßen bedeutsam wie bei Döblin, indem sie die Interpretation unterstützt und festigt. Kein Wort ist zufällig gewählt, kein Satz steht hier, der nicht harmonierend zum Gesamtgefüge beiträgt, so dass jedes seiner Werke einer perfekten Komposition gleichkommt. Der Aufbau ist also mindestens ebenso wichtig wie der Inhalt und stellt dessen Grundlage dar.
In dieser Arbeit soll nun die Struktur von Döblins Kurzgeschichte „Die Tänzerin und der Leib“ untersucht werden, wobei auf den Erzähler, die wechselnden Erzählperspektiven und die von ihm genutzten Bilder eingegangen wird. Abschließend soll noch geklärt werden, inwieweit durch diese Elemente eine bestimmte Interpretation vorgegeben wird und den Leser zu ihrer Annahme „zwingt“.
In dieser Erzählung wird eine Tänzerin von einer Krankheit befallen, was dazu führt, dass sie ins Krankenhaus muss. Ihr bereits vorher schon distanziertes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper wird mit Fortschreiten des Siechtums immer ausgeprägter und führt schließlich zu einer kompletten Entzweiung. Die Geschichte endet damit, dass sich die Protagonistin das Leben nimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Tänzerin...
- Erzähler und Erzählperspektive
- Die Darstellung der Tänzerin
- ... und der Leib
- Rhetorische Figuren
- Die Entzweiung von Geist und Körper
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Struktur von Alfred Döblins Kurzgeschichte „Die Tänzerin und der Leib“, mit dem Ziel, die Bedeutung der Erzählperspektive und der Sprache für die Interpretation des Textes zu beleuchten. Es soll geklärt werden, inwieweit Döblins Erzähltechnik den Leser zu einer bestimmten Interpretation „zwingt“.
- Die Rolle des Erzählers in der Darstellung der Tänzerin
- Die wechselnden Erzählperspektiven im Text
- Die Bedeutung von Rhetorischen Figuren und Sprache
- Die Entzweiung von Geist und Körper als zentrales Thema
- Der Einfluss der Struktur auf die Interpretation der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Struktur in Döblins Werken heraus und hebt die besondere Bedeutung des Aufbaus der Kurzgeschichte „Die Tänzerin und der Leib“ hervor.
Die Tänzerin...
Erzähler und Erzählperspektive
Die Kurzgeschichte lässt sich in zwei Teile gliedern, die sich durch unterschiedliche Erzählperspektiven auszeichnen. Im ersten Teil dominiert ein beobachtender Erzähler, der die Tänzerin aus seiner eigenen Perspektive beschreibt und bewertet. Im zweiten Teil hingegen tritt die Perspektive der Tänzerin durch erlebte Rede in den Vordergrund. Döblin nutzt diese wechselnden Perspektiven, um die Entwicklung der Tänzerin und ihre zunehmend distanzierte Beziehung zu ihrem eigenen Körper darzustellen.
Die Darstellung der Tänzerin
Döblins Sprache und die von ihm gewählten Bilder spielen eine entscheidende Rolle in der Darstellung der Tänzerin. Die Verwendung pejorativer Begriffe durch den beobachtenden Erzähler im ersten Teil prägt das Bild, das sich der Leser von der Tänzerin macht. Im zweiten Teil hingegen verwendet Döblin erlebte Rede, um die Gedanken und Gefühle der Tänzerin authentisch wiederzugeben.
... und der Leib
Rhetorische Figuren
Die Verwendung rhetorischer Figuren wie Interjektionen und Appositionen im zweiten Teil des Textes verstärkt die erlebte Rede und unterstreicht die Verzweiflung der Tänzerin. Diese sprachlichen Mittel dienen dazu, die subjektive Perspektive der Hauptfigur zu verstärken.
Die Entzweiung von Geist und Körper
Döblins Darstellung der Tänzerin und ihrer Krankheit zeigt die zunehmende Entzweiung von Geist und Körper. Durch die Krankheit wird die Distanz der Tänzerin zu ihrem Körper immer stärker, bis sie schließlich in einer vollständigen Trennung endet.
Schlüsselwörter
Alfred Döblin, „Die Tänzerin und der Leib“, Erzählperspektive, erlebte Rede, Rhetorische Figuren, Entzweiung von Geist und Körper, Krankheit, Interpretation, Struktur, Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Döblins Erzählung „Die Tänzerin und der Leib“?
Die Geschichte handelt von einer Tänzerin, deren distanziertes Verhältnis zu ihrem Körper durch eine Krankheit zu einer vollständigen Entzweiung von Geist und Leib führt, was schließlich im Suizid endet.
Welche Erzählperspektiven nutzt Döblin in diesem Werk?
Die Erzählung wechselt zwischen einem beobachtenden, wertenden Erzähler im ersten Teil und der subjektiven Perspektive der Tänzerin durch „erlebte Rede“ im zweiten Teil.
Wie unterstützt die Struktur des Textes die Interpretation?
Döblins präzise Wortwahl und der Aufbau der Erzählung wirken wie eine Komposition, die den Leser dazu drängt, die fortschreitende Entfremdung der Protagonistin nachzuvollziehen.
Welche rhetorischen Figuren sind für die Darstellung zentral?
Besonders im zweiten Teil nutzt Döblin Interjektionen und Appositionen, um die Verzweiflung und die subjektive Qual der Tänzerin sprachlich zu verstärken.
Was ist das zentrale Thema der Erzählanalyse?
Das zentrale Thema ist die Entzweiung von Geist und Körper und wie Döblin diese durch spezifische Erzähltechniken und pejorative Sprache darstellt.
- Citar trabajo
- Yvonne Holländer (Autor), 2003, Alfred Döblin: "Die Tänzerin und der Leib" - Erzählanalyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78032