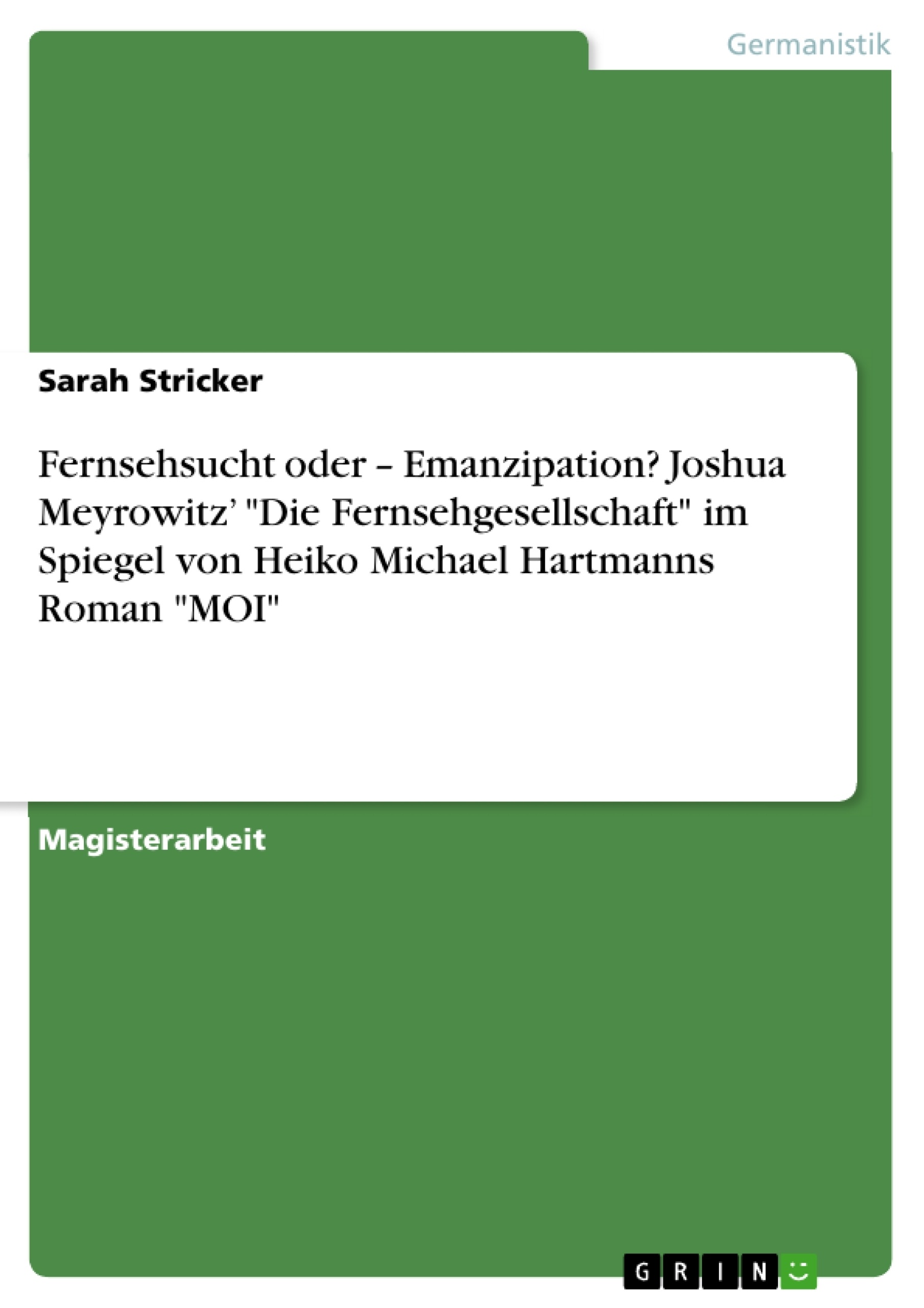Der Streit um Verdienst oder Gefahr des Fernsehens ist älter, als die Flimmerkiste selbst. Seitdem haben sich die Argumente für oder wider vielleicht augenscheinlich vermehrt – Verblödung, Vermassung, Verrohung auf der einen; Wissensgewinn, Demokratisierung, globale Vernetzung der Menschen auf der anderen Seite – doch im Kern bleibt die Gretchenfrage gleich: Neue Medien – satanisch oder göttlich?
Satanisch, würde Heiko Michael Hartmanns Protagonist Fred Openkör zweifellos sagen, der als schleichend verfaulender Fleischballen dem grotesken Tod durch Zerplatzen entgegen sieht. Ein mysteriöser Virus, der sich über 50-Euro-Scheine verbreitet, zwingt den Buchmenschen in die verhasste Kommunität mit seinen MOI-Leidensgenossen (zugleich Abkürzung für Maladie d’Origine Inconnue als auch franz. Ich), die ihn mit ihrem Fernsehwahn schon mal einen Vorgeschmack auf das nahe Ende liefern – allen voran Kioskverkäufer Dupek, der das sinnlose bis Karies verursachende Einerlei seines Ladens in Form stumpfsinniger TV-Häppchen ins Krankenzimmer schleust.
Openkör ist gefangen in einem Paralleluniversum, in dem die, die er einst belächelte, seine ohnehin schon jämmerliche Existenz zur Hölle machen: der unerbittliche Zappingterrorist inklusive fernsehsüchtiger Sippschaft, der penetrante Sozialhelfer, der Pastor, der sich in lächerlicher Weise selbst zu infizieren sucht, usw.
Die Welt im Krankenzimmer ist eine verkehrte. Nur hier kann eine einfache Krankenschwester einen renommierten Anwalt, einen „Dr.“, mit einem Klaps auf den Po zurechtweisen. Im Mikrokosmos der MOI-Station werden erwachsene Männer zu hilflosen Kindern, die gewaschen und gefüttert werden, wird der Gebildete zum Spielball der „Dupeks“. Das Geld, einst verheißungsvoller Bote des Fortschritts ist hier Auslöser des schleichenden Verfalls. Professor Zahl, „die Realität in ihrer gröbsten Form“ hat als „geldgieriger Gliedabschneider“ die ärztliche Unantastbarkeit eingebüßt. Die alten Hierarchien sind aufgelöst – genauso wie in Joshua Meyrowitz’ „Fernsehgesellschaft“.
Der amerikanische Medientheoretiker geht davon aus, dass die traditionellen Unterschiede zwischen Menschen durch eine Trennung in separate Erfahrungswelten bewirkt und durch die Printmedien verstärkt werden. Die neuen Kommunikationsmittel wie Fernsehen, Telefon und Computer verwischen hingegen die Grenzlinien verschiedener Gruppen, indem sie zuvor getrennte Situationen miteinander kombinieren. Das Resultat ist die gleiche verkehrte Welt, die Hartmanns Ich-Erzähler zeichnet: Die Schwachen hinterfragen das Handeln der Mächtigen, die Kluft zwischen Kind und Erwachsenem verwischt, Frauen zwingen ihre Männer hinter den Herd, Autoritäten, Titel, etc. verlieren an Bedeutung.
Und genau darum ist das Fernsehen göttlich, würde Joshua Meyrowitz erwidern. Während nämlich Openkör den Untergang der Menschheit durch kollektiv infizierte Blödheit erwartet, sieht Meyrowitz die elektronischen Medien als zu begrüßendes Mittel der Demokratisierung und Emanzipation. Gleicher Befund, unterschiedliche Interpretation.
Allerdings besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen McLuhans global village und Openkör’schem Krankenzimmer: Auf der einen Seite haben wir die Medien als Körperextensionen, auf der anderen steht ein Virus, der die Menschen ihrer Extremitäten beraubt. Nach und nach verlieren die MOI-Kranken schier jegliche Verbindung zur Außenwelt, Hände, Nase, Stimme, bis sie schließlich im P-Raum abgeschlossen vom Rest der Menschheit einen obszönen Tod sterben. Openkör ist in sich selbst gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes ego-zentrisch („Ich Ich Ich…! Mit solcher Lektüre hatte ich mein Leben vertan!“ ), ohne sich dabei selbst zu begreifen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die beiden Pole Fernseh-Sucht und -Emanzipation einander gegenüberzustellen und zu zeigen, inwieweit sie sich in Openkör als radikalem Fernsehkritiker und Dupek, dessen TV-Liebe in Fernsehsucht abdriftet, widerspiegeln, bzw. inwieweit der Roman valides Wissen zur Festigung oder Unterminierung der einzelnen Theorien zur Verfügung stellt. Dabei übernimmt die satanische Seite den Anfang, zum einen, weil die Negativargumente als in der Gesellschaft dominant weniger Überzeugungsarbeit bedürfen, zum anderen, um der Chronologie der Forschungstradition, die sich von einer stark abwehrenden zu einer vermehrt hoffnungsvollen Einschätzung des Fernsehens entwickelt hat, Rechnung zu tragen.
Über einen Abriss der Fernsehkritik von den vehementen Anfängen eines Adorno oder Anders zu den objektivierenden Analysen der Gegenwart, soll sich der Frage genähert werden: Was ist Sucht? Kann zwanghaftes Fernsehen die Kriterien einer Abhängigkeit erfüllen? Gibt es eine Suchtpersönlichkeit und fällt Dupek als Fernsehbesessener unter diese Kategorie? Dabei werden neben literatur- und medienwissenschaftlichen Ansätzen auch neurophysiologische und psychologische Erkenntnisse Berücksichtigung finden, soweit das im Rahmen dieser Arbeit möglich ist.
Hieran schließt sich die weniger populäre, positive Darstellung des Fernsehens. Was kann die Flimmerkiste bei aller Schelte leisten? Vergangenheitsbewältigung? Wissensgewinn? Egalität? Die göttliche Seite gipfelt in Meyrowitz’ Analyse, der in den televisionären Auswirkungen eine emanzipatorische Kraft erkennt. Seine message: Fernsehen ist antiautoritär.
Die Zweiteilung in gut und böse kann jedoch, um These und Antithese nicht auseinander zu reißen, nicht starr eingehalten werden. Stattdessen finden sich Für und Wider teilweise Seite an Seite, ohne die dualistische Struktur ganz aufzulöse
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Böses Fernsehen
- 2.1 Kritik der Kulturindustrie
- 2.2 Von Massenmenschen und Menschenmassen
- 2.3 Unsichtbare Zensur
- 2.4 Die Macht der Bilder
- 2.5 Die Droge im Wohnzimmer
- 2.6 Openkör und die Flimmerkiste
- 3. Fernsehsucht
- 3.1 Geschichte der Sucht
- 3.2 Was ist Sucht?
- 3.3 Was macht die Sucht mit dem Süchtigen?
- 3.4 Dupeks und andere Suchtpersönlichkeiten
- 3.5 Warum das Abschalten so schwer fällt: Spiel, Spaß und Stimmungslenkung
- 4. Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation
- 4.1 Sein oder Schein. Was kommt zuerst?
- 4.2 Passiv oder aktiv
- 4.3 Das starre Publikum
- 5. Fernsehemanzipation
- 5.1 Fernsehen macht frei
- 5.2 Buch und Fernsehen
- 5.3 Das Öffentliche und das Private
- 5.4 Ort und Situation
- 5.5 Gruppenidentität, Sozialisation, Hierarchie
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ambivalenten Auswirkungen des Fernsehens auf die Gesellschaft. Sie beleuchtet die Geschichte des Mediums, von seinen Anfängen bis zum Aufkommen des privaten Fernsehens, und analysiert kritisch seine gesellschaftlichen Einflüsse. Der Text hinterfragt sowohl die potenziell negativen Aspekte, wie Sucht und Manipulation, als auch die Möglichkeit einer emanzipatorischen Nutzung des Fernsehens.
- Die Geschichte des Fernsehens und seine Entwicklung
- Kritik am Fernsehen als Instrument der Kulturindustrie und Massenmanipulation
- Das Phänomen der Fernsehsucht und deren Auswirkungen
- Der Paradigmenwechsel von der Sucht zur Emanzipation durch das Fernsehen
- Die Rolle des Fernsehens in der Gesellschaft und seine Auswirkungen auf soziale Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem historischen Überblick, der die Erfindung des Kinos und des Fernsehens in den Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse stellt. Sie stellt die zentrale Frage nach der ambivalenten Natur des Fernsehens – satanisch oder göttlich? – und kündigt die folgenden Kapitel an, die diese Frage aus verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Die frühen Jahre des Kinos und Fernsehens werden als ambivalent dargestellt, mit Erfolgen und Kritikpunkten, welche die Entwicklung des Mediums geprägt haben. Der Bezug zu historischen Ereignissen wie dem Dreyfus-Prozess und dem Naziregime unterstreicht die vielschichtige Bedeutung des Mediums.
2. Böses Fernsehen: Dieses Kapitel analysiert kritische Perspektiven auf das Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf seine Funktion als Instrument der Kulturindustrie. Es beleuchtet die Mechanismen der Massenmanipulation durch Bilder und deren Auswirkungen auf das Individuum. Die Kapitel-Unterpunkte behandeln Themen wie die Kritik an der Kulturindustrie, die Frage nach der Beeinflussung von Massen durch Medien, die subtilen Formen der Zensur und die Macht der Bilder, die Suchtgefahr und schließlich eine literarische Betrachtung des Themas im Kontext des Romans "MOI". Das Kapitel zeichnet ein differenziertes Bild der problematischen Einflüsse, die das Fernsehen auf die Gesellschaft ausüben kann.
3. Fernsehsucht: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen der Fernsehsucht. Es skizziert die Geschichte des Suchtbegriffs, definiert den Begriff der Sucht im Kontext des Fernsehens und analysiert die Auswirkungen von Fernsehkonsum auf den Betroffenen. Dabei werden verschiedene Persönlichkeitstypen vorgestellt, die durch die Fernsehsucht geprägt sind, und die Mechanismen der Suchtbildung erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erörterung der psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Fernsehsucht sowie der Schwierigkeiten, sich vom Fernsehen zu lösen, unter Einbeziehung der Aspekte Spiel, Spaß und Stimmungslenkung.
4. Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation: Dieses Kapitel präsentiert einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Fernsehens. Es hinterfragt die Sichtweise des Fernsehens als reine Suchtquelle und beleuchtet die Möglichkeit seiner emanzipatorischen Nutzung. Die Kapitel-Unterpunkte diskutieren die Fragen nach der aktiven oder passiven Rezeption von Inhalten, der Rolle des Publikums und dem Potential des Fernsehens als Instrument der Selbstermächtigung. Es wird eine Abkehr von der traditionellen, kritischen Sichtweise angestrebt, um das positive Potenzial aufzuzeigen.
5. Fernsehemanzipation: Das Kapitel untersucht detailliert, wie das Fernsehen zur Emanzipation beitragen kann. Es beleuchtet die Möglichkeiten, die das Medium bietet, um "frei" zu machen. Die Themen Buch vs. Fernsehen, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit sowie der Einfluss auf Ort, Situation und soziale Gruppen werden eingehend diskutiert. Die Kapitel-Unterpunkte erörtern die Rolle des Fernsehens in der Sozialisation, in der Gruppenidentität und in der Hierarchie. Der Fokus liegt auf dem Potenzial des Fernsehens als Werkzeug der gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Fernsehen, Medienkritik, Kulturindustrie, Massenmanipulation, Fernsehsucht, Emanzipation, Medienwirkung, Gesellschaft, Sozialisation, Identität, Paradigmenwechsel, Openkör, MOI.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Böses Fernsehen oder Fernsehen macht frei?"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ambivalenten Auswirkungen des Fernsehens auf die Gesellschaft. Sie beleuchtet sowohl die potenziell negativen Aspekte wie Sucht und Manipulation als auch die Möglichkeit einer emanzipatorischen Nutzung des Mediums.
Welche Aspekte des Fernsehens werden kritisch beleuchtet?
Die Arbeit analysiert kritische Perspektiven auf das Fernsehen, insbesondere seine Funktion als Instrument der Kulturindustrie und die Mechanismen der Massenmanipulation durch Bilder. Themen wie Fernsehsucht, die Macht der Bilder, subtile Zensur und die Beeinflussung von Massen werden eingehend behandelt.
Wie wird das Phänomen der Fernsehsucht behandelt?
Das Kapitel zur Fernsehsucht skizziert die Geschichte des Suchtbegriffs, definiert Sucht im Kontext des Fernsehens und analysiert die Auswirkungen des Fernsehkonsums auf Betroffene. Verschiedene Persönlichkeitstypen, die durch Fernsehsucht geprägt sind, werden vorgestellt, und die Mechanismen der Suchtbildung werden erläutert.
Wird ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Fernsehens vorgeschlagen?
Ja, die Arbeit präsentiert einen Paradigmenwechsel, der über die reine Sichtweise des Fernsehens als Suchtquelle hinausgeht und das Potenzial seiner emanzipatorischen Nutzung beleuchtet. Die Möglichkeit einer aktiven und selbstbestimmten Rezeption wird diskutiert.
Wie wird die emanzipatorische Nutzung des Fernsehens dargestellt?
Das Kapitel zur Fernsehemanzipation untersucht detailliert, wie das Fernsehen zur Emanzipation beitragen kann. Es beleuchtet Möglichkeiten, die das Medium bietet, um "frei" zu machen. Der Einfluss auf Sozialisation, Gruppenidentität, Hierarchie und das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit wird eingehend diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Böses Fernsehen, Fernsehsucht, Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation, Fernsehemanzipation und Schluss. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Beziehung zwischen Fernsehen und Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehen, Medienkritik, Kulturindustrie, Massenmanipulation, Fernsehsucht, Emanzipation, Medienwirkung, Gesellschaft, Sozialisation, Identität, Paradigmenwechsel, Openkör, MOI.
Welche historischen Bezüge werden hergestellt?
Die Einleitung stellt die Erfindung des Kinos und des Fernsehens in den Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse, mit Bezug auf historische Ereignisse wie den Dreyfus-Prozess und das Naziregime.
Welche literarischen Bezüge werden in der Arbeit erwähnt?
Der Roman "MOI" wird im Kontext der literarischen Betrachtung des Themas "Böses Fernsehen" erwähnt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Fernsehens auseinandersetzen möchte. Sie eignet sich besonders für die Analyse von Medienwirkung und -kritik.
- Citar trabajo
- Magister Artium Sarah Stricker (Autor), 2005, Fernsehsucht oder – Emanzipation? Joshua Meyrowitz’ "Die Fernsehgesellschaft" im Spiegel von Heiko Michael Hartmanns Roman "MOI", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78070