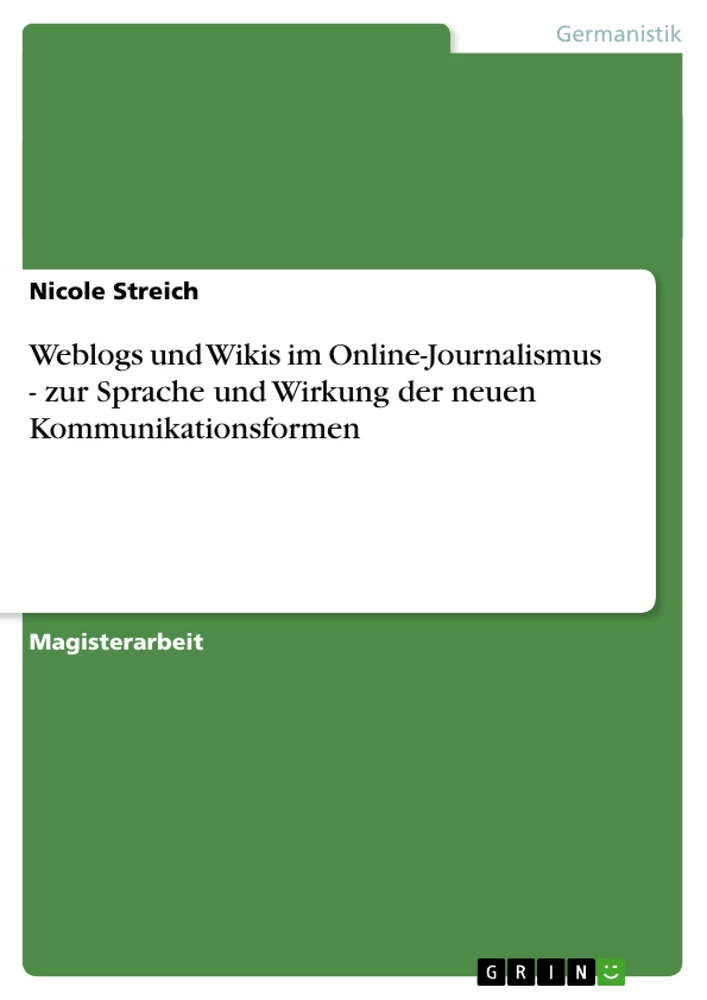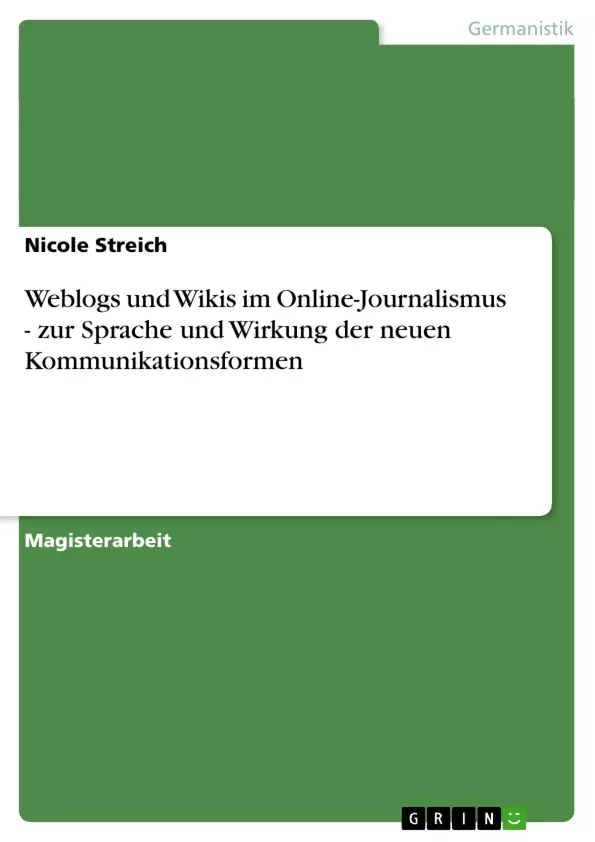Weblogs und Wikis gehören zu den neuen Kommunikationsformen des sog. Web 2.0, das in der IT- und Internetbranche derzeit als Schlagwort des Jahres gilt. Im Vergleich zum früheren Verständnis des World Wide Webs, bezeichnet der Begriff Web 2.0 eine veränderte Wahrnehmung und Nutzung des Internets. So soll die Veröffentlichung von Informationen nicht mehr nur wenigen Experten überlassen sein, es sollen vielmehr alle Nutzer integriert und beteiligt werden. (vgl. Helmes 2006: 18-19)
Diese Entwicklung hat auch für den Online-Journalismus bedeutende Folgen, denn es ist offensichtlich, “dass es im Internet mehr an Journalismus online gibt als nur den Online-Journalismus“. (Bucher/Büffel 2006: 132) Zu solchen meist nicht professionell organisierten Formen des Journalismus gehören u.a. auch Weblogs und Wikis.
Deren rasante Entwicklung wirkt sich immer mehr auf die traditionelle Medienwelt aus.
Diesbezüglich befürchtet Medienexperte Ehrhardt Heinold, dass sofern “Blogs aktueller als Nachrichten und Wikis umfangreicher als Lexika sind – dann stellt sich die Frage, welche Inhalte Verlage künftig noch verkaufen können.“ (Heinold 2006: 154)
So werden vor allem Weblogs als Konkurrenz zum traditionellen Journalismus gesehen, da sie diesen offenbar vor allem in Bezug auf Aktualität, Meinungsvielfalt und Diskussionsgehalt eingeholt haben.
Da sich die beiden Publikationsformen jedoch in vielerlei Hinsicht ergänzen und gegenseitig unterstützen können, bietet sich statt eines Konkurrenzverhältnisses die Integration von Weblogs in das Angebot etablierter Online-Zeitungen an. So kann – angeschlossen an ein vertrauenswürdiges Unternehmen – in den Weblogs eine andere Art des Journalismus praktiziert werden.
Dementsprechend soll in dieser Arbeit untersucht werden, welche Potenziale sich daraus ergeben, wenn Journalisten zu Autoren von Weblogs werden.
“Indem sich Journalisten Weblogs als neues Mittel der Kommunikation aneignen, verändern sie ihr Arbeitsverhalten und damit ihre Produkte, auch wenn sie für etablierte Medien arbeiten. Weblogs sind primär eine Chance für den Journalismus – und keine Gefahr.“ (Welker 2006: 157)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Geschichte der Zeitung
- 2.1 Gedruckte Zeitungen
- 2.1.1 Gliederung
- 2.1.2 Textsorten
- 2.2 Online-Zeitungen
- 2.2.1 Gliederung
- 2.2.2 Textaufbau
- 2.2.3 Textsorten
- 2.3 Unterschiede zwischen Print- und Online-Zeitungen
- 2.3.1 Technisch bedingte Unterschiede
- 2.3.2 Funktionale Unterschiede
- 2.1 Gedruckte Zeitungen
- 3. Gestaltungsprinzipien für Online-Zeitungen
- 3.1 Die optimale Lesbarkeit am Bildschirm
- 3.2 Orientierung
- 3.2.1 Layout
- 3.2.2 Teaser
- 3.2.3 Headline, Vorspann und Zwischenüberschrift
- 3.3 Inhaltliche Besonderheiten
- 4. Weblogs im Online-Journalismus
- 4.1 Weblogs allgemein
- 4.1.1 Geschichte
- 4.1.2 Weblogs als journalistisches Instrument
- 4.1.3 Wortbildungen
- 4.1.4 Blogs vs. normale Webseiten
- 4.2 Vorteile der Blog-Integration in Online-Zeitungen
- 4.2.1 Kommunikation zw. Journalist und Leser
- 4.2.2 Sprache in journalistischen Weblogs
- 4.2.3 Erzeugung von Aufmerksamkeit & Vertrauen
- 4.2.4 Weblogs als Instrument zur Recherche
- 4.3 Analyse der journalistischen Weblogs
- 4.3.1 Blogbezeichnungen
- 4.3.2 Blog-/ Autorbeschreibung
- 4.3.3 Layout der Blogs
- 4.3.4 Analyse der Beiträge und Kommentare
- 4.3.5 Gesamtergebnis
- 4.1 Weblogs allgemein
- 5. Wikis im Online-Journalismus
- 5.1 Wikis allgemein
- 5.1.1 Geschichte
- 5.1.2 Wortbildungen
- 5.1.3 Wikis vs. Enzyklopädien
- 5.1.4 Die Hypertext-Struktur
- 5.1.5 Sprachliche Richtlinien bei Wikipedia
- 5.2 Vorteile der Wiki-Integration in Online-Zeitungen
- 5.2.1 Wikis als Wissensspeicher
- 5.2.2 Gemeinschaftlicher Textaufbau
- 5.2.3 Beispiele bereits erfolgreicher Wiki-Intergration
- 5.3 Vergleich zwischen Wikipedia- und Encarta-Artikeln
- 5.3.1 Fachgebiet Kultur
- 5.3.2 Fachgebiet Gesellschaft
- 5.3.3 Fachgebiet Wissenschaft
- 5.3.4 Aktuelles Thema
- 5.3.5 Gesamtergebnis
- 5.1 Wikis allgemein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Potenziale von Weblogs und Wikis für den Online-Journalismus. Sie beleuchtet die Entwicklung und Integration dieser neuen Kommunikationsformen im Kontext der traditionellen Medienlandschaft. Die Arbeit befasst sich mit den spezifischen sprachlichen und gestalterischen Herausforderungen und Chancen, die sich für den Journalismus im digitalen Zeitalter ergeben.
- Die historische Entwicklung des Mediums Zeitung im Vergleich zwischen Print- und Online-Versionen
- Die Integration von Weblogs in Online-Zeitungen und deren spezifische Sprachmerkmale
- Die Eignung von Wikis als Wissensspeicher und die Qualität von online-kooperativ erstellten Inhalten
- Der Vergleich zwischen Wikipedia und Encarta hinsichtlich der sprachlichen Qualität und des journalistischen Wertes
- Die Auswirkungen der neuen Kommunikationsformen auf die traditionelle Medienwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel zeichnet die geschichtliche Entwicklung des Mediums Zeitung nach, beleuchtet die Unterschiede zwischen Print- und Online-Versionen und skizziert wichtige Gestaltungsprinzipien für Online-Zeitungen. Kapitel zwei fokussiert auf die Integration von Weblogs in den Online-Journalismus. Es analysiert die Vorteile und Herausforderungen dieser Integration, insbesondere in Bezug auf Sprache und Kommunikation zwischen Journalist und Leser. Kapitel drei befasst sich mit Wikis und ihrer Eignung für den Online-Journalismus. Es untersucht die Qualität von Wikipedia-Artikeln im Vergleich zu Encarta-Artikeln und diskutiert den Mehrwert von online-kooperativ erstellten Inhalten.
Schlüsselwörter
Online-Journalismus, Weblogs, Wikis, Print- und Online-Zeitungen, Gestaltungsprinzipien, Sprache, Kommunikation, Leser, Journalismus, Wikipedia, Encarta, Qualität, Wissensspeicher.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Web 2.0 für den Online-Journalismus?
Web 2.0 beschreibt eine veränderte Nutzung des Internets, bei der nicht mehr nur Experten Informationen veröffentlichen, sondern alle Nutzer durch Interaktion und Beteiligung integriert werden. Dies ermöglicht neue Formen wie Weblogs und Wikis.
Welche Vorteile bietet die Integration von Blogs in Online-Zeitungen?
Blogs fördern die direkte Kommunikation zwischen Journalisten und Lesern, erhöhen die Meinungsvielfalt und Aktualität und können als wertvolles Instrument zur Recherche dienen.
Sind Weblogs eine Gefahr für den traditionellen Journalismus?
Obwohl Weblogs oft als Konkurrenz gesehen werden, gelten sie primär als Chance. Sie ergänzen den traditionellen Journalismus durch eine andere Art der Berichterstattung und können in etablierte Medienangebote integriert werden.
Wie unterscheiden sich Print- und Online-Zeitungen funktional?
Unterschiede ergeben sich durch technische Bedingungen wie Hypertextualität und Interaktivität sowie durch funktionale Aspekte wie die Lesbarkeit am Bildschirm und den Einsatz von Teasern.
Welchen Nutzen haben Wikis im journalistischen Kontext?
Wikis dienen als gemeinschaftliche Wissensspeicher. Sie ermöglichen einen kooperativen Textaufbau und können Hintergrundwissen zu aktuellen Nachrichtenthemen effizient bündeln.
Wie schneidet Wikipedia im Vergleich zu klassischen Enzyklopädien wie Encarta ab?
Untersuchungen zeigen, dass Wikipedia-Artikel in Fachgebieten wie Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft sowie bei aktuellen Themen oft eine vergleichbare sprachliche Qualität und hohen journalistischen Wert aufweisen.
- Quote paper
- Nicole Streich (Author), 2007, Weblogs und Wikis im Online-Journalismus - zur Sprache und Wirkung der neuen Kommunikationsformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78099