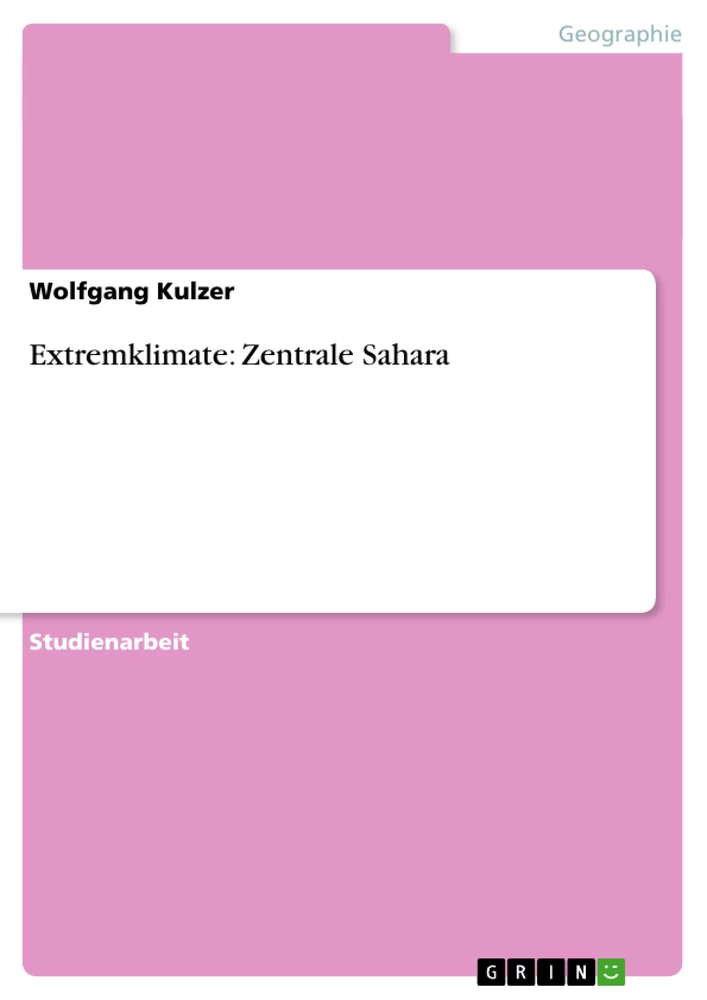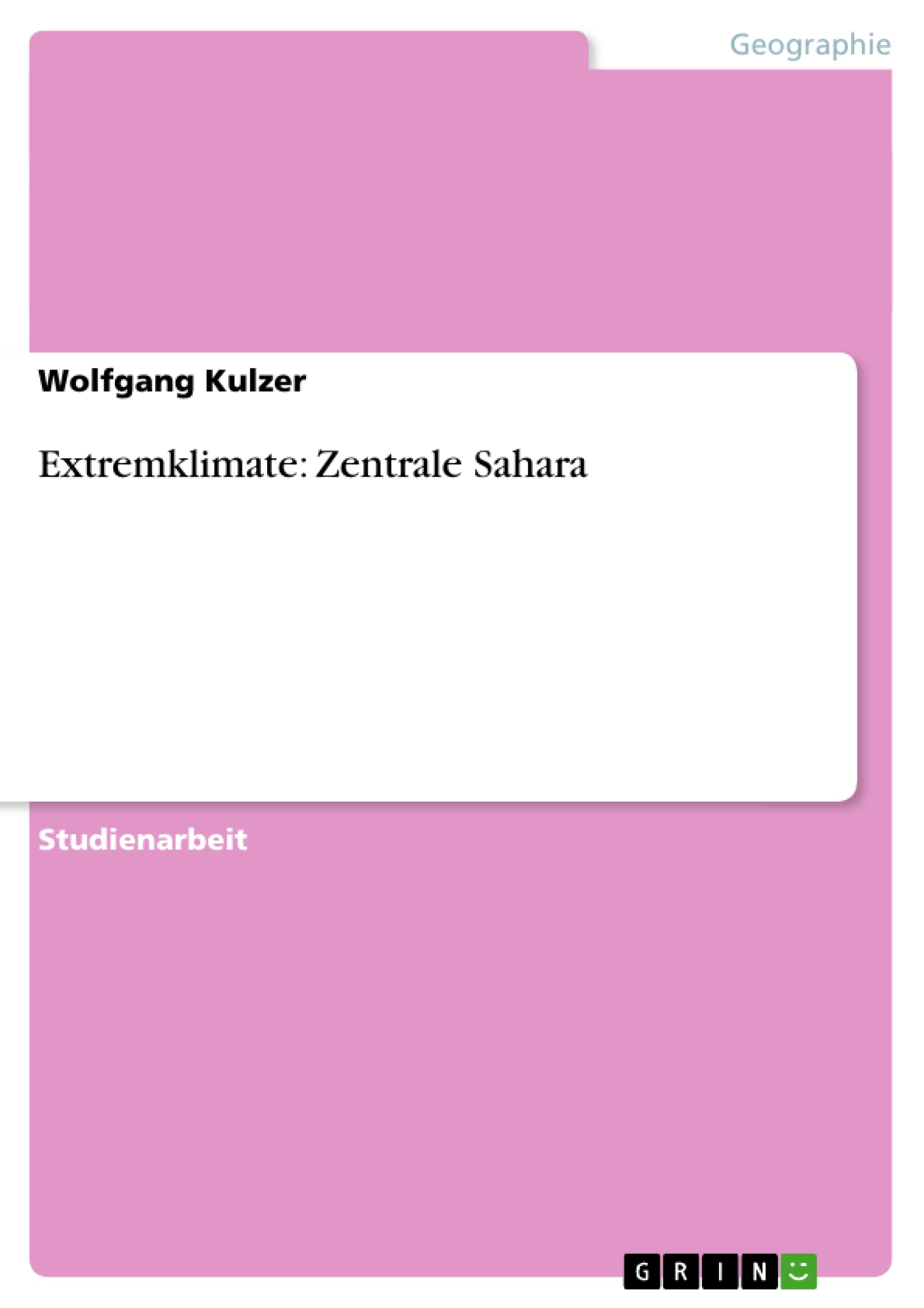Die Sahara ist mit 10-12 Mio. km² die größte Wüste der Erde und besitzt damit durchaus die Dimension eines Kontinents. Unter anderem auf Grund dieser Ausmaße ergaben sich in der Vergangenheit aus der Sicht der Physiogeographie Probleme in Bezug auf gültige Inhalts- und Grenzkriterien der Sahara als Wüste. Verstärkt wird diese Problematik durch die ausgeprägte innere Differenzierung in sehr unterschiedlich ausgestattete regionale Großräume. Ihre Sonderstellung unter den Wüsten der Erde verdankt die Sahara nicht allein ihrer Lage im Bereich des nördlichen Wendekreises in einem der beiden Hochdruck- und Passatwindgürtel der Erde. Verschiedene Komponenten, die zur Sonderstellung der Sahara beitragen, sollen unter anderem in dieser Arbeit dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik „Wüsten und Halbwüsten“ unter Bezugnahme auf den Lehrplan für Gymnasien in Bayern
- 2. Lage und Abgrenzung des Raumes „Zentrale Sahara“
- 3. Das Klima der Sahara
- 3.1 Die Faktoren des Klimas der Sahara
- 3.2 Das thermische Klima der Sahara
- 3.3 Das hygrische Klima der Sahara
- 3.4 Gründe für die verstärkte Aridität
- 3.4.1 Klassische Ursachen
- 3.4.2 Der Ostjet als Ursache für die verstärkte Aridität
- 4. Die Sahara als Kulturraum
- 4.1 Zahl und Verteilung der Bewohner
- 4.2 Die Nomaden
- 4.3 Oasenwirtschaft in der Sahara
- 4.3.1 Die traditionelle Oase
- 4.3.2 Aktuelle Entwicklungen in der Oasenwirtschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zentrale Sahara, ihre klimatischen Bedingungen und ihre Bedeutung als Kulturraum. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima und Mensch in dieser einzigartigen Region zu vermitteln.
- Das Klima der zentralen Sahara und die Faktoren, die zu ihrer Aridität beitragen.
- Die geographische Lage und Abgrenzung der zentralen Sahara.
- Die Anpassungsstrategien der Bevölkerung an die extremen klimatischen Bedingungen.
- Die traditionelle und moderne Oasenwirtschaft.
- Die Rolle des Nomadismus in der Kultur der Sahara.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik „Wüsten und Halbwüsten“ unter Bezugnahme auf den Lehrplan für Gymnasien in Bayern: Der einführende Abschnitt definiert den Begriff „Wüste“ und differenziert zwischen Wärme-, Kälte- und Trockenwüsten. Er betont die Vielfalt der Wüstenlandschaften und ihre überraschende biologische Aktivität. Die Sahara wird als größtes Wüstengebiet der Erde vorgestellt, und es wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, eindeutige Kriterien für ihre Abgrenzung zu definieren. Der Bezug zum bayerischen Lehrplan für Gymnasien wird hergestellt, indem die Relevanz des Themas für verschiedene Jahrgangsstufen aufgezeigt wird, insbesondere im Kontext der Themen "Tropen und Subtropen" und "Kulturerdteile".
2. Lage und Abgrenzung des Raumes „Zentrale Sahara“: Dieses Kapitel befasst sich mit der problematischen Abgrenzung der „Zentralen Sahara“. Es werden verschiedene, historisch verwendete Gliederungsvorschläge von Saharaforschern präsentiert, die die Sahara in Ost- und Westsahara, West-, Mittel- und Ostsahara sowie Nord-, Zentral- und Südsahara unterteilen. Die Arbeit argumentiert für eine räumlich basierte Abgrenzung, die die zentralen Gebiete des Hoggar-Gebirges, des Tassili-n-Adjer und des Fezzan umfasst. Diese Abgrenzung stützt sich auf die Arbeit von Prof. Dr. Detlef Busche.
3. Das Klima der Sahara: Dieses Kapitel analysiert das Klima der Sahara, beginnend mit einer Diskussion der verschiedenen klimatischen Faktoren. Es geht dann auf das thermische und hygrische Klima der Sahara ein, wobei die Gründe für die extreme Aridität im Detail untersucht werden. Dabei werden sowohl klassische Ursachen als auch der Einfluss des Ostjets betrachtet. Die Einbindung von Karten und Diagrammen zur Visualisierung der klimatischen Daten würde die Klarheit und das Verständnis weiter verbessern (obwohl im Ausgangstext nicht vorhanden).
4. Die Sahara als Kulturraum: Dieses Kapitel befasst sich mit der menschlichen Besiedlung der Sahara. Es untersucht die Zahl und Verteilung der Bewohner, die Anpassungsstrategien der nomadischen Bevölkerung an die extremen Bedingungen und die Bedeutung der Oasenwirtschaft. Es wird zwischen traditioneller und moderner Oasenwirtschaft unterschieden, und es wird vermutlich auf die Herausforderungen und Veränderungen eingegangen, denen die Oasenwirtschaft heute gegenübersteht. Eine detaillierte Analyse der sozioökonomischen Strukturen und kulturellen Besonderheiten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen würde die Tiefe dieses Kapitels erhöhen.
Schlüsselwörter
Sahara, Wüste, Aridität, Klima, Ostjet, Nomadismus, Oasenwirtschaft, Kulturraum, Geographie, Lehrplan Bayern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wüsten und Halbwüsten - Die Zentrale Sahara
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Zentralen Sahara, ihren klimatischen Bedingungen und ihrer Bedeutung als Kulturraum. Sie untersucht die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima und Mensch in dieser Region.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die geographische Lage und Abgrenzung der Zentralen Sahara, das Klima der Sahara (einschließlich der Faktoren, die zu ihrer Aridität beitragen, sowie des thermischen und hygrischen Klimas), die Anpassungsstrategien der Bevölkerung an die extremen klimatischen Bedingungen, die traditionelle und moderne Oasenwirtschaft und die Rolle des Nomadismus in der Kultur der Sahara. Sie bezieht sich dabei auch auf den bayerischen Lehrplan für Gymnasien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik „Wüsten und Halbwüsten“ unter Bezugnahme auf den bayerischen Lehrplan. Kapitel 2 behandelt die Lage und Abgrenzung der Zentralen Sahara. Kapitel 3 analysiert das Klima der Sahara. Kapitel 4 befasst sich mit der Sahara als Kulturraum, einschließlich der Bevölkerung, des Nomadismus und der Oasenwirtschaft.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie präsentiert verschiedene, historisch verwendete Gliederungsvorschläge der Sahara und argumentiert für eine räumlich basierte Abgrenzung. Die Analyse des Klimas beinhaltet die Betrachtung klassischer Ursachen und des Einflusses des Ostjets. Die Betrachtung der Sahara als Kulturraum umfasst die Analyse der Bevölkerung, des Nomadismus und der Oasenwirtschaft, sowohl traditionell als auch modern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sahara, Wüste, Aridität, Klima, Ostjet, Nomadismus, Oasenwirtschaft, Kulturraum, Geographie, Lehrplan Bayern.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima und Mensch in der Zentralen Sahara zu vermitteln.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Schüler und Studenten, die sich mit Geographie, Klimatologie und Kulturgeographie befassen, insbesondere im Kontext des bayerischen Lehrplans für Gymnasien. Sie ist auch für alle Interessierten an der Sahara und ihren besonderen Herausforderungen geeignet.
Wie wird die Abgrenzung der Zentralen Sahara definiert?
Die Arbeit argumentiert für eine räumlich basierte Abgrenzung der Zentralen Sahara, die die zentralen Gebiete des Hoggar-Gebirges, des Tassili-n-Adjer und des Fezzan umfasst, basierend auf der Arbeit von Prof. Dr. Detlef Busche. Es werden aber auch andere historische Abgrenzungsversuche vorgestellt.
Welche Rolle spielt der Ostjet in der Arbeit?
Der Ostjet wird als einer der Faktoren betrachtet, die zur verstärkten Aridität der Sahara beitragen.
Wie wird die Oasenwirtschaft in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen traditioneller und moderner Oasenwirtschaft und geht vermutlich auf die Herausforderungen und Veränderungen ein, denen die Oasenwirtschaft heute gegenübersteht.
- Citar trabajo
- Wolfgang Kulzer (Autor), 2003, Extremklimate: Zentrale Sahara, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78124