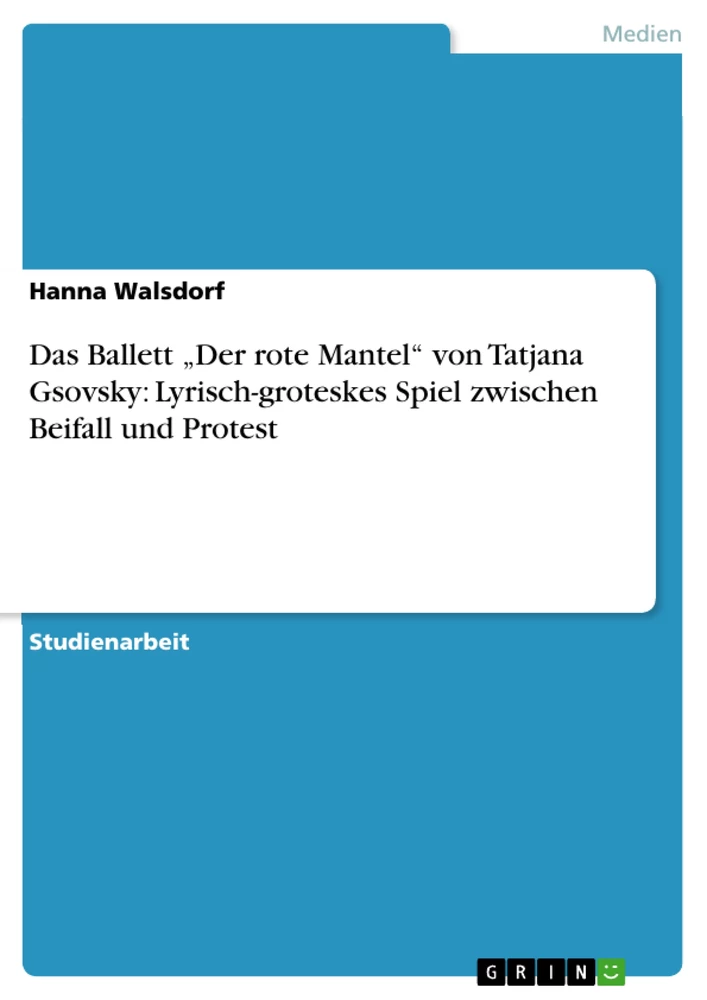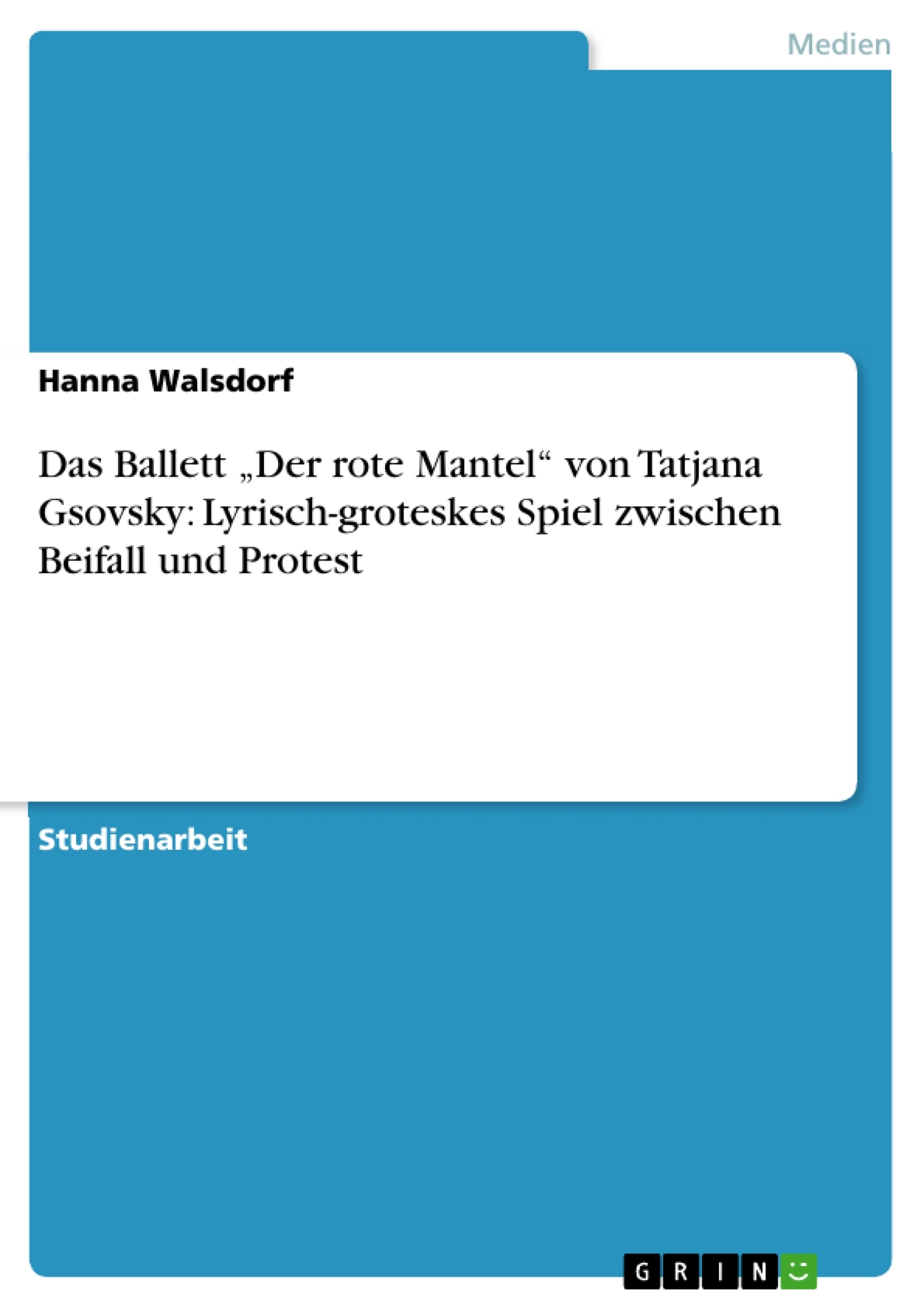Der erste Teil der Arbeit wendet sich Lorcas „In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa“ (1933): Ausgehend von einer kurzen Darstellung der Entstehung des Kammerspiels, wird zunächst knapp seine inhaltliche Konzeption im allgemeinen umrissen und werden dann die existentiellen Konflikte der Figuren im speziellen freigelegt. Im Anschluss daran nimmt die Autorin – als gewichtigerem zweiten Teil – das Ballett „Der rote Mantel“ (1954) von Tatjana Gsovsky in den Blickpunkt, welches sich des „Don Perlimplín“ als Vorlage bedient. Beachtung findet dabei vor allem die inhaltliche Reduktion des Stoffes und die daraus resultierende Deutungsvariation; genauer werdenChoreographie und Ausstattung vorgestellt und ein weiteres Augenmerk auf die Ballettmusik Luigi Nonos gerichtet.
Die Arbeit legt zum einen dar, wie Lorca in seinem „Don Perlimplín“ das Verhältnis zur Realität stört und diesen Zustand schließlich wieder auflöst und zeigt zum anderen auf, inwieweit und wodurch Gsovsky und Nono im „roten Mantel“ eine Umdeutung dessen vollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu Lorcas „In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa“ (1933)
- Entstehung und inhaltliche Konzeption des Kammerspiels
- Existentielle Konflikte und deren Darstellung im Überblick
- Zum Ballett „Der rote Mantel“ (1954) von Tatjana Gsovsky
- Die inhaltliche Reduktion und Deutungsvariation des Stoffes
- Choreographie und Ausstattung
- Nonos Ballettmusik
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Realität und Kunst am Beispiel des Stückes „In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa“ von Federico García Lorca und dem Ballett „Der rote Mantel“ von Tatjana Gsovsky, das auf Lorcas Werk basiert. Ziel ist es, Lorcas künstlerische Strategie zu analysieren, die Realität zu stören und schließlich wieder aufzulösen. Weiterhin wird untersucht, wie Gsovsky und Luigi Nono mit „Der rote Mantel“ eine Umdeutung von Lorcas Werk vollziehen.
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema der Realität und ihrer Störung in der Kunst
- Die Analyse der existentiellen Konflikte in Lorcas „Don Perlimplín“
- Die Darstellung der inhaltlichen Reduktion und Deutungsvariation von Lorcas Werk im Ballett „Der rote Mantel“
- Die Analyse der Choreographie, Ausstattung und Musik des Balletts
- Die Untersuchung der künstlerischen Umdeutung von Lorcas Werk durch Gsovsky und Nono
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Lorcas Maxime, psychologische Momente in seine Kunst zu integrieren, und stellt die Struktur der Arbeit vor. Kapitel 1 behandelt Lorcas „In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa“ mit seiner Entstehung und inhaltlichen Konzeption sowie den existentiellen Konflikten der Figuren. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Ballett „Der rote Mantel“ von Tatjana Gsovsky, beleuchtet die inhaltliche Reduktion des Stoffes und die daraus resultierende Deutungsvariation, sowie die Choreographie, Ausstattung und Musik des Balletts.
Schlüsselwörter
Federico García Lorca, Don Perlimplín, Tatjana Gsovsky, Der rote Mantel, Ballett, Kammerspiel, Realität, Kunst, Störung, Umdeutung, Choreographie, Ausstattung, Luigi Nono
Häufig gestellte Fragen
Worauf basiert das Ballett "Der rote Mantel"?
Es basiert auf dem Kammerspiel "In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa" von Federico García Lorca aus dem Jahr 1933.
Wer war für die Choreographie von "Der rote Mantel" verantwortlich?
Die Choreographie stammt von Tatjana Gsovsky, einer bedeutenden Persönlichkeit des deutschen Nachkriegsballetts.
Welche Rolle spielt die Musik von Luigi Nono?
Nono schuf eine moderne Ballettmusik, die die existentielle Dramatik und die Umdeutung von Lorcas Stoff musikalisch unterstützt.
Wie verändert das Ballett Lorcas Originalvorlage?
Das Ballett nimmt eine inhaltliche Reduktion vor und vollzieht eine Deutungsvariation, die das Verhältnis zwischen Realität und Kunst neu gewichtet.
Was sind die zentralen Themen in Lorcas "Don Perlimplín"?
Zentrale Themen sind existentielle Konflikte, die Störung der Realität und die tragische Suche nach Liebe und Identität.
- Citation du texte
- Mag. Hanna Walsdorf (Auteur), 2003, Das Ballett „Der rote Mantel“ von Tatjana Gsovsky: Lyrisch-groteskes Spiel zwischen Beifall und Protest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78128