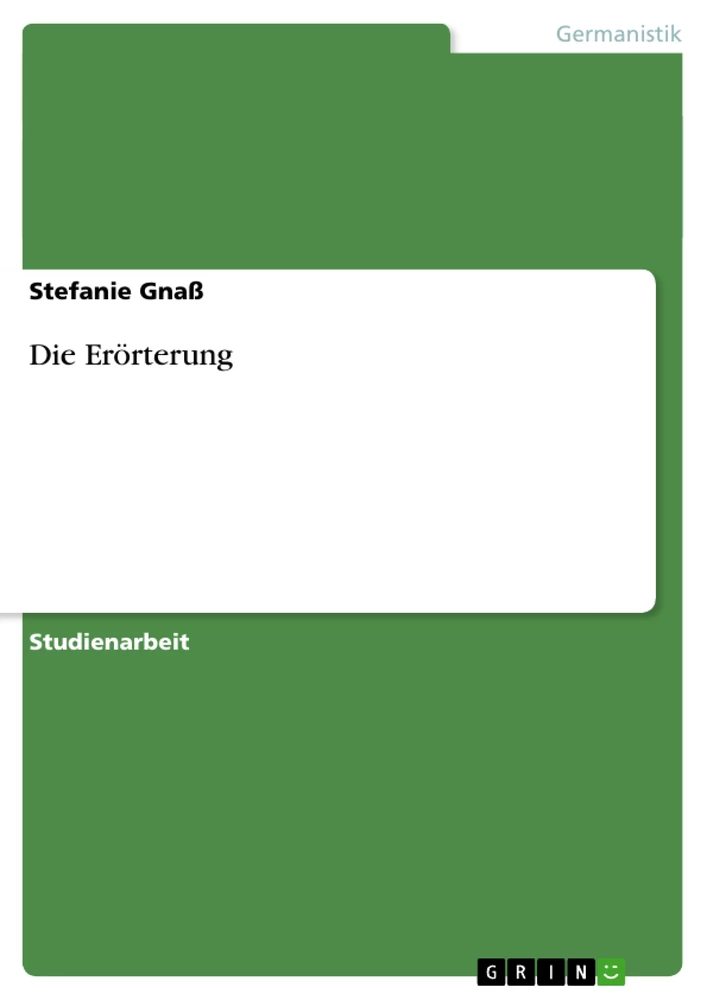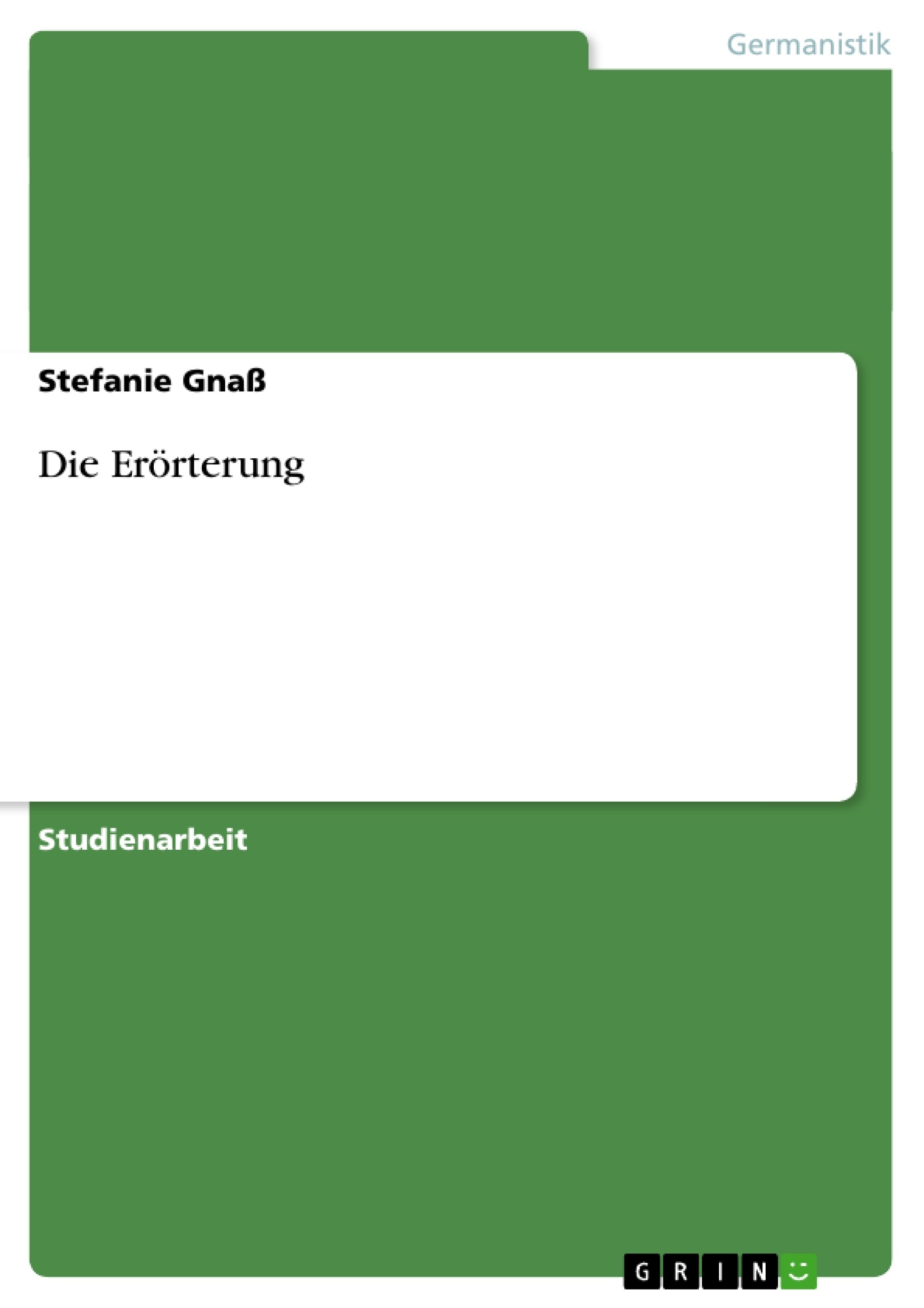Welcher Schüler kennt es nicht: Das Schreiben von Erörterungen im Deutschunterricht? Diese Textsorte ist seit Jahrzehnten in den Lehrplänen fest verankert und wird meist ab der achten, spätestens aber ab der neunten Jahrgangsstufe, zum festen Bestandteil eines jeden Deutschunterrichtes.
Der Sinn des Erörterns und Argumentierens liegt auf der Hand. Durch das intensive Auseinandersetzen mit einem Thema oder Sachverhalt wird die Identität des Schreibers weiter ausgebildet, da er sich über seine Einstellung zu dem gegebenen Thema Gedanken machen muss und seine Meinung zu diesem Thema vor anderen vertreten muss. Die Schüler werden so auf das Berufsleben oder den eventuellen Besuch einer Hochschule vorbereitet. Oder anders ausgedrückt: Die Schüler sollen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern ausgebildet werden.
Des Weiteren dient das schriftliche Auseinandersetzen der Sprachbildung der Schüler. Gleichzeitig wird durch das Argumentieren die soziale Einsicht, und das Niveau sprachlicher Rationalität der Schülerinnen und Schüler gesteigert.
Im Folgenden werden zunächst die traditionellen Formen der Erörterung vorgestellt und deren Verankerung im Lehrplan der bayrischen Realschule erläutert. Im Anschluss daran wird gezeigt, in wie weit die traditionelle Erörterung in der heutigen Aufsatzdidaktik kritisiert wird und welche Änderungen aufgrund dessen gefordert werden. Zum Schluss dieser Arbeit wird darüber hinaus eine kurze Unterrichtsreihe zum Erörtern vorgestellt, die die neuen didaktischen Ansätze berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die klassische Erörterung
- Die Erörterung im Lehrplan der bayrischen Realschule
- Formen der Erörterung
- Steigernde Erörterung
- Die dialektische Erörterung
- Neuere didaktische Ansätze und deren Konsequenzen
- Änderungen in der Praxis
- Änderungen im Lehrplan
- Planung einer Unterrichtsreihe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die traditionelle Erörterung im Deutschunterricht, ihre Verankerung im Lehrplan der bayrischen Realschule und die Kritik an ihr in der modernen Aufsatzdidaktik. Ziel ist es, die Entwicklung der Erörterung als Textsorte aufzuzeigen und neue didaktische Ansätze vorzustellen.
- Die klassische Erörterung und ihre historischen Wurzeln
- Die Rolle der Erörterung im Lehrplan der bayrischen Realschule
- Kritik an der traditionellen Erörterung und neue didaktische Ansätze
- Entwicklung der Erörterung im Laufe der Zeit
- Planung einer modernen Unterrichtsreihe zur Erörterung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Erörterung im Deutschunterricht ein und hebt deren Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung und die sprachliche Bildung der Schüler hervor. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Betrachtung traditioneller und neuerer didaktischer Ansätze an. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit, Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen und betont die Rolle der schriftlichen Auseinandersetzung mit Themen für die Sprachbildung und die Steigerung der sprachlichen Rationalität. Sie stellt die Arbeit als eine Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung und der didaktischen Relevanz der Erörterung dar.
Die klassische Erörterung: Dieses Kapitel definiert die klassische Erörterung als das Darlegen, Begründen und Beurteilen von Sachverhalten und Problemen. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Erörterung, beginnend bei den Griechen und Römern, und verfolgt ihren Weg durch verschiedene Phasen des Deutschunterrichts. Es beschreibt den Wandel vom "Besinnungsaufsatz" mit Fokus auf Wertfragen hin zur Erörterung von Sachfragen und die zunehmende Berücksichtigung des Schülerkontexts. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von der eher normativen, wertorientierten Form hin zu einer stärker sachorientierten und problemorientierten Herangehensweise. Die Bedeutung der objektiven Betrachtung und des schriftlichen Problemlösens wird herausgestellt.
Die Erörterung im Lehrplan der bayrischen Realschule: Dieses Kapitel beschreibt den Platz der Erörterung im Lehrplan der bayrischen Realschule. Es zeigt die schrittweise Einführung der schriftlichen Erörterung, beginnend mit einfachen argumentativen Schreibformen in der siebten Jahrgangsstufe und ihrer Ausweitung auf komplexere Sachverhalte in den höheren Jahrgangsstufen. Der Lehrplan wird detailliert analysiert, um die Entwicklung argumentativer und appellativer Schreibkompetenzen der Schüler aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt auf der schrittweisen Steigerung der Anforderungen an die Schüler und der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zur selbstständigen Auseinandersetzung mit komplexeren Themen.
Schlüsselwörter
Erörterung, Aufsatzdidaktik, Lehrplan, bayrische Realschule, Argumentation, sprachliche Bildung, mündige Bürger, didaktische Ansätze, historische Entwicklung, Sachfragen, Wertfragen, schriftliches Problemlösen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Entwicklung der Erörterung im Deutschunterricht der bayrischen Realschule"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die Entwicklung der Erörterung als Textsorte im Deutschunterricht der bayrischen Realschule. Es untersucht die klassische Erörterung, ihre Verankerung im Lehrplan und die Kritik daran in der modernen Aufsatzdidaktik. Ziel ist es, die historische Entwicklung aufzuzeigen und neue didaktische Ansätze vorzustellen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die klassische Erörterung (inklusive ihrer historischen Wurzeln und verschiedenen Formen wie der steigernden und dialektischen Erörterung), ihre Rolle im Lehrplan der bayrischen Realschule, Kritik an der traditionellen Erörterung und neue didaktische Ansätze, die Entwicklung der Erörterung im Laufe der Zeit und die Planung einer modernen Unterrichtsreihe zur Erörterung.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, die eine Einleitung, die klassische Erörterung, die Erörterung im Lehrplan der bayrischen Realschule, neuere didaktische Ansätze und deren Konsequenzen, die Planung einer Unterrichtsreihe und ein Fazit umfassen. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Entwicklung der Erörterung als Textsorte aufzuzeigen und neue didaktische Ansätze vorzustellen. Es untersucht die traditionelle Erörterung, ihre Verankerung im Lehrplan und die Kritik daran, um ein umfassendes Bild der aktuellen Situation im Deutschunterricht zu geben.
Welche Kritikpunkte an der traditionellen Erörterung werden angesprochen?
Das Dokument geht zwar nicht explizit auf konkrete Kritikpunkte ein, impliziert aber durch die Hervorhebung "neuerer didaktischer Ansätze" und die Diskussion der Entwicklung der Erörterung über die Zeit, dass die klassische Erörterung möglicherweise als zu normativ, wertorientiert und wenig problemorientiert angesehen wird. Die genauen Kritikpunkte werden nicht im Detail ausgearbeitet.
Welche neuen didaktischen Ansätze werden vorgestellt?
Die konkreten neuen didaktischen Ansätze werden nicht detailliert beschrieben. Das Dokument erwähnt sie lediglich als Gegenstück zur traditionellen Erörterung und als Fokus der Untersuchung.
Wie wird der Lehrplan der bayrischen Realschule behandelt?
Das Dokument analysiert den Lehrplan der bayrischen Realschule im Hinblick auf die Erörterung. Es beschreibt die schrittweise Einführung der schriftlichen Erörterung in den verschiedenen Jahrgangsstufen und die damit verbundene Steigerung der Anforderungen an die Schüler.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Erörterung, Aufsatzdidaktik, Lehrplan, bayrische Realschule, Argumentation, sprachliche Bildung, mündige Bürger, didaktische Ansätze, historische Entwicklung, Sachfragen, Wertfragen, schriftliches Problemlösen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Deutschlehrer an bayrischen Realschulen, Lehramtsstudenten, Didaktiker und alle, die sich für die Entwicklung der Erörterung im Deutschunterricht interessieren.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Gnaß (Autor:in), 2006, Die Erörterung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78136