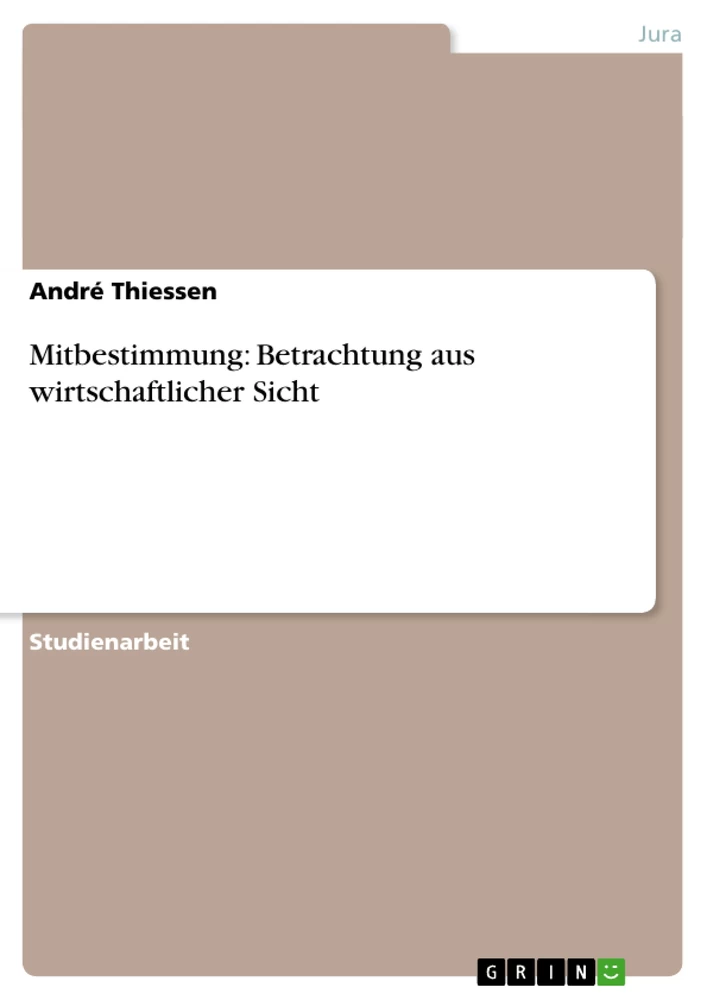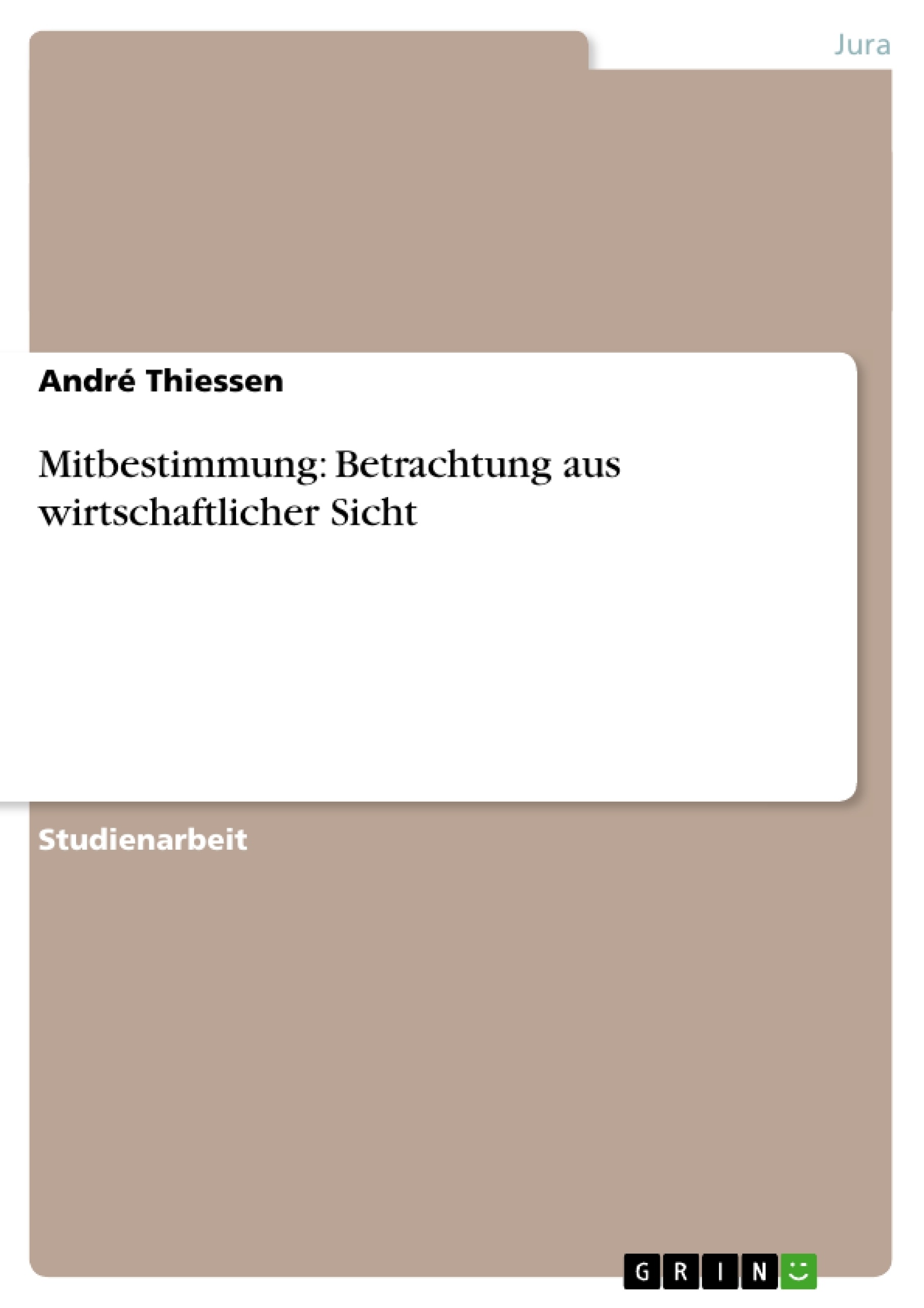Das Thema dieser Arbeit „Mitbestimmung: Betrachtung aus wirtschaftlicher Sicht“ soll sich im Folgenden mit den speziellen Gegebenheiten der Mitbestimmung in Unternehmen befassen.
Die insbesondere nach der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 2001 zunehmende Kritik der Arbeitgeberverbände und auch vereinzelter ausländischer Investoren, macht es erforderlich, die Mitbestimmung nicht nur ideologisch sondern auch einer wirtschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Neben der ökonomischen Betrachtung darf aber eine sozialpoliti-sche und ethische Betrachtung nicht ausbleiben.
„Mitbestimmung entfaltet für die soziale Integration und die demokratische Teilhabe der Arbeitnehmer einen großen gesellschaftlichen Nutzen, der bei ihrer Abschaffung zu nicht unerhebliche soziale Folgekosten führen könnte.“
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1) Problemstellung
- 2) Zielsetzung und Vorgehensweise
- 3) Begriffsdefinitionen
- II Monetäre Betrachtung der Mitbestimmung
- 1) Kosten der Mitbestimmung
- III Property-Rights Theorie versus Partizipationstheorie
- 1) Property-Rights Theorie
- 2) Partizipationstheorie
- IV Chancen und Risiken der Mitbestimmung für die Wirtschaft
- 1) Produktivität und Innovation
- 2) Flexibilität und Bürokratie
- 3) Europäischer Standortwettbewerb
- V Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit "Mitbestimmung: Betrachtung aus wirtschaftlicher Sicht" untersucht die Mitbestimmung in Unternehmen aus ökonomischer Perspektive. Sie befasst sich mit den Kosten und Effizienzgewinnen der Mitbestimmung, analysiert zwei zentrale Theorien der Mitbestimmung und beleuchtet Chancen und Risiken für die Wirtschaft.
- Ökonomische Bewertung der Mitbestimmung
- Kosten und Effizienzgewinne der Mitbestimmung
- Vergleich der Property-Rights Theorie und der Partizipationstheorie
- Chancen und Risiken der Mitbestimmung für die Wirtschaft
- Juristische und wirtschaftliche Lösungsvorschläge
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung
Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Mitbestimmung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und stellt die Problemstellung der Arbeit dar. Es werden die Kritik an der Mitbestimmung seitens der Arbeitgeberverbände und die Notwendigkeit einer ökonomischen Analyse der Mitbestimmung neben der sozialen und ethischen Betrachtung hervorgehoben.
II Monetäre Betrachtung der Mitbestimmung
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der monetären Bewertung der Mitbestimmung, einschließlich der Kosten und Effizienzgewinne. Die direkten Kosten der Mitbestimmung, wie z.B. Personal- und Sachkosten, werden diskutiert, und es wird ein Versuch unternommen, diese Kosten anhand empirischer Daten zu beziffern.
III Property-Rights Theorie versus Partizipationstheorie
Das Kapitel stellt zwei bedeutende Theorien der Mitbestimmung vor: die Property-Rights Theorie und die Partizipationstheorie. Die jeweiligen Ansätze werden erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht.
IV Chancen und Risiken der Mitbestimmung für die Wirtschaft
Die Chancen und Risiken der Mitbestimmung für die Wirtschaft werden in diesem Kapitel behandelt. Es werden Themen wie Produktivität und Innovation, Flexibilität und Bürokratie sowie der europäische Standortwettbewerb beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Mitbestimmung, insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht. Zentrale Themen sind die Kosten und Effizienzgewinne der Mitbestimmung, die Property-Rights Theorie, die Partizipationstheorie, Produktivität, Innovation, Flexibilität, Bürokratie und der europäische Standortwettbewerb. Weitere wichtige Begriffe sind Betriebsverfassungsgesetz, Transaktionskosten, Coase-Theorem und Arbeitnehmerbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen
Ist Mitbestimmung ökonomisch sinnvoll?
Die Arbeit untersucht Mitbestimmung nicht nur ideologisch, sondern prüft sie auf Kosten und Effizienzgewinne. Sie kommt zu dem Schluss, dass Mitbestimmung einen großen gesellschaftlichen Nutzen für die soziale Integration hat.
Was ist der Unterschied zwischen Property-Rights- und Partizipationstheorie?
Die Property-Rights-Theorie konzentriert sich auf Verfügungsrechte und Effizienz, während die Partizipationstheorie den Nutzen der demokratischen Teilhabe der Arbeitnehmer betont.
Welche Kosten verursacht Mitbestimmung in Unternehmen?
Zu den monetären Kosten zählen direkte Personal- und Sachkosten für Betriebsräte sowie Transaktionskosten, die durch Abstimmungsprozesse entstehen.
Fördert Mitbestimmung die Innovation?
Die Arbeit analysiert Chancen wie gesteigerte Produktivität und Innovation durch die Einbindung des Wissens der Arbeitnehmer, stellt aber auch Risiken wie Bürokratie gegenüber.
Wie beeinflusst Mitbestimmung den europäischen Standortwettbewerb?
Dies ist ein kritischer Punkt: Während Arbeitgeberverbände Wettbewerbsnachteile befürchten, wird Mitbestimmung auch als Faktor für soziale Stabilität und damit als Standortvorteil gesehen.
- Citar trabajo
- André Thiessen (Autor), 2007, Mitbestimmung: Betrachtung aus wirtschaftlicher Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78249