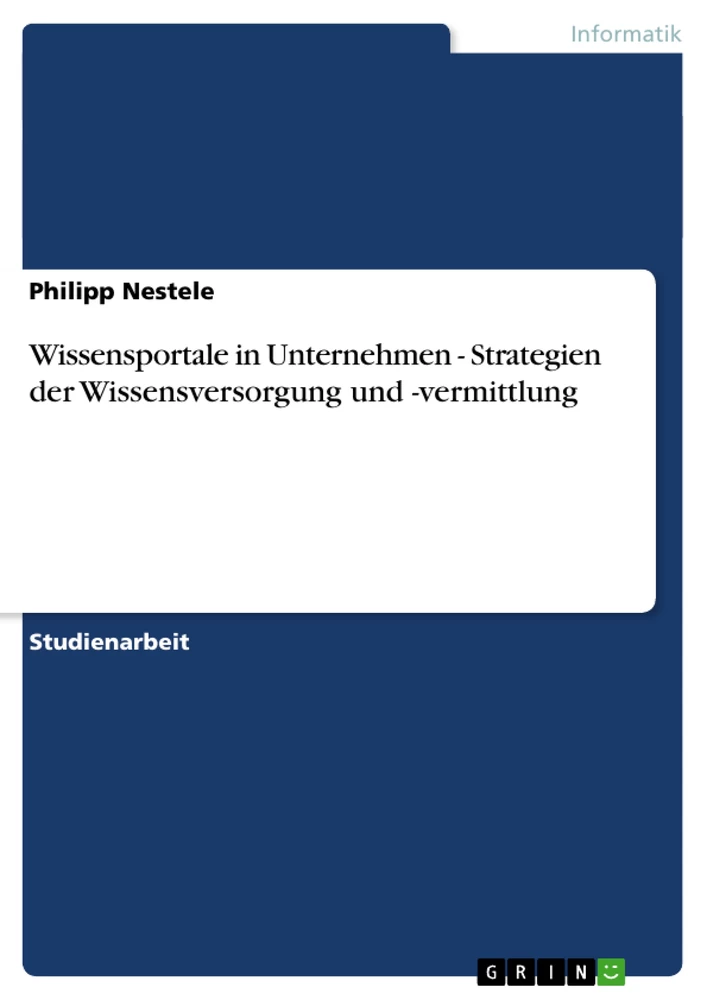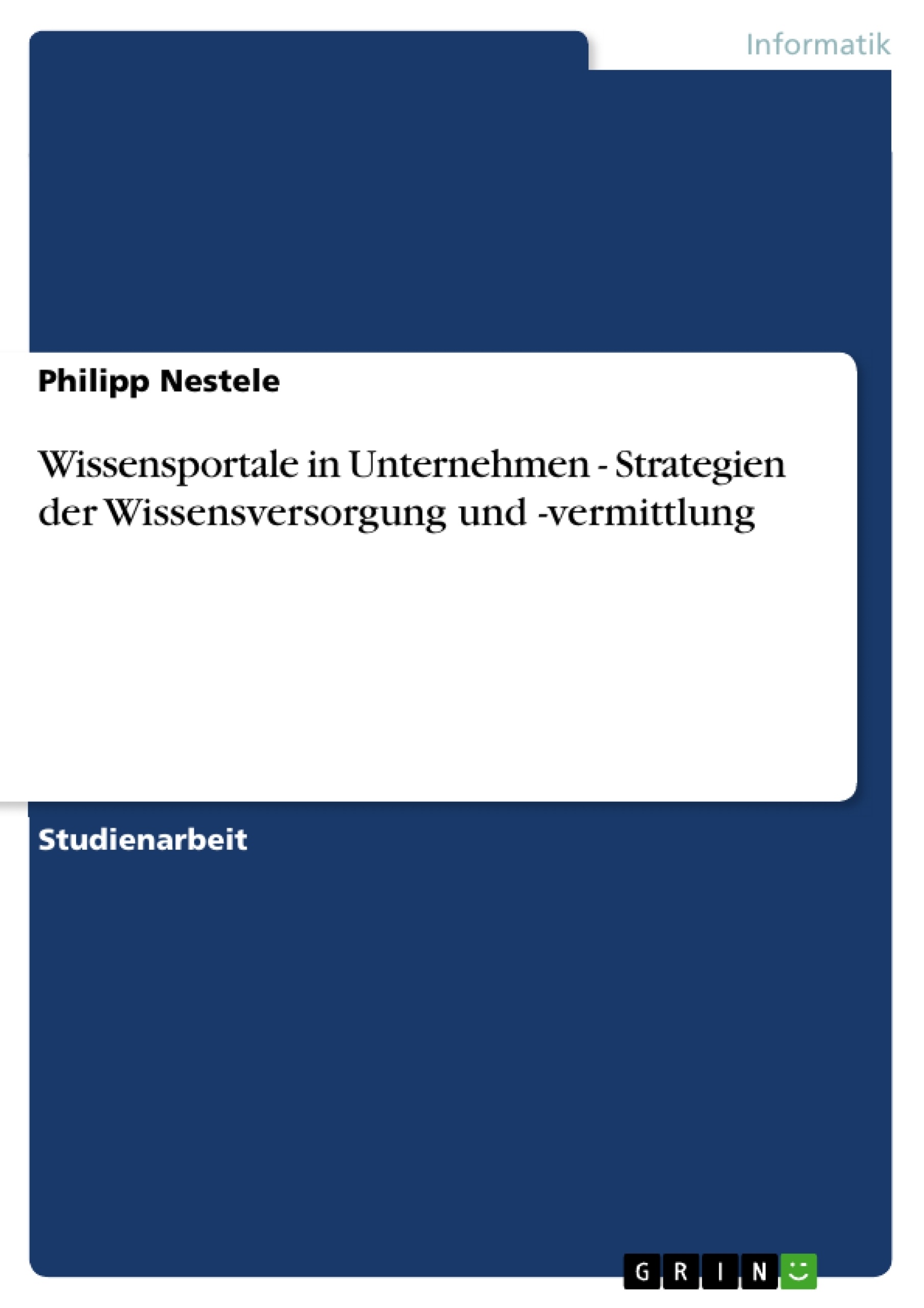„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“ (Johann Wolfgang von Goethe) Heute nimmt das Wissen der Menschheit immer schneller zu. Auch Unternehmen haben mit der Wissensexplosion im eigenen Hause zu kämpfen. Wissensmanagement wird daher zur notwenigen Herausforderung für alle Unternehmen. Denn Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt und nicht aufgebraucht wird. Wissen gilt als Wettbewerbsfaktor, welchen es gezielt einzusetzen gilt. Wissen ist notwendige Voraussetzung für erhöhte Innovationsgeschwindigkeit. Der Wissensvorsprung bedeutet somit bessere Wettbewerbschancen. Dabei ergeben sich durch neue IT-Entwicklungen neue Möglichkeiten der Informationserschließung. Dies führt zu zusätzlichen Herausforderungen und neuen Potenzialen. Das sind die zunehmende Vernetzung und die Entwicklung von Softwarelösungen zur Wissensverteilung.
Die Arbeit beschäftigt sich mit diesen neuen Strategien der Wissensverteilung in Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Wissensportale
- Wissensmärkte
- Gelbe Seiten
- Bausteine des Wissensmanagements
- Strategien der Wissensversorgung und Wissensvermittlung
- Wissensportale in Unternehmen
- Chancen und Risiken
- Fallbeispiele
- Werkzeuge der Wissensversorgung und Wissensvermittlung
- Softwarelösungen
- Software in der Unternehmenspraxis
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Strategien der Wissensversorgung und -vermittlung in Unternehmen, insbesondere im Kontext von Wissensportalen. Sie analysiert die Funktionsweise und den Aufbau von Wissensportalen sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken. Zudem werden wichtige Werkzeuge der Wissensversorgung und -vermittlung vorgestellt und zwei Fallbeispiele analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bedeutung von Wissen als Wettbewerbsfaktor und der Nutzung neuer IT-Entwicklungen zur effizienten Wissensverteilung.
- Wissensportale als zentrale Plattform für den Wissensaustausch in Unternehmen
- Chancen und Herausforderungen der Wissensversorgung und -vermittlung
- Die Rolle von IT-Lösungen im Wissensmanagement
- Akzeptanz und Nutzung von Wissensportalen in der Praxis
- Zukünftige Trends und Entwicklungen im Bereich des Wissensmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von Wissen als Wettbewerbsfaktor und die Herausforderungen des Wissensmanagements in Unternehmen beleuchtet. Kapitel 2 legt die begrifflichen Grundlagen für die Analyse von Wissensportalen, Wissensmärkten und den Bausteinen des Wissensmanagements. In Kapitel 3 werden Strategien der Wissensversorgung und -vermittlung in Unternehmen vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Chancen und Risiken von Wissensportalen liegt. Kapitel 4 widmet sich den Werkzeugen der Wissensversorgung und -vermittlung und untersucht Softwarelösungen sowie deren Anwendung in der Praxis. Abschließend gibt Kapitel 5 einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von Wissensportalen und mögliche Zukunftsszenarien.
Schlüsselwörter
Wissensportale, Wissensmanagement, Wissensversorgung, Wissensvermittlung, IT-Lösungen, Unternehmen, Chancen, Risiken, Akzeptanz, Softwarelösungen, Fallbeispiele, Zukunftsszenarien
- Quote paper
- Philipp Nestele (Author), 2001, Wissensportale in Unternehmen - Strategien der Wissensversorgung und -vermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7830