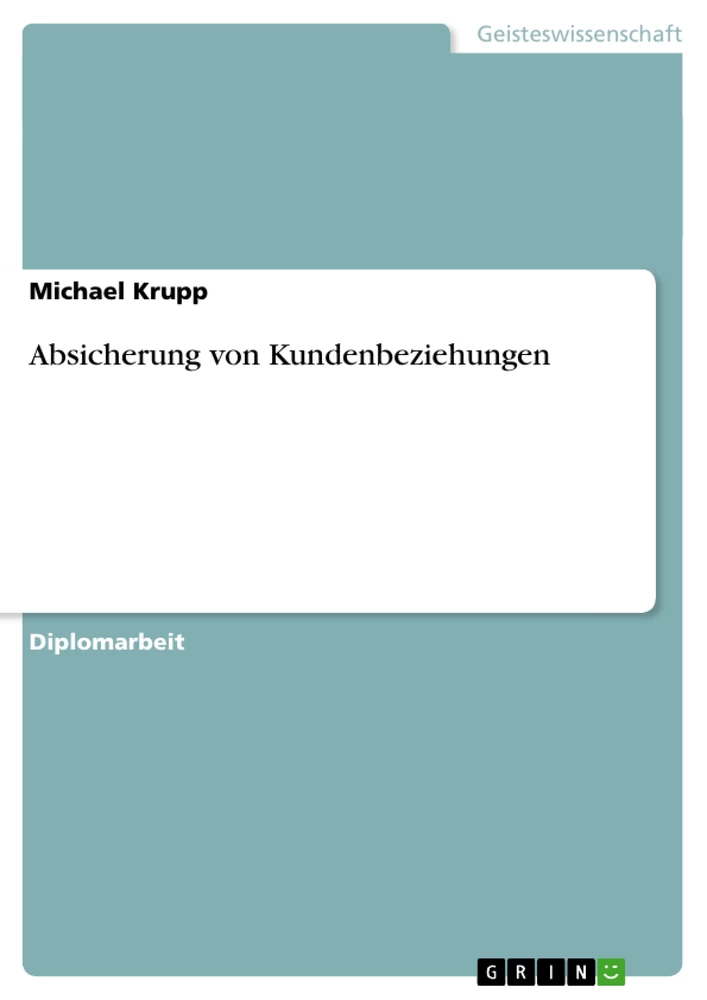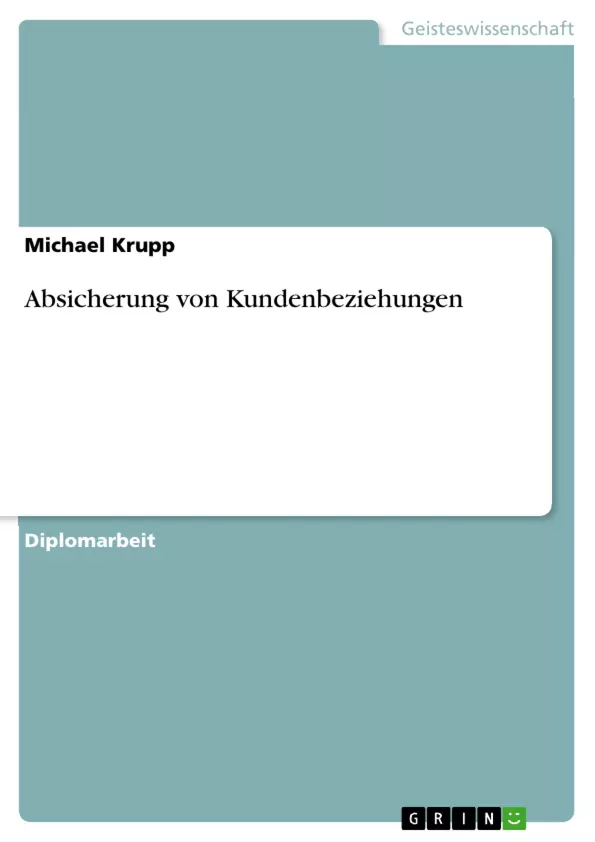Wie sichern sich Unternehmen, im Speziellen Softwareentwickler, durch vertragliche Mittel, vor allem aber durch alternative Absicherungsmechanismen, wie Ausnutzung ihrer Marktmacht und Einbindung in soziale Netzwerke, gegen opportunistisches Verhalten ihrer Kunden ab?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der vorliegende Diplomarbeit die 2001 am Lehrstuhl für Soziologie und Empirische Sozialforschung der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg entstanden ist.
Zur Beantwortung der Frage werden zunächst Grundlagen sozialer Beziehungen und sozialen Handelns theoretisch berachtet, um Kundenbeziehungen als soziale Beziehungen zu erklären. Erkenntnisse daraus, die die genannten Absicherungsmechanismen betreffen, werden über die chronologischen Phasen einer Kundenbeziehung betrachtet und auf jeweils auftretende Handlungen und Probleme angewandt. Aus den daraus hervorgehenden theoretischen Zusammenhängen werden Hypothesen abgeleitet. Für eine empirische Prüfung dieser Hypothesen werden qualitative und quantitative Ergebnisse einer Interview- Erhebung und einer Online- Erhebung ausgewertet. Diese betraf deutsche Softareentwickler, die Unternehmenssoftware anbieten. Eine Zusammenfassung der daraus hervorgehenden Erkenntnisse und ein Ausblick auf weitere Möglichkeiten im betrachteten Forschungsfeld bilden den Schluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Notwendigkeit von Absicherung bei steigender Arbeitsteilung
- 2. Theoretischer Teil: Theoretische Betrachtung einer Kundenbeziehung als soziale Beziehung
- 2.1. Grundlegende Betrachtung von Komponenten sozialer Beziehungen
- 2.1.1. Idealtypen sozialen Handelns nach Weber
- 2.1.2. Austauschtheorie nach Blau
- 2.1.3. Rational Choice Theorie und Spieltheorie
- 2.1.4. Der Vertrauensbegriff
- 2.1.5. Tauschmedien nach Talcott Parsons
- 2.1.6. Anwendbarkeit auf die Fragestellung
- 2.2. Absicherung von Kundenbeziehungen
- 2.2.1. Die Opportunismusproblematik
- 2.2.2. Institutionelle Mechanismen und deren Unzulänglichkeiten
- 2.2.2.1. Verträge und Transaktionskosten
- 2.2.2.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Transaktionskosten
- 2.2.2.3. Durchsetzbarkeit von Verträgen und AGB
- 2.2.2.4. Eigentumscharakter von vertraglichen Forderungen
- 2.2.3. Marktmechanismen und Marktmacht
- 2.2.3.1. Allgemeine und relative Marktmacht
- 2.2.3.2. Marktmacht im Spannungsfeld mit anderen Marktteilnehmern
- 2.2.3.3. Kurzfristige Machtpositionen durch Konjunkturschwankungen
- 2.2.3.4. Machtpositionen durch Budgetpotential
- 2.2.4. Soziale Einbettung
- 2.2.4.1. Zeitliche Einbettung in soziale Beziehungen
- 2.2.4.2. Einbettung in Beziehungsnetze
- 2.2.4.3. Potenzierung zeitlicher Einbettung durch Beziehungsnetze
- 2.2.4.4. Sozialkapital - Zusammenfassung sozialer Einbettung
- 2.2.5. Zusammenspiel der Absicherungsmechanismen
- 2.3. Absicherungsmechanismen im Verlauf einer Geschäftstransaktion
- 2.3.1. Absicherung in der Anbahnungsphase
- 2.3.1.1. Kundensuche - ein bilateraler Informationsprozess
- 2.3.1.2. Auswahl der Partner - Entscheidungsprozess der Anbahnung
- 2.3.1.3. Praxisbeispiel zur Kundensuche und Selektion
- 2.3.2. Absicherung in der Vereinbarungsphase
- 2.3.2.1. Ausgestaltung von Verträgen
- 2.3.2.2. Zeitpunkt der vertraglichen Fixierung
- 2.3.2.3. Präventive Wirkung von Sanktionen
- 2.3.2.4. Praxisbeispiel zur vertraglichen Absicherung
- 2.3.3. Absicherung in der Abwicklungsphase
- 2.3.3.1. Durchsetzung von Verträgen und Sanktionierung
- 2.3.3.2. Abwälzung des Opportunismusrisikos auf Dritte
- 2.3.3.3. Praxisbeispiel zur Handhabung von Sanktionierung
- 2.3.1. Absicherung in der Anbahnungsphase
- 2.1. Grundlegende Betrachtung von Komponenten sozialer Beziehungen
- 3. Empirischer Teil: Empirische Analyse am Beispiel von Anbietern spezieller Software
- 3.1. Untersuchungsdesign
- 3.1.1. Besonderheiten des Softwaremarktes
- 3.1.2. Grundgesamtheit(en)
- 3.1.3. Erhebungsmethode
- 3.1.3.1. Besonderheiten der Erhebungsmethode für die Interviews
- 3.1.3.2. Besonderheiten der Erhebungsmethode für die Online-Erhebung
- 3.1.4. Erhebungsinstrument
- 3.1.4.1. Gliederung des Fragebogens
- 3.1.4.2. Anspruch des Fragebogens
- 3.1.4.3. Pretest
- 3.1.4.4. Unterschiede zwischen Interview- und Online-Fragebogen
- 3.1.5. Rücklauf und Antwortverhalten
- 3.2. Die Stichprobe(n)
- 3.2.1. Die Unternehmen
- 3.2.1.1. Geschäftstätigkeit
- 3.2.1.2. Unternehmensgröße
- 3.2.1. Die Unternehmen
- 3.1. Untersuchungsdesign
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Softwareunternehmen Kundenbeziehungen absichern. Das Hauptziel besteht darin, verschiedene Absicherungsmechanismen – sowohl vertragliche als auch alternative, wie die Nutzung von Marktmacht und soziale Netzwerke – zu analysieren und ihre Wirksamkeit im Umgang mit opportunistischem Kundenverhalten zu bewerten.
- Theoretische Fundierung von Kundenbeziehungen als soziale Beziehungen
- Analyse von Absicherungsmechanismen (vertragliche und alternative)
- Empirische Untersuchung an deutschen Softwareentwicklern
- Bedeutung von Marktmacht und sozialen Netzwerken für die Absicherung
- Auswirkungen von Opportunismus auf Kundenbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Notwendigkeit von Absicherung bei steigender Arbeitsteilung: Die Einleitung führt in die Thematik der Absicherung von Kundenbeziehungen im Kontext steigender Arbeitsteilung ein. Sie begründet die Relevanz der Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Absicherungsmechanismen angesichts zunehmender Spezialisierung und Abhängigkeit in wirtschaftlichen Beziehungen.
2. Theoretischer Teil: Theoretische Betrachtung einer Kundenbeziehung als soziale Beziehung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Kundenbeziehungen. Es betrachtet Kundenbeziehungen als soziale Beziehungen und analysiert verschiedene soziologische Theorien wie die Austauschtheorie und die Rational-Choice-Theorie, um das Verhalten von Akteuren und die Entstehung von Vertrauen zu erklären. Weiterhin werden verschiedene Absicherungsmechanismen, ihre Funktionsweisen und Limitationen detailliert dargestellt und in einen theoretischen Kontext eingeordnet. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des Opportunismusproblems und der Möglichkeiten, diesem durch vertragliche und außervertragliche Maßnahmen zu begegnen. Die Kapitel 2.1 und 2.2 liefern das Fundament für die empirische Untersuchung in Kapitel 3, indem sie die theoretischen Konzepte zur Absicherung von Kundenbeziehungen definieren und miteinander verknüpfen.
3. Empirischer Teil: Empirische Analyse am Beispiel von Anbietern spezieller Software: In diesem Kapitel werden die im theoretischen Teil entwickelten Hypothesen anhand einer empirischen Untersuchung an deutschen Softwareunternehmen getestet. Es wird detailliert das Untersuchungsdesign beschrieben, einschließlich der Erhebungsmethoden (Interviews und Online-Befragung), der Stichprobenauswahl und der verwendeten Instrumente. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden präsentiert und im Hinblick auf die getesteten Hypothesen analysiert und diskutiert. Hier wird die Lücke zwischen Theorie und Praxis geschlossen, indem reale Daten der Softwarebranche die theoretischen Annahmen überprüfen und veranschaulichen. Das Kapitel gliedert sich in detaillierte Unterabschnitte, die die Methodik und die Ergebnisse der Studie systematisch präsentieren.
Schlüsselwörter
Kundenbeziehungen, Softwareentwicklung, Absicherungsmechanismen, Opportunismus, Vertrag, Marktmacht, soziale Netzwerke, Transaktionskosten, Vertrauen, empirische Forschung, qualitative Methoden, quantitative Methoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Absicherung von Kundenbeziehungen bei Softwareunternehmen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Softwareunternehmen Kundenbeziehungen absichern. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Absicherungsmechanismen – sowohl vertragliche als auch alternative wie Marktmacht und soziale Netzwerke – und deren Wirksamkeit im Umgang mit opportunistischem Kundenverhalten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf soziologische Theorien wie die Austauschtheorie, die Rational-Choice-Theorie und Webers Idealtypen sozialen Handelns. Der Vertrauensbegriff, Tauschmedien nach Parsons und die Problematik des Opportunismus werden eingehend behandelt. Es wird analysiert, wie institutionelle Mechanismen (Verträge, AGB) und Marktmechanismen (Marktmacht) die Absicherung von Kundenbeziehungen beeinflussen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle der sozialen Einbettung und des Sozialkapitals.
Welche Absicherungsmechanismen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl vertragliche Absicherungsmechanismen (Vertragsgestaltung, Sanktionen) als auch alternative Mechanismen wie die Nutzung von Marktmacht und die Einbindung in soziale Netzwerke. Die Untersuchung betrachtet die Anwendung dieser Mechanismen in verschiedenen Phasen einer Geschäftstransaktion (Anbahnung, Vereinbarung, Abwicklung).
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut?
Die empirische Untersuchung erfolgt anhand einer Analyse deutscher Softwareunternehmen. Es wird ein detailliertes Untersuchungsdesign vorgestellt, das sowohl qualitative (Interviews) als auch quantitative (Online-Befragung) Methoden umfasst. Die Stichprobe, die Erhebungsinstrumente (Fragebögen) und das Antwortverhalten werden genau beschrieben. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die getesteten Hypothesen analysiert und diskutiert.
Welche Besonderheiten des Softwaremarktes werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen des Softwaremarktes, wie z.B. die immaterielle Natur der gelieferten Produkte und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Vertragsgestaltung und der Durchsetzung von Ansprüchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kundenbeziehungen, Softwareentwicklung, Absicherungsmechanismen, Opportunismus, Vertrag, Marktmacht, soziale Netzwerke, Transaktionskosten, Vertrauen, empirische Forschung, qualitative Methoden, quantitative Methoden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil (mit Unterkapiteln zu verschiedenen soziologischen Theorien und Absicherungsmechanismen) und einen empirischen Teil (mit Unterkapiteln zu Untersuchungsdesign, Stichprobe und Ergebnisanalyse).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse verschiedener Absicherungsmechanismen und die Bewertung ihrer Wirksamkeit im Umgang mit opportunistischem Kundenverhalten bei Softwareunternehmen. Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen von Kundenbeziehungen als soziale Beziehungen zu beleuchten und diese Erkenntnisse durch empirische Daten zu untermauern.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden präsentiert und im Hinblick auf die getesteten Hypothesen analysiert und diskutiert. Es wird gezeigt, wie die verschiedenen Absicherungsmechanismen in der Praxis Anwendung finden und welche Bedeutung Marktmacht und soziale Netzwerke für die Absicherung von Kundenbeziehungen haben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Kundenbeziehungen, Opportunismus, Vertragsgestaltung und Absicherungsmechanismen im Kontext der Softwareentwicklung befassen. Sie ist auch für Praktiker in der Softwarebranche von Interesse, die ihre Strategien zur Kundenbeziehungsmanagement optimieren möchten.
- Quote paper
- Dr. Michael Krupp (Author), 2002, Absicherung von Kundenbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7832