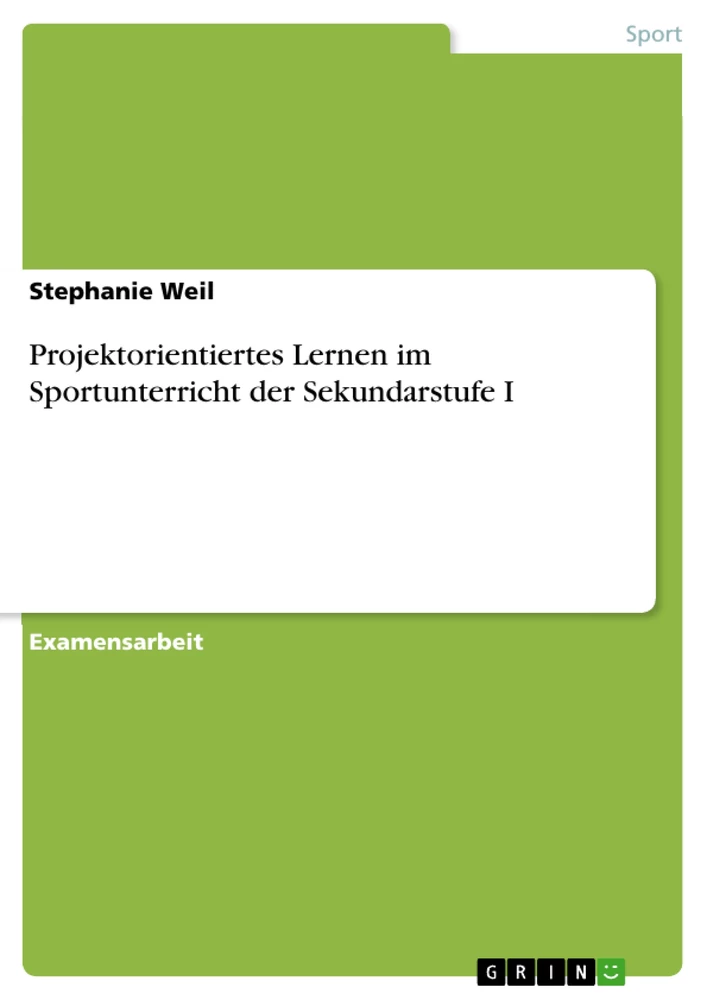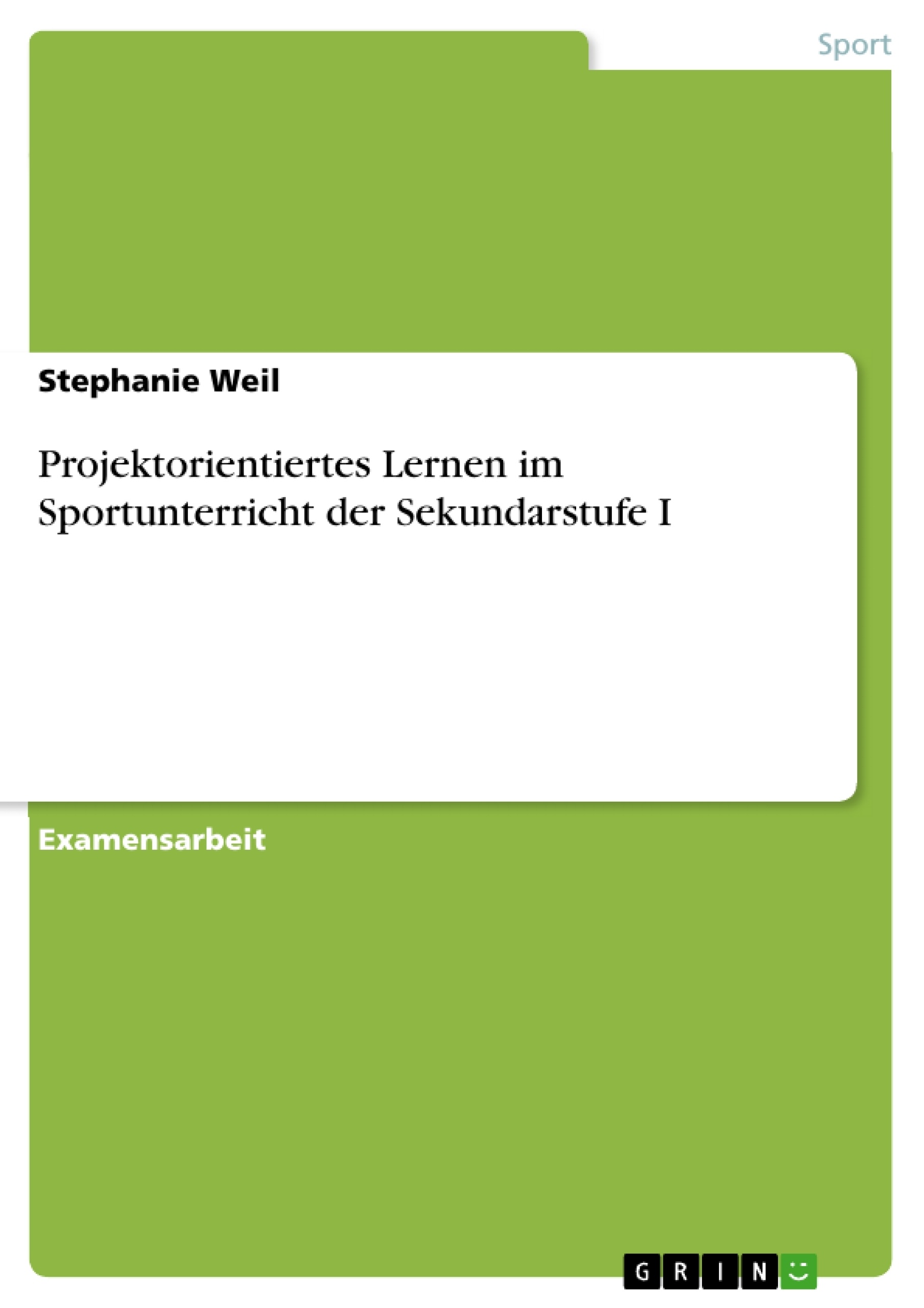Mit den Ergebnissen der Pisa-Studie sind Wirtschaft und Gesellschaft sowie Eltern, Schüler, Lehrer und namhafte Pädagogen unzufrieden. Dabei wird scharfe Kritik um das Lehren und Lernen in der Schule nicht erst seit diesem Zeitpunkt laut.
Neben Fragen nach den Inhalten rückt dabei immer mehr die Frage nach den Methoden in den Vordergrund. Das heißt: Mit welchen Mitteln sind die Leistungen an den Schulen zu verbessern?
Wie kann effektiv und anwendungsbezogen gelernt werden?
Vertreter der Wirtschaft und Bildungspolitiker fordern auf, gemäß den Anforderungen des Berufslebens auszubilden. Sogenannte Schlüsselqualifikationen wie selbstständiges Lernen, Denken und Handeln sowie Teamfähigkeit oder Kooperationsvermögen seien bislang in der Schule nur allzu wenig berücksichtigt worden. „Die Schule hängt einem längst überholten Leistungsbegriff an: Schüler müssen sich mit reproduzierbarem Spezialwissen vollstopfen, das als Einzelleistung abgeprüft wird. Nicht hochspezialisiertes Wissen, sondern übergreifende „Schlüsselqualifikationen“ - von der Kooperationsfähigkeit bis zum ökologischen Denken - sind gefordert. Die mangelnde Teamfähigkeit […] wird demgegenüber immer wieder beklagt.“
Außerdem werde der Unterricht beziehungslos und in einem Nebeneinander der Fächer durchgeführt. Der Arbeitsbetrieb heutiger großer Schulen, spezialisierter Fachlehrer mit einem großen Stundenumfang, die sich häufig nicht genug kennen und zudem im 45 - Minuten - Takt ihren Stoff vermitteln, lasse nur wenig Raum für fachübergreifendes Lernen und Handeln. Mehr Lebensnähe, mehr Praxis und höhere Handlungsanteile werden verstärkt von Schulkritikern gefordert.
Als Erkenntnis wird postuliert, dass neue Formen des Unterrichtens getestet werden müssen. Erziehungswissenschaftler stellen fest, dass vor allem „Hauptschüler […] ein praktisches alltagsnahes Bildungsangebot“ benötigen. Über die gesamte Schullaufbahn sei individuelles und praxisnahes Lernen in Form von Unterrichtsöffnung, freiem Arbeiten und Projektarbeit nötig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Konzeption der Arbeit
- Ursprung und Definition des projektorientierten Lernens / Eine geschichtliche Einordnung
- Geschichtliche Einordnung der Projektmethode
- Das Projekt, Versuche einer Definition der Projektmethode / des projektorientierten Lernens
- Das Projekt
- Merkmale, Schrittfolgen und Aufgaben der Projektmethode
- Projektorientiertes Lernen, Möglichkeiten der Ausweitung / Reduktion
- Ziele des Projektunterrichts
- Die Vorgaben des RahMENPLANS IM Sportunterricht der Sekundarstufe I ZUM projektorientierten Lernen
- Inner- und außerschulische Verbindungen knüpfen
- Schülererfahrungen / Schülerorientierung
- Die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Bildung persönlicher Kompetenzen
- Gestalten der Wirklichkeit
- Selbstverantwortung / Verantwortung für andere / gemeinsame Reflexion
- Differenzierung
- Möglichkeiten und Grenzen der Projektmethode im Sportunterricht
- Möglichkeiten und Probleme in der Startphase
- Probleme beim selbstständigen Wählen eines umsetzbaren Projektthemas
- Probleme und Möglichkeiten beim Einigen auf ein Thema aus dem Lebensbereich der Schüler
- Der Gebrauchswert eines Projektthemas
- Möglichkeiten und Probleme in der Planungsphase
- Das Einbeziehen der Schüler in die Unterrichtsorganisation
- Sicherheitsmaßnahmen
- Möglichkeiten und Probleme in der Durchführungsphase
- Zeit und Energie
- Materialbeschaffung
- Das Einbringen eigener Ideen und Fähigkeiten / Differenzierung
- Vielfältige inner- und außerschulische Verbindungen
- Schlüsselqualifikationen und andere Fähigkeiten
- Möglichkeiten und Probleme in der Beurteilungs- und Bewertungsphase
- Behaltensleistung
- Notengebung
- Die Metainteraktion und die Abschlussreflexion
- Allgemeine Probleme und Möglichkeiten
- Die Rahmenbedingungen von Schule
- Die mangelhafte Projektausbildung der Lehrer
- Die veränderte Schüler- und Lehrerolle
- Das Erfahrungslernen und die Einführung der Trendsportarten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Einsatzmöglichkeiten des projektorientierten Lernens im Sportunterricht der Sekundarstufe I. Sie befasst sich mit dem Ursprung und der Definition der Projektmethode, den Vorgaben des RahMENPLANS und den Möglichkeiten und Grenzen des projektorientierten Lernens im Sportunterricht.
- Der Ursprung und die Definition der Projektmethode
- Die Vorgaben des RahMENPLANS für projektorientiertes Lernen im Sportunterricht
- Möglichkeiten und Grenzen des projektorientierten Lernens in der Startphase, Planungsphase, Durchführungsphase, Beurteilungs- und Bewertungsphase sowie allgemeine Probleme und Möglichkeiten
- Die veränderte Schüler- und Lehrerrolle im projektorientierten Lernen
- Die Bedeutung des Erfahrungslernens und der Trendsportarten im projektorientierten Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion um die Wirksamkeit des traditionellen Schulunterrichts und die Notwendigkeit neuer Lernformen. Sie zeigt die Projektmethode als eine vielversprechende Alternative auf, die bereits in innovativen Schulen erfolgreich eingesetzt wird.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Ursprung und der Definition des projektorientierten Lernens. Es beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Projektmethode und diskutiert verschiedene Definitionsansätze.
Kapitel 3 untersucht die Vorgaben des RahMENPLANS für projektorientiertes Lernen im Sportunterricht. Es analysiert die Ziele des Projektunterrichts, wie z.B. die Förderung inner- und außerschulischer Verbindungen, Schülererfahrungen, die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung von Selbstverantwortung.
Kapitel 4 widmet sich den Möglichkeiten und Grenzen der Projektmethode im Sportunterricht. Es analysiert die Herausforderungen und Chancen in verschiedenen Phasen des Projektes, z.B. in der Startphase, Planungsphase, Durchführungsphase und Bewertungsphase.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das projektorientierte Lernen im Sportunterricht der Sekundarstufe I. Schlüsselwörter sind: Projektmethode, Projektunterricht, RahMENPLAN, Schülererfahrungen, Selbstverantwortung, Differenzierung, Trendsportarten, Erfahrungslernen, Schlüsselqualifikationen, inner- und außerschulische Verbindungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von projektorientiertem Lernen im Sportunterricht?
Ziel ist die Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, selbstständiges Handeln und Kooperationsvermögen durch praxisnahe, fächerübergreifende Aufgabenstellungen.
Welche Herausforderungen gibt es für Lehrer bei der Projektmethode?
Lehrer müssen ihre traditionelle Rolle aufgeben und zu Moderatoren werden. Schwierigkeiten liegen oft in der Materialbeschaffung, der Notengebung und der Gewährleistung von Sicherheitsmaßnahmen.
Wie sieht die Rolle der Schüler im Projektunterricht aus?
Schüler werden aktiv in die Planung und Organisation einbezogen. Sie wählen Themen aus ihrem Lebensbereich und tragen Verantwortung für den Erfolg des Projekts.
Was sagt der Rahmenplan zum projektorientierten Lernen?
Der Rahmenplan fordert die Verknüpfung von inner- und außerschulischen Erfahrungen sowie die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung durch offene Unterrichtsformen.
Können Trendsportarten im Projektunterricht genutzt werden?
Ja, Trendsportarten eignen sich besonders gut, da sie oft einen hohen Aufforderungscharakter für Schüler haben und Raum für Erfahrungslernen und eigene Gestaltung bieten.
- Citar trabajo
- Stephanie Weil (Autor), 2006, Projektorientiertes Lernen im Sportunterricht der Sekundarstufe I, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78335