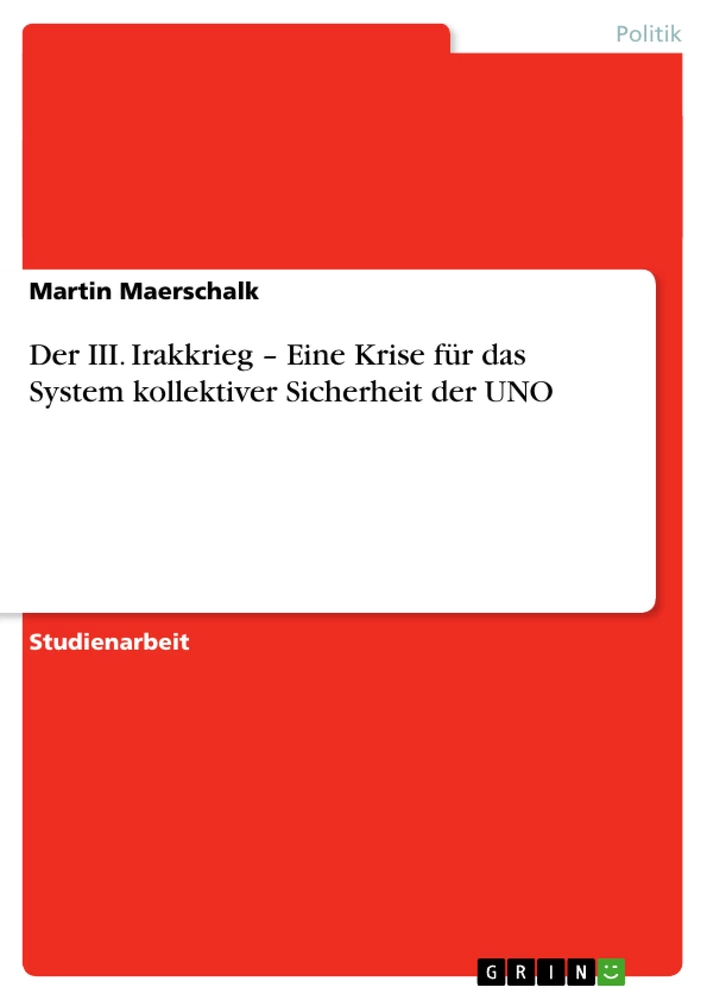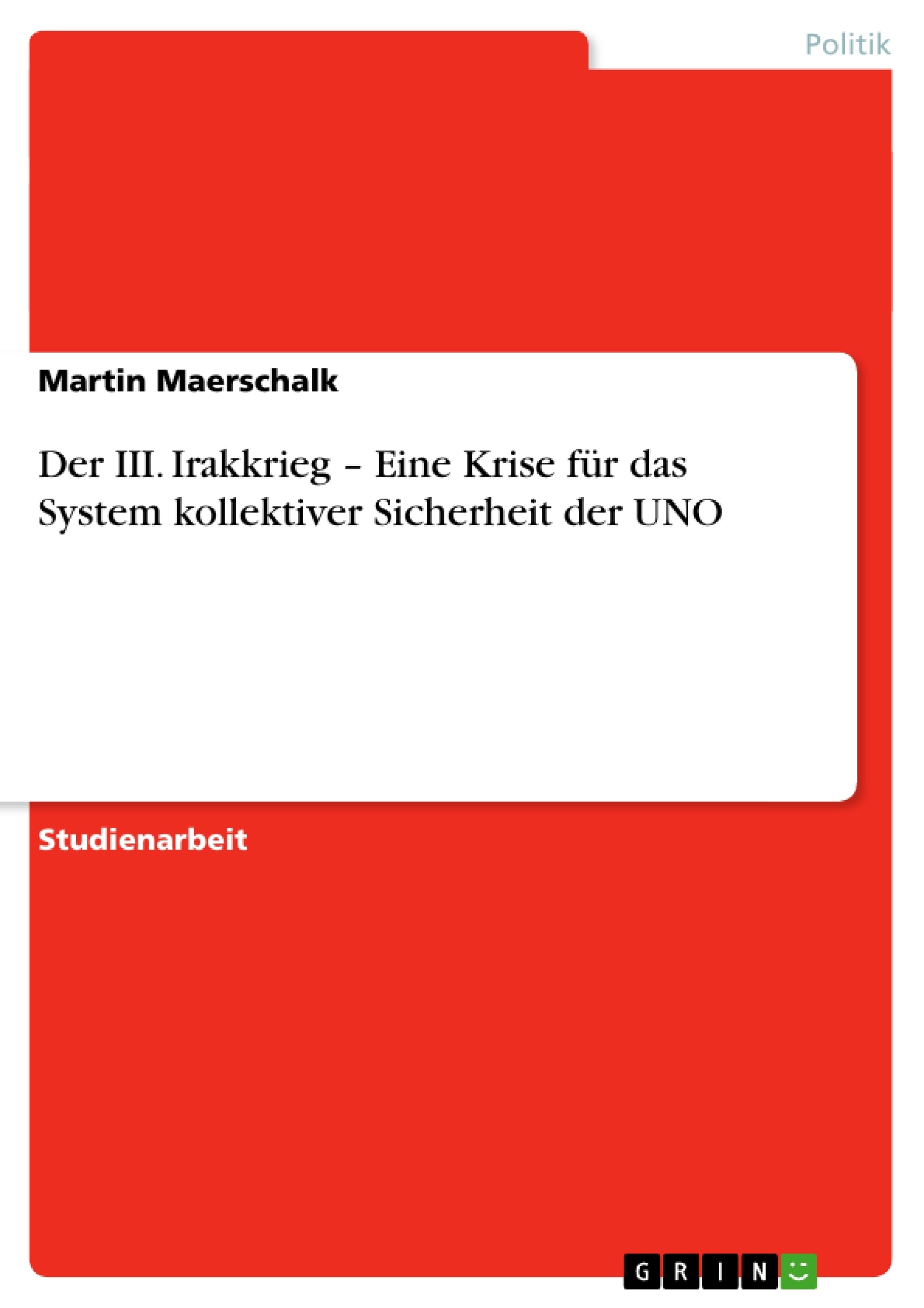Das Ende des Ost-West-Konflikts markierte auch einen Wendepunkt in der Geschichte der UNO und ihres Systems der kollektiven Sicherheit (KS). Nach dem Ende der gegenseitigen Veto-Blockade im Sicherheitsrat schien die Hoffnung auf ein höheres Maß an Kooperation in der internationalen Staatenwelt neue Nahrung zu erhalten. Im Falle des II. Golfkrieges hat sich diese Hoffnung durchaus als berechtigt erwiesen. Erstmals nach der Gründung der UNO 1945 konnte der Aggression des Irak mit einem umfassenden Sanktionskatalog begegnet werden, der die UN-Charta voll ausschöpfte. Dieser Neuanfang, diese neue Weltordnung schien auch die Funktionalität der kollektiven Sicherheit zu belegen, ein Konzept, das sich seit jeher mit einem hohen Maß an Kritik konfrontiert sah. Stellt die Einigung aller Völker unter ein universelles Gewaltenverbot für manche Theoretiker die einzige Möglichkeit dar, die Welt nachhaltig und dauerhaft vom Übel des Krieges zu befreien, ist es für andere bloß ein Mythos, der die Staaten in ein idealistisches Konzept zwängt, das einzuhalten sie weder willens, noch in der Lage sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kollektive Sicherheit aus theoretischer Perspektive
- Kennzeichnende Elemente eines Systems kollektiver Sicherheit
- Theoretische Kritik
- Kollektive Sicherheit in der UNO
- Umsetzung
- Problemfeld 1: Ungleiche Machtverteilung im Sicherheitsrat
- Problemfeld 2: Das Recht auf Selbstverteidigung - Unklarheiten und Interpretationsspielräume
- Problemfeld 3: Militärische Abhängigkeit der UNO
- Kollektive Sicherheit in der Krise: Der III. Golfkrieg
- Einführung
- Der Sicherheitsrat: Verhandlung um die Resolution 1441
- Der III. Golfkrieg: Rechtfertigung durch die UNO?
- Bedrohung durch den Irak: Recht auf Selbstverteidigung?
- Der Kosten-Nutzen-Faktor: Interessen der USA in der Golfregion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Konzept der kollektiven Sicherheit anhand des III. Irak-Konflikts. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit dieses Systems zu überprüfen, indem es sowohl theoretisch als auch empirisch betrachtet wird. Die Arbeit untersucht die Grundzüge der kollektiven Sicherheit, die theoretische Kritik an ihrer Konzeption sowie die Ausgestaltung in der UNO. Dabei werden drei Problemfelder analysiert, die in Bezug auf die Funktionsfähigkeit des Systems von Bedeutung sind. Schließlich wird untersucht, inwieweit diese Problemfelder im Verlauf der Golfkrise ihre Bedeutung offenbarten, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Vereinigten Staaten.
- Das Konzept der kollektiven Sicherheit und seine Kritik
- Die Ausgestaltung der kollektiven Sicherheit in der UNO
- Die Rolle der Vereinigten Staaten im III. Golfkrieg
- Die Problemfelder der Ungleichen Machtverteilung, des Rechts auf Selbstverteidigung und der militärischen Abhängigkeit der UNO
- Die Funktionsfähigkeit des Systems kollektiver Sicherheit im Kontext des III. Irak-Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des III. Golfkriegs dar und betont die Bedeutung des Konzepts der kollektiven Sicherheit im Zuge des Endes des Ost-West-Konflikts. Die Arbeit zeigt auf, dass der III. Golfkrieg die Funktionalität des Systems kollektiver Sicherheit in Frage stellt und die USA in eine Position der Hegemonie versetzen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, das Konzept der kollektiven Sicherheit anhand des III. Irak-Konflikts kritisch zu analysieren.
Kollektive Sicherheit aus theoretischer Perspektive
Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der kollektiven Sicherheit, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Bündnisformen. Es werden die drei zentralen Elemente eines Systems kollektiver Sicherheit - das Gewaltenverbot, Sanktionen und die Abgabe von Souveränitätsrechten - erläutert. Zudem werden die Kritikpunkte an der theoretischen Konzeption der kollektiven Sicherheit dargestellt.
Kollektive Sicherheit in der UNO
Dieses Kapitel untersucht die praktische Umsetzung der kollektiven Sicherheit im Rahmen der Vereinten Nationen. Es analysiert die Problemfelder der ungleichen Machtverteilung im Sicherheitsrat, des Rechts auf Selbstverteidigung und der militärischen Abhängigkeit der UNO.
Kollektive Sicherheit in der Krise: Der III. Golfkrieg
Dieses Kapitel analysiert den III. Golfkrieg und die Rolle der kollektiven Sicherheit in diesem Kontext. Es untersucht die Verhandlung um die Resolution 1441, die Rechtfertigung des Krieges durch die UNO, die Bedrohung durch den Irak und die Interessen der USA in der Golfregion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der kollektiven Sicherheit, der Funktionsfähigkeit des Systems kollektiver Sicherheit in der UNO, dem III. Irak-Konflikt, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten, dem Recht auf Selbstverteidigung, der Machtverteilung, den Sanktionen und der militärischen Abhängigkeit der UNO. Zudem werden theoretische Konzepte der kollektiven Sicherheit und die Kritik an diesen Konzepten diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei zentralen Elemente kollektiver Sicherheit?
Ein System kollektiver Sicherheit kennzeichnet sich durch ein universelles Gewaltenverbot, Sanktionen bei Verstößen und die Abgabe von Souveränitätsrechten an eine übergeordnete Organisation.
Welches Problem stellt die Machtverteilung im UN-Sicherheitsrat dar?
Die ungleiche Machtverteilung, insbesondere das Vetorecht der ständigen Mitglieder, kann die Handlungsfähigkeit des Systems der kollektiven Sicherheit blockieren.
War der III. Irakkrieg durch die UNO gerechtfertigt?
Die Arbeit untersucht kritisch die Verhandlungen um die Resolution 1441 und die Frage, ob der Krieg völkerrechtlich durch die UN-Charta gedeckt war.
Was bedeutet die „militärische Abhängigkeit“ der UNO?
Da die UNO über keine eigenen Streitkräfte verfügt, ist sie bei der Durchsetzung von Sanktionen oder militärischen Interventionen auf die Bereitstellung von Truppen durch Mitgliedstaaten angewiesen.
Wie beeinflusste das Ende des Ost-West-Konflikts die UNO?
Nach dem Ende der gegenseitigen Veto-Blockade gab es neue Hoffnung auf Kooperation, die sich erstmals im II. Golfkrieg durch umfassende Sanktionen gegen den Irak bewährte.
- Citation du texte
- Martin Maerschalk (Auteur), 2007, Der III. Irakkrieg – Eine Krise für das System kollektiver Sicherheit der UNO, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78377