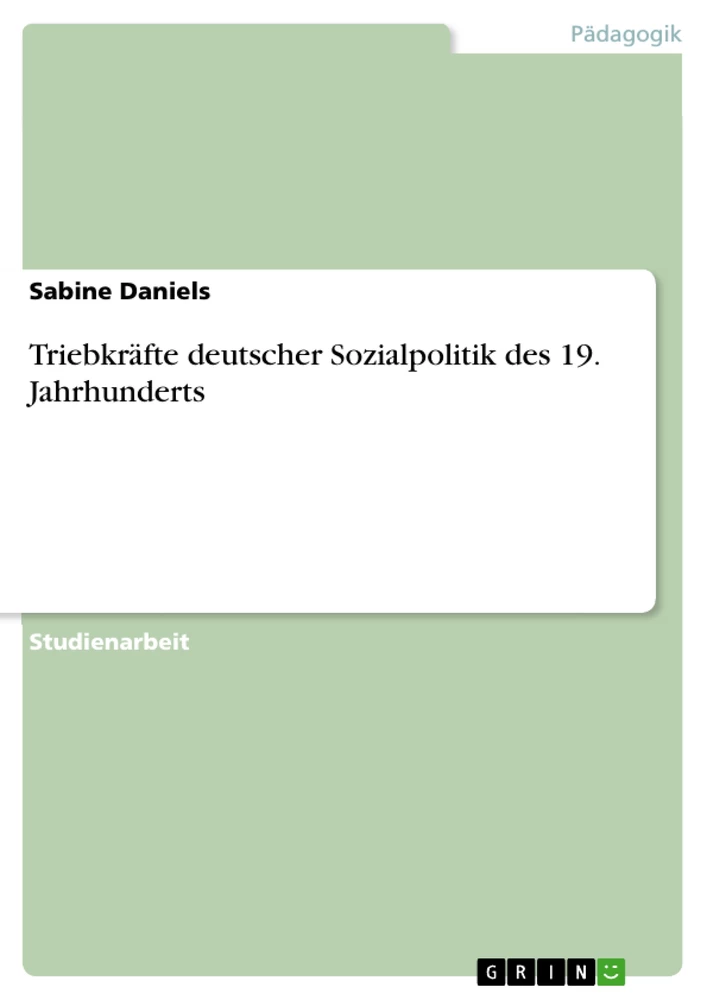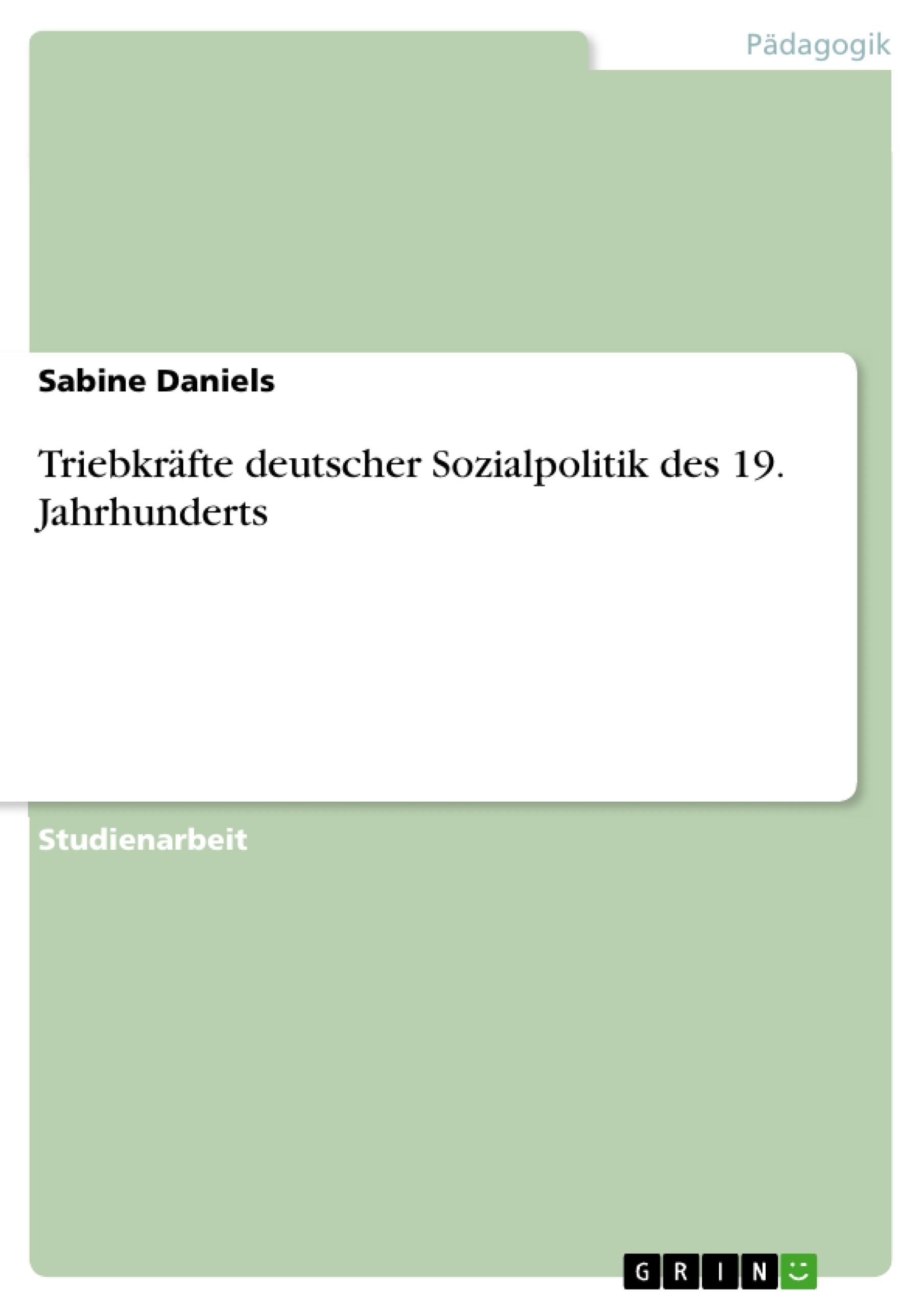In den Jahren der Reichsgründung vollzieht sich in Deutschland eine große Veränderung innerhalb der Länder. Seit 1871 ist das deutsche Reich ein Bundesstaat. Eine dominante Stellung wird von Preußen eingenommen. Der König Preußens wird automatisch deutscher Kaiser. Die Position des Reichskanzlers wird von 1870 bis 1890 von Fürst Otto von Bismarck eingenommen. Er ist für die Innenpolitik zuständig, wird allein vom Kaiser ernannt bzw. nur dieser kann ihn entlassen. Von Bismarck hat den Vorsitz im Bundesrat. Hierin hat jeder Bundesstaat einen weisungsgebundenen Vertreter. Bayern führt den Vorsitz. Jeder Bundesstaat darf nur eine Stimme abgeben. Bundesrat und Bundestag erlassen gemeinsam die Gesetze. Die Wandlung Deutschlands zum Industriestaat ist die Grundlage für die Veränderung der betrieblichen Organisationsformen. In den ersten Jahren nach der Reichsgründung wachsen die Großunternehmen ständig, die Leistungsfähigkeit der Handwerksbetriebe wird immer weiter in den Schatten gestellt. Es findet ein umfassender Strukturwandel statt. Die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich nimmt immer gegensätzlichere Formen an. Die Massenverelendung, der Pauperismus steht in den Ballungszentren dem neuen industriellen Wohlstand der besitzenden Klasse gegenüber. Die Reichsgründung aus vielen kleinen Ländern ist ohne innere Einheit vollzogen worden. Es gibt keine traditionelle Bindung an den Staat. Die Angst vor Revolutionen führt zum Verbot von Versammlungen oder der Bildung von Organisationen, die vielleicht in der Lage gewesen sind bei einigen soziale Probleme sinnvolle Vorschläge zu machen. Stattdessen verschärft sich die soziale Lage der Arbeiterschaft durch zunehmende Verarmung. Veränderte Lebenssituationen führen zur sozialen Frage der Arbeiter. Die Sozialpolitik Deutschlands lässt sich an der Problematik der Lebensumstände von Arbeitern im 19. und 20.Jahrhundert beschreiben. Immer geht es um die Menschen deren Besitz einzig und allein in ihrer Arbeitskraft bestanden hat. Somit werden sie also nicht mit Grundbesitz oder dem Besitz von Produktionsmitten abgesichert.
Inhaltsverzeichnis
- Die allgemeine Politische Lage in Deutschland des 19. Jahrhunderts
- Ursachen und Einflüsse der sozialen Frage im 19. Jahrhundert:
- Gründe für die Entstehung neuer sozialpolitischer Aufgaben
- Triebkräfte deutscher Sozialpolitik
- Kirchliche Ansätze
- Ansätze von Unternehmerseite
- Sozialreformer an den Hochschulen
- Sozialer Einsatz von Beamten und Parlamentariern
- Neue Wege gehen die Sozialrevolutionäre
- Die Arbeiterbewegungen
- Übersicht über die soziale Bewegung der Parteien und Vereinigungen
- Strömungen der Arbeiterbewegung
- Gewerkschaftliche Organisationen
- Die Sozialgesetzgebung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Triebkräften der deutschen Sozialpolitik im 19. Jahrhundert. Sie untersucht die Ursachen und Einflüsse der sozialen Frage in diesem Zeitraum und analysiert die verschiedenen Ansätze und Initiativen, die zur Entwicklung der Sozialpolitik beitrugen.
- Die Politische Lage in Deutschland im 19. Jahrhundert
- Die Entstehung der sozialen Frage und ihre Ursachen
- Die verschiedenen Triebkräfte der deutschen Sozialpolitik
- Die Rolle der Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften
- Die Entwicklung der Sozialgesetzgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die allgemeine politische Lage in Deutschland im 19. Jahrhundert, die durch die Reichsgründung, die Dominanz Preußens und die Rolle Bismarcks geprägt war. Es zeigt, wie die Industrialisierung zur Spaltung der Gesellschaft in arm und reich führte und die soziale Frage der Arbeiter hervorrief. Das zweite Kapitel analysiert die Ursachen und Einflüsse der sozialen Frage, insbesondere die Landflucht, die Abhängigkeit der Arbeiter von den Fabrikbesitzern und die schlechten Arbeitsbedingungen. Das dritte Kapitel untersucht die Gründe für die Entstehung neuer sozialpolitischer Aufgaben, wie z.B. Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit.
Das vierte Kapitel behandelt die Triebkräfte der deutschen Sozialpolitik, wobei es auf die Ansätze von kirchlicher Seite, Unternehmerseite, Sozialreformer an den Hochschulen, Beamten und Parlamentariern sowie die Sozialrevolutionäre eingeht. Das fünfte Kapitel analysiert die Arbeiterbewegungen, die verschiedenen Strömungen und die gewerkschaftlichen Organisationen. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Sozialgesetzgebung. Der Fokus liegt hierbei auf den wichtigsten Gesetzen, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter erlassen wurden. Das Kapitel über das Fazit wird in dieser Vorschau nicht berücksichtigt, um keine Spoiler zu verursachen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Triebkräfte der deutschen Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts, die durch die Industrialisierung, die soziale Frage, die Arbeiterbewegungen, die Sozialgesetzgebung und die unterschiedlichen Ansätze der politischen, kirchlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure geprägt wurde. Weitere zentrale Themen sind die politische Lage Deutschlands im 19. Jahrhundert, die Auswirkungen der Gewerbefreiheit, die Armut und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter.
Häufig gestellte Fragen
Wer prägte die deutsche Innenpolitik zwischen 1870 und 1890?
Fürst Otto von Bismarck war in dieser Zeit als Reichskanzler maßgeblich für die Innenpolitik zuständig und hatte den Vorsitz im Bundesrat inne.
Was versteht man unter dem Begriff Pauperismus im 19. Jahrhundert?
Pauperismus bezeichnet die Massenverelendung der Arbeiterschaft in den Ballungszentren, die im krassen Gegensatz zum neuen industriellen Wohlstand der besitzenden Klasse stand.
Was war die "soziale Frage" der Arbeiter?
Die soziale Frage bezog sich auf die prekären Lebensumstände der Arbeiter, die nur über ihre Arbeitskraft verfügten und keine Absicherung durch Grundbesitz oder Produktionsmittel hatten.
Welche Akteure trieben die deutsche Sozialpolitik voran?
Zu den Triebkräften gehörten die Kirchen, engagierte Unternehmer, Sozialreformer an Hochschulen, Beamte, Parlamentarier sowie Sozialrevolutionäre.
Welche Rolle spielten die Gewerkschaften in dieser Zeit?
Gewerkschaften organisierten die Arbeiterschaft, um deren Interessen zu vertreten und soziale Verbesserungen durch kollektives Handeln zu erzwingen.
- Citation du texte
- Dipl. Soz.Arb. Sabine Daniels (Auteur), 2002, Triebkräfte deutscher Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78470