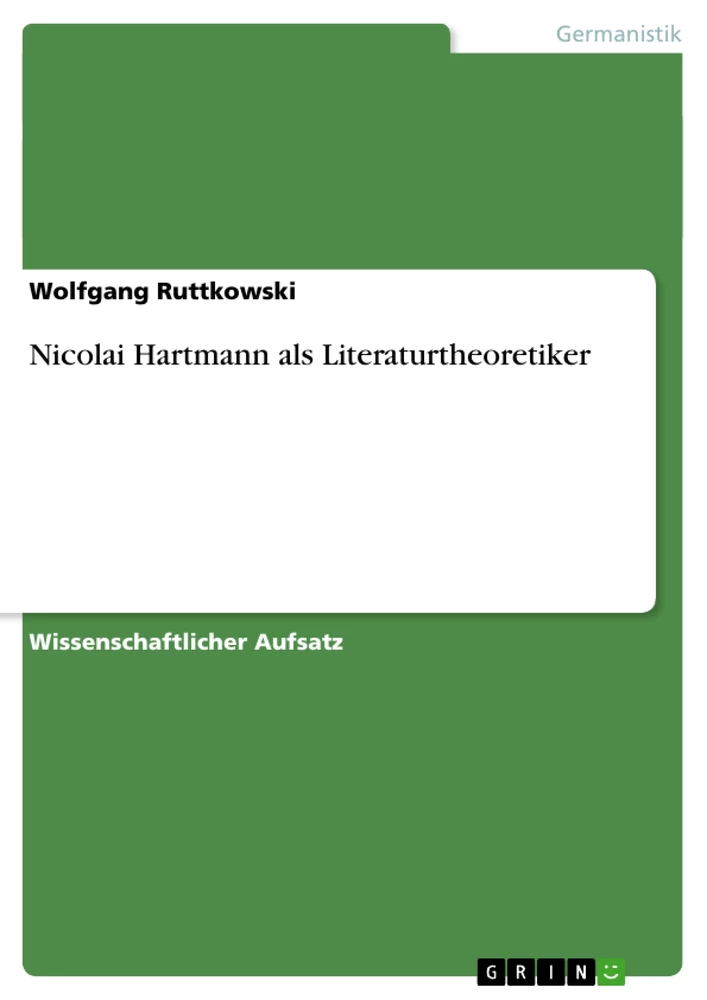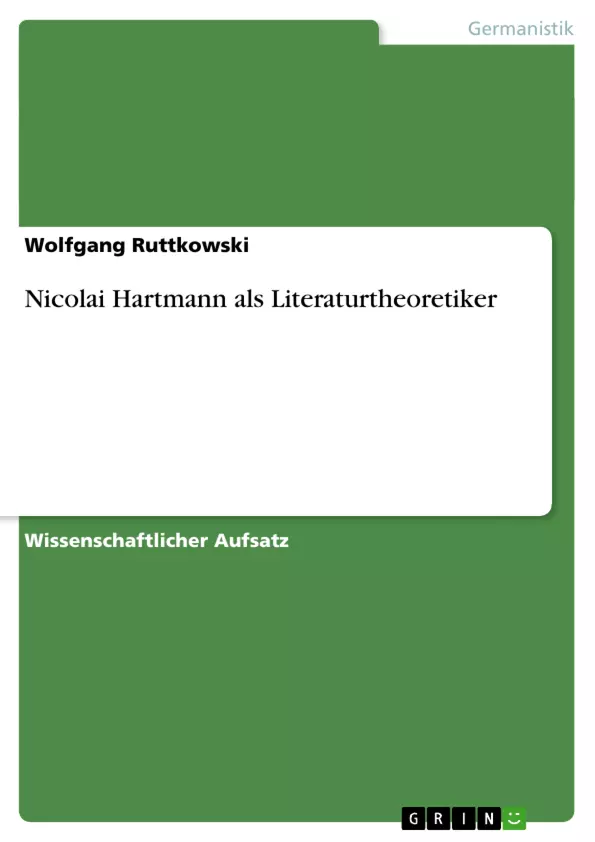Der Vorteil von Schichtenmodellen liegt in der Veranschaulichung an sich abstrakter Relationen von Merkmalen und Merkmalskomplexen. Er liegt aber auch in neuen Beantwortungen alter Probleme, z.B. dem wie weit das Prinzip der Aussparung und Abstraktion in den verschiedenen Künsten (etwa in konkreter Poesie ) getrieben werden kann, bis diese in ihrer Funktion als Kommunikation versagen. Ebenso hat die Schichtentheorie endlich geklärt, wo eigentlich die "Form" des Kunstwerks anzusiedeln ist: Hartmann hat überzeugend dargelegt, dass auch die Form jedes Kunstwerks geschichtet ist, bezw. sich aus dem Zusammenwirken der Formung aller Schichten ergibt. Jede Schicht eines Kunstwerks kann nur in einer bestimmten Formung existieren, mit der sie die der nächstfolgenden determiniert. Die ästhetische Seinsweise des Kunstwerks beruht auf diesem Hintereinander von sich gegenseitig bedingenden Formungen, ebenso wie seine ontologische Seinsweise im Verhältnis der sich gegenseitig tragenden Schichten beruht.
All diese Einsichten haben sowohl für die allgemeine Ästhetik wie auch für die Literaturtheorie weitreichende Folgen und man kann deshalb sagen, dass die Erkenntnisse Hartmanns für die Literaturwissenschaft noch nicht fruchtbar gemacht und schon gar nicht ausgeschöpft sind.
(Vortrag vor dem Jap. Germanistenverband, Musashi Daigaku, Tokyo, 20.5.1989)
Inhaltsverzeichnis
- Nicolai Hartmann als Literaturkritiker
- Die Gründe für das Übersehen von Hartmanns Literaturtheorie
- Hartmanns Leistung im Vergleich zu Ingarden
- Hartmanns Darlegungsstil
- Ingardens Stil im Vergleich zu dem von Hartmann
- Die ontologische Analyse der Literatur in der Nachkriegszeit
- Die Angriffe auf Hartmanns Ontologie und ihre Auswirkungen auf seine Ästhetik
- Hartmanns und Ingardens Gemeinsamkeiten
- Die Unterschiede in den Ansätzen von Hartmann und Ingarden zur Schichtung des Kunstwerks
- Ingardens Missverständnis von Hartmanns Schichtenmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Literaturtheorie von Nicolai Hartmann und setzt sie in Beziehung zu den Ansätzen von Roman Ingarden. Er verdeutlicht, warum Hartmanns umfassende Ästhetik, die auch die Literatur umfasst, in der Literaturwissenschaft weitgehend unbeachtet geblieben ist. Der Text argumentiert, dass Hartmanns Ansätze für ein tieferes Verständnis von Kunstwerken, insbesondere von Literatur, relevant sind. Er stellt Hartmanns Darlegungsstil und dessen Verhältnis zu Ingarden dar, beleuchtet die Rolle der ontologischen Literaturanalyse in der Nachkriegszeit und diskutiert die Kritik an Hartmanns allgemeiner Ontologie.
- Hartmanns Literaturtheorie im Kontext seiner Ästhetik
- Der Vergleich von Hartmanns und Ingardens Ansätzen zur Schichtung des Kunstwerks
- Die Bedeutung der ontologischen Literaturanalyse
- Hartmanns Darlegungsstil und seine Bedeutung für das Verständnis seiner Gedanken
- Die Rezeption von Hartmanns Arbeit in der Literaturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet, warum Hartmanns Ästhetik und seine Literaturtheorie in der Literaturwissenschaft kaum Beachtung gefunden haben. Es werden die Gründe für dieses Übersehen dargelegt und Hartmanns Leistung im Vergleich zu Ingarden betrachtet.
- Das zweite Kapitel analysiert Hartmanns Darlegungsstil und vergleicht ihn mit dem von Ingarden. Es werden die Vorzüge von Hartmanns Stil hervorgehoben und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, betont.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung der ontologischen Literaturanalyse in der Nachkriegszeit und die damit einhergehende Vernachlässigung dieser Thematik. Es wird der Einfluss des französischen Existenzialismus und der soziologischen Literaturwissenschaft diskutiert.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit den Angriffen auf Hartmanns allgemeine Ontologie und deren Auswirkungen auf seine Ästhetik. Es wird argumentiert, dass diese Kritik nicht auf seine Ästhetik übertragbar ist, da diese sich auf die Existenz des ästhetischen Objekts für den Rezipienten konzentriert.
- Das fünfte Kapitel stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen von Hartmann und Ingarden dar. Es werden insbesondere ihre Positionen zur Idealismus-Realismus-Kontroverse und ihre jeweilige Auffassung vom Kunstwerk als „intentionales Objekt“ erläutert.
- Das sechste Kapitel befasst sich mit den Unterschieden in den Ansätzen von Hartmann und Ingarden zur Schichtung des Kunstwerks. Es werden Ingardens Kritik an Hartmanns Übertragung von Schichtkategorien auf verschiedene Kunstarten sowie dessen Missverständnis von Hartmanns Theorie diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind Nicolai Hartmann, Roman Ingarden, Ästhetik, Literaturtheorie, Schichtung, Kunstwerk, ontologische Analyse, Idealismus-Realismus-Kontroverse, phänomenologischer Realismus, Rezeption, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Schichtenmodell des Kunstwerks nach Nicolai Hartmann?
Hartmann beschreibt das Kunstwerk als ein Gebilde aus verschiedenen Schichten, wobei die äußeren Schichten die inneren tragen und determinieren.
Warum wurde Hartmanns Literaturtheorie lange Zeit übersehen?
Gründe liegen in seinem komplexen Darlegungsstil, der Kritik an seiner allgemeinen Ontologie und der Dominanz anderer Strömungen wie dem Existenzialismus in der Nachkriegszeit.
Wie unterscheidet sich Hartmann von Roman Ingarden?
Obwohl beide Schichtenmodelle nutzen, gibt es fundamentale Unterschiede in der Kategorisierung der Schichten und dem Verständnis des Kunstwerks als intentionales Objekt.
Was bedeutet die ontologische Analyse der Literatur?
Sie untersucht die Seinsweise literarischer Werke und wie reale sprachliche Zeichen auf eine irreal-ästhetische Welt verweisen.
Wo ist die „Form“ des Kunstwerks laut Hartmann angesiedelt?
Die Form ist laut Hartmann ebenfalls geschichtet; sie ergibt sich aus dem Zusammenwirken der Formung aller einzelnen Schichten des Werks.
- Citar trabajo
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Autor), 1989, Nicolai Hartmann als Literaturtheoretiker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7857