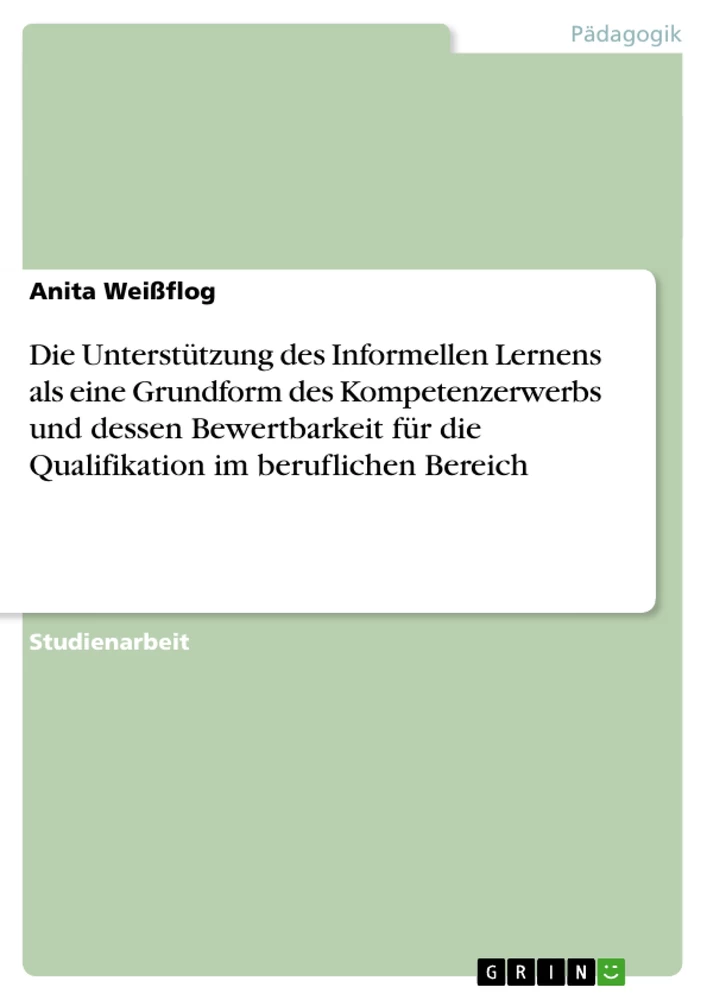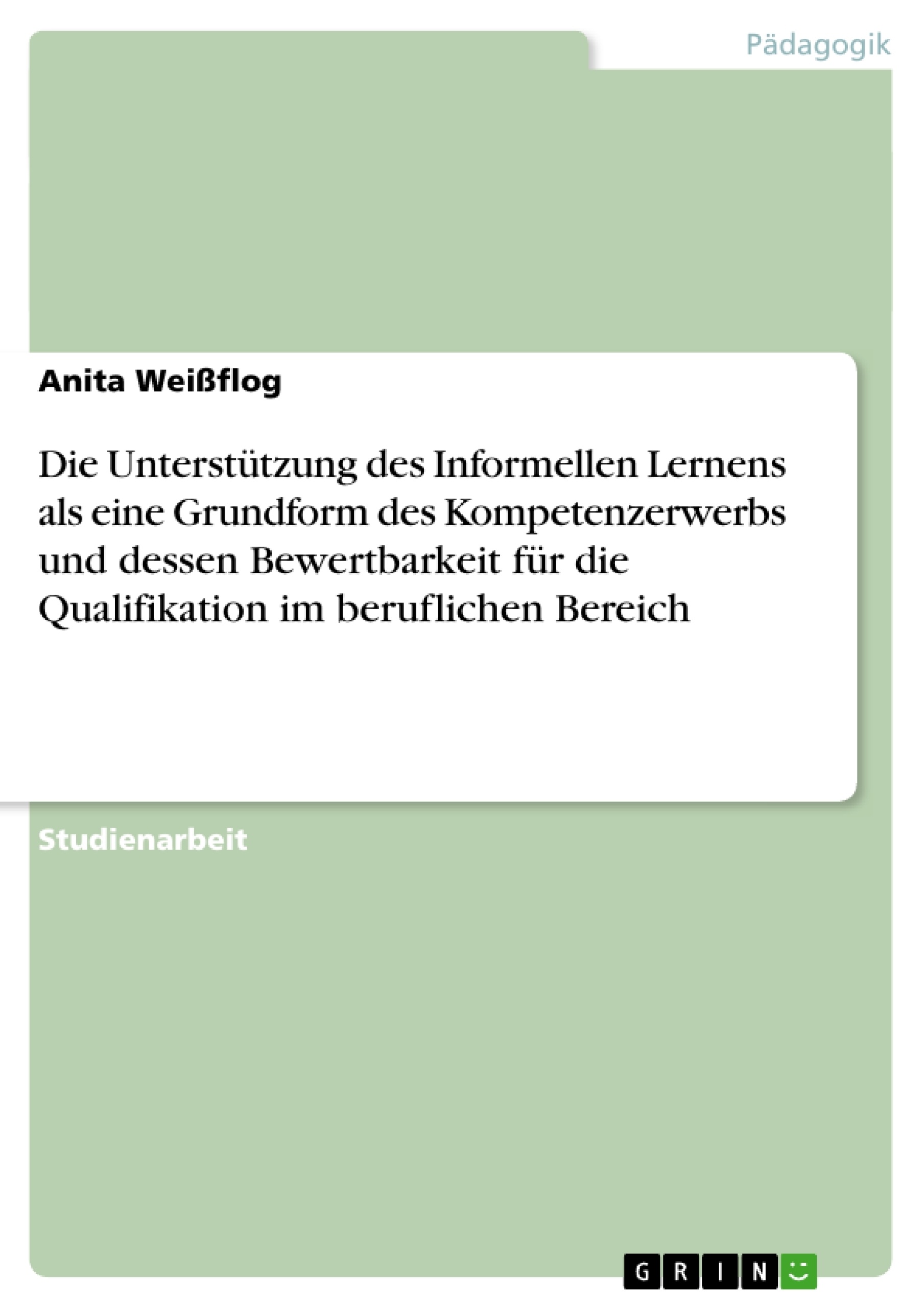Seit jeher ist Lernen ein existenzieller Aspekt im Alltagsleben der Menschen. Es soll ihnen helfen, sich die Kenntnisse und Kompetenzen anzueignen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihrer Lebens-, Arbeits- und Medienumwelt besser zu orientieren,
selbständiger zu behaupten und verantwortungsbewusster zu positionieren. Im Laufe
der Zeit hat dieser Aspekt mehr und mehr an Priorität gewonnen, da sich die Lernanforderungen zunehmend beschleunigen. Laufende Umstrukturierungen am Arbeitsplatz, immer schneller werdende Veränderungen der Arbeitsrhythmen und -orte sowie fortschreitende Globalisierung und Digitalisierung und ein weltweit
verschärfter Wettbewerb fordern ständig wieder zum Lernen, Umlernen und Weiterlernen auf. Daher wird der Ruf der humanen Bildungspolitik nach einem
Lebenslangem Lernen Aller immer lauter. Zentraler Ansatz dazu ist das Informelle Lernen (IL), welches im Alltagsleben jedes einzelnen individuell stattfindet und alle menschlichen Lernformen einzubeziehen sucht.
Vom Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wird zunehmend Kritik gegenüber dem traditionellen Schulsystem geäußert, welches die Kinder „überfüttert mit Antworten“ (Dohmen 2001) und somit ihrer natürlichen Wissbegierde beraubt ins Alltagsleben entlässt. Das IL soll hier auch dazu dienen, diese junge Neugier in einem natürlichen und privaten Lebens- und Lernumfeld jedes Einzelnen wieder aufleben zu lassen.
Doch so wichtig diese meist unbewusst erworbene Form der Kompetenzentwicklung im Leben der Lernenden auch ist, so schwierig ist auch die Messbarkeit und Bewertbarkeit des IL. Letztendlich stellt sich die Frage, wie man beispielsweise bei beruflichen Bewerbungen oder Qualifikationsanforderungen seine Qualitäten nach außen aufzeigen und vergleichbar machen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Informellen Lernens
- Versuch einer Charakterisierung - Spezielle Merkmale des IL
- Abgrenzungen verschiedener Bereiche des IL
- Die veränderten Umweltanforderungen - Warum wird IL immer wichtiger?
- Kompetenzen als ein Zusammenspiel von individueller Biographie und (Selbst-) gesteuertem Lernen
- Die Rolle von Kompetenzen in Betrieb und Aus- und Weiterbildung
- Betrachtung der Schulleistungsmessung und ihrer Übertragbarkeit auf die Bewertung von IL
- Standardisierte Schulleistungsmessungen
- Aufgabenformen für kognitive Lehrziele
- Kann eine (vergleichende) Messung von Schulleistungen objektiv, repräsentativ und fair sein?
- Das japanische Modell einer Lerngesellschaft
- Fazit
- Perspektiven – Ansätze zur Förderung der Integration IL's
- Die Rolle der Medien
- Umstrukturierungen in bestehenden Institutionen
- Bewertungsansätze des IL
- Sonstige Förderungsmaßnahmen
- Die Umsetzung von Ideen am Beispiel der Bibliothek 21 in Stuttgart
- Schlusswort - Aktuelle Bekanntgaben des BMBF
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des informellen Lernens (IL) als einer Grundform des Kompetenzerwerbs und dessen Bewertbarkeit für die Qualifikation im beruflichen Bereich. Ziel ist es, die Bedeutung des IL in einer sich stetig verändernden Arbeitswelt zu beleuchten und verschiedene Ansätze zur Bewertung und Förderung des IL zu präsentieren.
- Charakterisierung des informellen Lernens
- Bedeutung des informellen Lernens in der heutigen Arbeitswelt
- Kompetenzentwicklung durch informelles Lernen
- Bewertung und Messbarkeit informellen Lernens
- Ansätze zur Förderung der Integration informellen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des informellen Lernens ein und erläutert die Relevanz des Themas für die heutige Zeit. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und definiert den Fokus der Untersuchung.
- Der Begriff des Informellen Lernens: Dieses Kapitel liefert eine Definition des informellen Lernens und beleuchtet seine besonderen Merkmale. Es wird zwischen verschiedenen Bereichen des IL unterschieden und auf die Rolle des IL als Erfahrungslernen, implizites Lernen, Alltagslernen, selbstgesteuertes Lernen und kompetenzentwickelndes Lernen eingegangen.
- Die veränderten Umweltanforderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des IL im Kontext der sich stetig verändernden Arbeitswelt. Es wird die Bedeutung des IL im Kontext von Globalisierung, Digitalisierung und stetig wechselnden Arbeitsbedingungen dargestellt.
- Kompetenzen als ein Zusammenspiel von individueller Biographie und (Selbst-) gesteuertem Lernen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Kompetenzen, individueller Biographie und selbstgesteuertem Lernen. Es wird gezeigt, dass Kompetenzen nicht nur durch formale Bildung erworben werden, sondern auch durch lebenslange Lernerfahrungen im informellen Bereich.
- Die Rolle von Kompetenzen in Betrieb und Aus- und Weiterbildung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Kompetenzen für Unternehmen und die Bedeutung von formeller und informeller Bildung im Berufsleben. Es wird die Rolle des IL im Kontext von Aus- und Weiterbildung beleuchtet.
- Betrachtung der Schulleistungsmessung und ihrer Übertragbarkeit auf die Bewertung von IL: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Messbarkeit von informellen Lernprozessen. Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung von IL diskutiert, die sich von den traditionellen Methoden der Schulleistungsmessung abgrenzen. Es wird auf die Bedeutung von objektiven, repräsentativen und fairen Messmethoden eingegangen und das japanische Modell einer Lerngesellschaft vorgestellt.
- Perspektiven – Ansätze zur Förderung der Integration IL's: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Förderung von IL. Es werden verschiedene Ansätze zur Integration von IL in bestehende Bildungseinrichtungen und die Rolle der Medien in diesem Prozess beleuchtet.
Schlüsselwörter
Informelles Lernen, Kompetenzerwerb, Qualifikation, Berufliches Lernen, Lebenslanges Lernen, Bewertung, Messbarkeit, Förderung, Medien, Bildungseinrichtungen, Globalisierung, Digitalisierung, Arbeitswelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist informelles Lernen (IL)?
Informelles Lernen findet individuell im Alltagsleben statt. Es umfasst alle Lernformen außerhalb formaler Bildungseinrichtungen, wie Erfahrungslernen, Alltagslernen und selbstgesteuertes Lernen.
Warum gewinnt informelles Lernen in der Arbeitswelt an Bedeutung?
Durch Globalisierung, Digitalisierung und schnelle Veränderungen am Arbeitsplatz reicht formale Bildung oft nicht mehr aus. Lebenslanges Lernen und informeller Kompetenzerwerb werden essenziell.
Wie lassen sich informell erworbene Kompetenzen bewerten?
Die Messbarkeit ist schwierig. Die Arbeit diskutiert Ansätze, die sich von traditionellen Schulnoten abgrenzen, um Qualitäten für berufliche Anforderungen vergleichbar zu machen.
Gibt es internationale Vorbilder für eine "Lerngesellschaft"?
Ja, die Arbeit stellt das japanische Modell einer Lerngesellschaft vor, das informelle Bildungsprozesse stärker integriert.
Welche Rolle spielen Medien bei der Förderung von IL?
Medien und moderne Institutionen (wie die Bibliothek 21 in Stuttgart) dienen als Plattformen, um die natürliche Wissbegierde zu unterstützen und lebenslanges Lernen zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Anita Weißflog (Autor:in), 2003, Die Unterstützung des Informellen Lernens als eine Grundform des Kompetenzerwerbs und dessen Bewertbarkeit für die Qualifikation im beruflichen Bereich , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78580