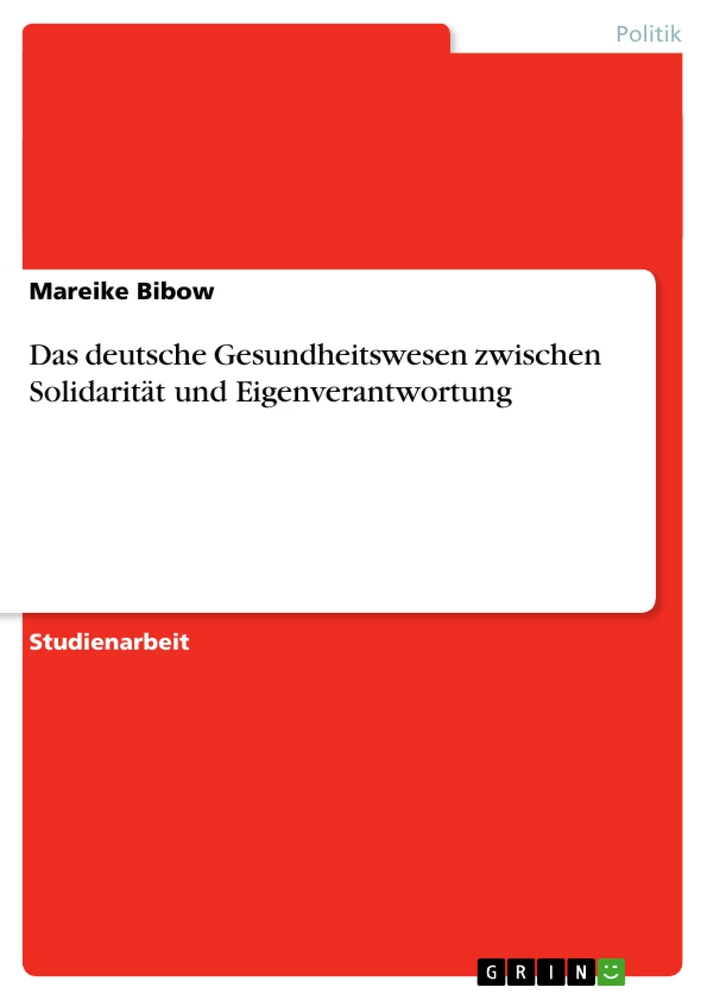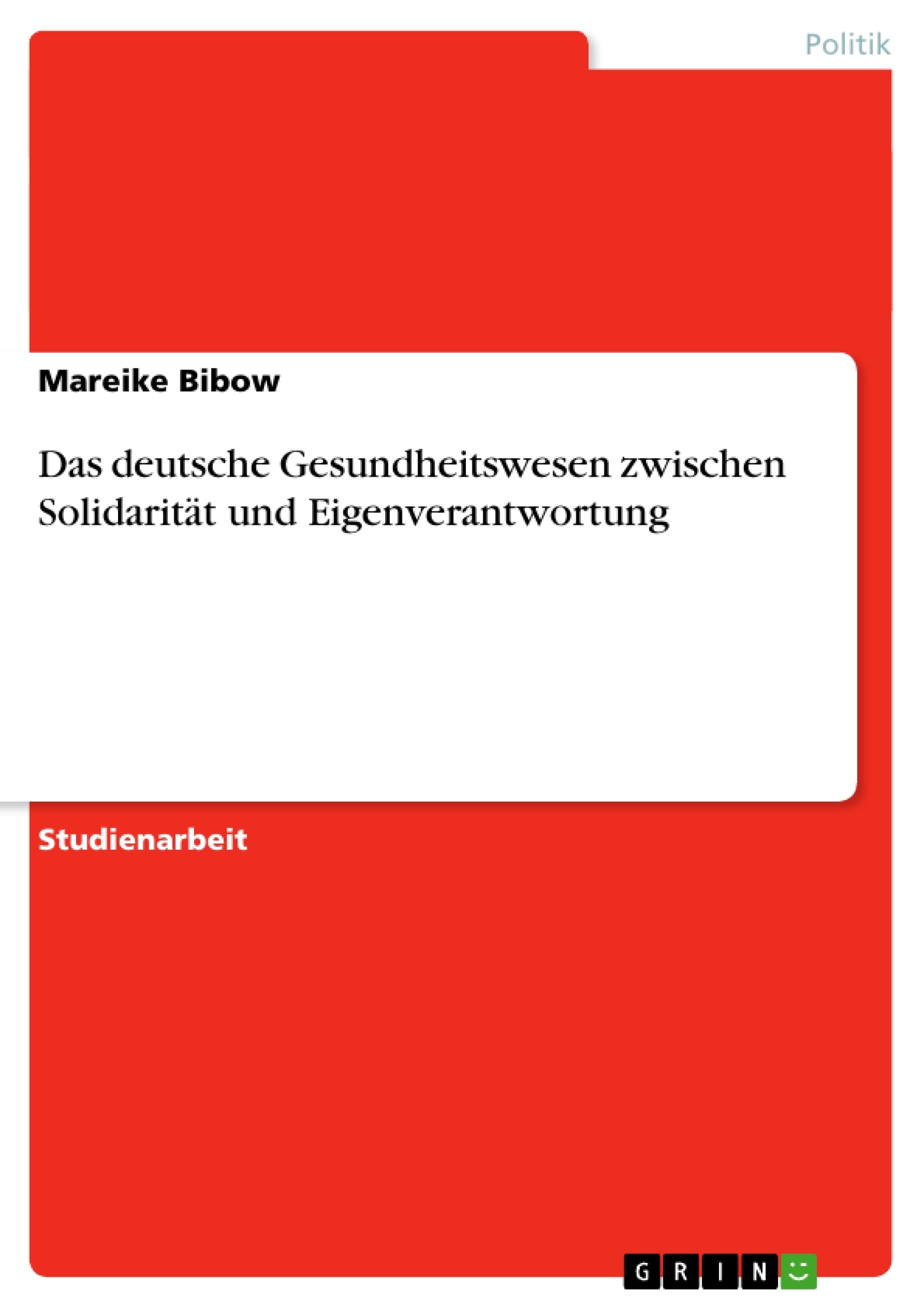Jedes hoch entwickelte Gesundheitssystem befindet sich in seiner Umsetzung irgendwo zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, dies ist keineswegs eine deutsche Eigenheit. Die Bedeutung, die den beiden vorerst gegensätzlich erscheinenden Prinzipien beigemessen wird, fällt dabei unterschiedlich aus: Das Gesundheitswesen der USA kennt kein universelles, solidarisch finanziertes, soziales Sicherungssystem. Lediglich Bedürftige und ab 65-Jährige sind staatlich für einen Teil der Gesundheitsleistungen abgesichert. Der Rest der Bevölkerung muss sich in eigener Verantwortung privat versichern. Hingegen haben einige europäische Länder, wie z.B. Großbritannien oder Schweden, Gesundheitsleistungen prinzipiell zur staatlichen Gemeinschaftsaufgabe erklärt, die jeden und jede für bestimmte Leistungen
absichert. Das Prinzip der Eigenverantwortung existiert auch in diesen Ländern – genießt aber einen wesentlich geringeren Stellenwert.
Es scheint heute, als würden die Akteure des deutschen Gesundheitswesens ein neues Gleichgewicht zwischen Solidarität und Eigenverantwortung suchen. Der Diskurs ist eingebettet in die Frage nach dem Sozialstaat: Wie viel soll und kann er noch leisten? Die Gesundheitspolitik ist daher nur ein, wenn auch eigenständiges und wichtiges, Beispiel für mehre Handlungsfelder der deutschen Sozialpolitik.
Die Gesundheitsreformen ab den 90er Jahren haben in eine neue Richtung gewiesen, der Eigenverantwortung wird offenkundig mehr Bedeutung beigemessen. Dabei stehen die Prinzipien Solidarität und Eigenverantwortung auch im Spannungsfeld zwischen Staat und Markt:
„Seit einigen Jahren dringen ins Gesundheitswesen Vokabeln ein, die aus dem Wortschatz der Ökonomen stammen: Ärzte sollen „Leistungsanbieter“, Kranke „Kunden“ sein…“1
Die Frage stellt sich, wie viel „mehr Markt“ und Eigenverantwortung gesellschaftlich und ökonomisch Sinn macht und ob das solidarische Gesundheitswesen in Deutschland wie so vieles, was den Deutschen lieb und teuer ist, nicht mehr „zukunftsfähig“ ist. Um dies zu bewerten, soll der Blick ins europäische Ausland die Perspektive erweitern und Lösungsansätze für die Schwächen im deutschen Gesundheitssystem bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Prinzip Solidarität
- Zum Prinzip Eigenverantwortung
- Gesundheit und Märkte: ein Problemaufriss
- Selber Schuld! Selber zahlen?
- Argumente für und gegen Selbstbeteiligungen
- Zur Bedeutung von Härtefallregelungen
- Gesundheitsreform 2004: Schritte zu mehr Eigenverantwortung
- Durch Gesundheitsförderung zur Eigenverantwortung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert das deutsche Gesundheitssystem im Spannungsfeld zwischen den Prinzipien der Solidarität und Eigenverantwortung. Er beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus diesem Spannungsverhältnis ergeben, und diskutiert die verschiedenen Modelle, die in anderen Ländern angewandt werden. Dabei wird insbesondere auf die aktuelle Gesundheitsreform und deren Auswirkungen auf die Rolle des Staates und der Bürger eingegangen.
- Solidaritätsprinzip im deutschen Gesundheitssystem
- Eigenverantwortung und Gesundheitsmarkt
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsreform 2004 und ihre Folgen
- Vergleich des deutschen Gesundheitswesens mit anderen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Spannungsfeld zwischen Solidarität und Eigenverantwortung im Kontext des deutschen Gesundheitssystems dar. Sie vergleicht das deutsche Modell mit anderen internationalen Systemen und stellt die Frage nach dem zukünftigen Gleichgewicht zwischen staatlicher Fürsorge und individueller Verantwortung.
Zum Prinzip Solidarität
Dieses Kapitel definiert das Prinzip Solidarität im Kontext der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems. Es beleuchtet die historischen Wurzeln der solidarischen Krankenversicherung und diskutiert die Funktionsweise des Systems sowie seine Bedeutung für den sozialen Frieden.
Zum Prinzip Eigenverantwortung
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des Prinzips der Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Es analysiert die Debatte um die Einführung von Selbstbeteiligungen, diskutiert die Argumente für und gegen diese, und beleuchtet die Rolle von Härtefallregelungen. Darüber hinaus wird die Gesundheitsreform 2004 im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Eigenverantwortung der Bürger analysiert.
Schlüsselwörter
Solidarität, Eigenverantwortung, Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik, Gesundheitsreform, Sozialstaat, Markt, Wettbewerb, Gesundheitsförderung, Prävention, Selbstbeteiligung, Härtefallregelung, Deutschland, Europa.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Solidarität und Eigenverantwortung im Gesundheitswesen?
Solidarität bedeutet die gemeinschaftliche Absicherung aller Bürger, während Eigenverantwortung fordert, dass Einzelne stärker für ihre Gesundheit und die Kosten der Behandlung aufkommen.
Wie ist das US-Gesundheitssystem im Vergleich zum deutschen aufgebaut?
Die USA haben kein universelles solidarisches System; staatliche Hilfe gibt es primär für Bedürftige und Senioren, während der Rest der Bevölkerung sich privat versichern muss.
Welche Ziele verfolgte die Gesundheitsreform 2004 in Deutschland?
Die Reform zielte auf mehr Eigenverantwortung ab, unter anderem durch die Einführung von Selbstbeteiligungen, um das solidarische System finanziell zu entlasten.
Was sind Härtefallregelungen im Gesundheitswesen?
Diese Regelungen schützen finanziell schwache Personen vor zu hohen Zuzahlungen, um den Zugang zur medizinischen Versorgung trotz steigender Eigenverantwortung zu sichern.
Kann Gesundheitsförderung die Eigenverantwortung stärken?
Ja, durch Prävention und Aufklärung werden Bürger befähigt, einen gesünderen Lebensstil zu führen und somit das Risiko für Erkrankungen selbst zu senken.
- Arbeit zitieren
- M.A. Mareike Bibow (Autor:in), 2004, Das deutsche Gesundheitswesen zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78831