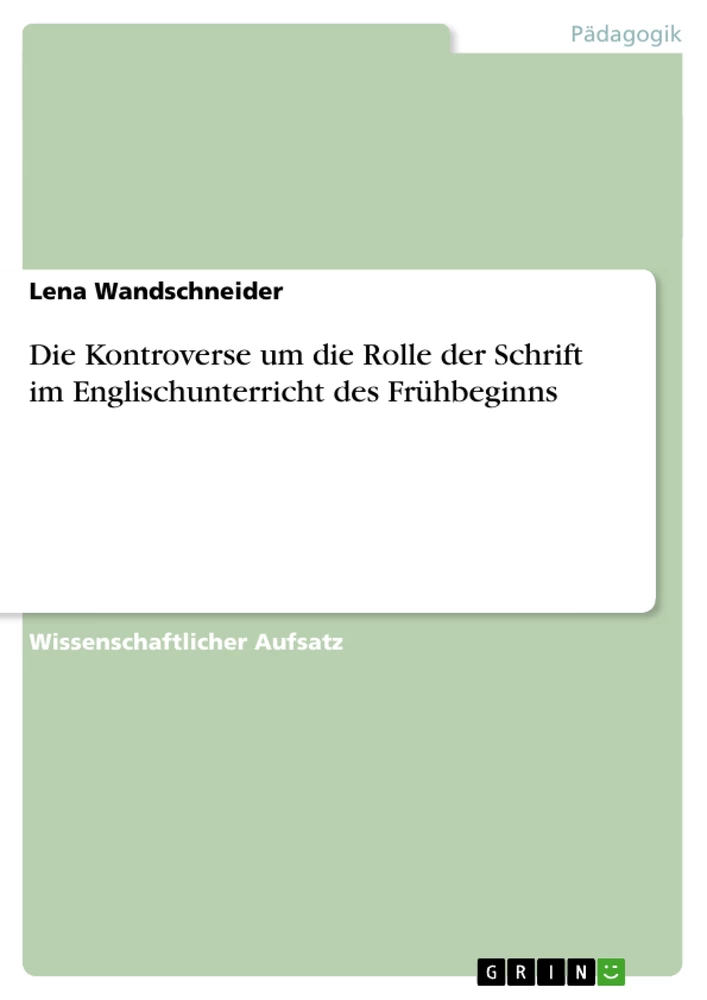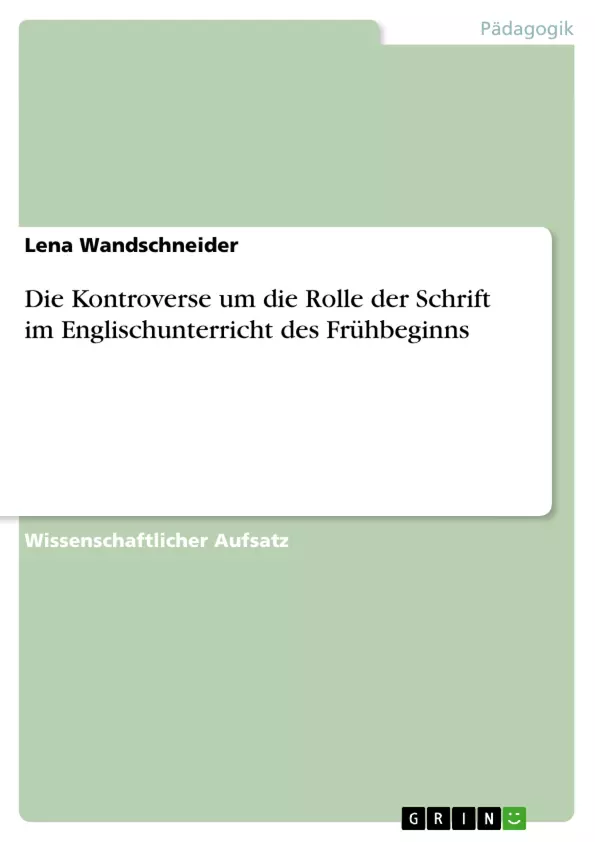Seit Mitte der 90er Jahre gehört der frühe Fremdsprachenbeginn in den Grundschulen Deutschlands zum Alltag. Aufgrund der Kulturhoheit der Länder entstanden unterschiedliche Konzepte für den Fremdsprachenfrühbeginn wie z.B. Language awareness, Lerne die Sprache des Nachbarn und Immersion, die unterschiedliche Teilzielsetzungen und Gewichtungen enthalten und sich sogar nicht ausschließlich auf Englisch beziehen.
Alle Konzepte beinhalten allerdings die Intention, den Kindern in natürlichen Kommunikationssituationen einen ersten regelmäßigen Kontakt, meist mit Englisch, zu ermöglichen. In den meisten Fällen setzt der Fremdsprachenunterricht an Grundschulen in der 3. Klasse ein. Allerdings finden sich Tendenzen zum Klasse-1-Englisch. Außerdem lässt sich die zunehmende Einführung von Leistungsbeurteilungen verzeichnen, d.h. in den meisten Bundesländern wird Englisch jetzt in Klasse 3 und 4 benotet.
Hamburg verfolgt seit Beginn der 90er Jahre den Ansatz eines ergebnisorientierten Englischunterrichts ab Klasse 3, d.h. der frühe Fremdsprachenunterricht soll direkte Vorarbeit für den Englischunterricht in den weiterführenden Schulen leisten, auch wenn er zunächst methodisch grundschulorientiert eingeführt wird. Die flächendeckende Einführung des Englischunterrichts ab Klasse 3 war 2000 abgeschlossen. Die Benotung der Englischleistungen wurde erst im Juli 2006 eingeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Didaktische Prinzipien
- Darstellung der eigenen Position…........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Kontroverse um die Rolle der Schrift im Englischunterricht der Grundschule und entwickelt eine eigene Position. Sie beleuchtet die didaktischen Prinzipien des frühen Fremdsprachenlernens, die unterschiedlichen Positionen zur Schrift im Unterricht und die Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz.
- Die Bedeutung des frühen Englischunterrichts in der Grundschule
- Die unterschiedlichen Konzepte und Ansätze des Fremdsprachenfrühbeginns
- Die Kontroverse um den Schrifteinbezug im Englischunterricht
- Didaktische Prinzipien und Leitlinien für den Umgang mit Schrift
- Die Rolle der Schrift im Fremdsprachenlernen und ihre Auswirkungen auf die kommunikative Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Geschichte des frühen Fremdsprachenbeginns in deutschen Grundschulen und erläutert die verschiedenen Konzepte, die in diesem Kontext entstanden sind. Sie stellt die unterschiedlichen Teilzielsetzungen und Gewichtungen der Konzepte sowie die allgemeine Intention dar, Kindern einen ersten regelmäßigen Kontakt mit Englisch zu ermöglichen. Das Kapitel beleuchtet außerdem die Entwicklung des Englischunterrichts in Hamburg und die Bedeutung des "Primats des Mündlichen".
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Diskussion um die Rolle der Schrift im Englischunterricht. Es untersucht die unterschiedlichen Standpunkte und Argumente bezüglich des Umfangs und Zeitpunkts der Schrifteinführung. Die Diskussion umfasst die Frage, ob ausschließlich bekannte Wörter und Sätze gelesen und geschrieben werden sollen oder ob die Lernenden auch mit unbekannten Schriftbildern konfrontiert werden sollen.
Das dritte Kapitel stellt unterschiedliche didaktische Prinzipien und Leitlinien für den Umgang mit Schrift im Englischunterricht vor. Es bezieht sich auf den Hamburger Rahmenplan und bietet einen Einblick in den Stand der Dinge.
Schlüsselwörter
Früher Fremdsprachenbeginn, Englischunterricht, Grundschule, Didaktische Prinzipien, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Kommunikative Kompetenz, Hamburger Rahmenplan, Lernen, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wann sollte die Schrift im Englischunterricht der Grundschule eingeführt werden?
Die Arbeit diskutiert die Kontroverse zwischen dem "Primat des Mündlichen" und der frühzeitigen Einbeziehung des Schriftbildes.
Was besagt der Hamburger Rahmenplan zum Englischunterricht?
In Hamburg wird ein ergebnisorientierter Ansatz verfolgt, der ab Klasse 3 gezielte Vorarbeit für weiterführende Schulen leistet.
Warum ist die Rolle der Schrift so umstritten?
Kritiker befürchten negative Auswirkungen auf die Aussprache, während Befürworter die Schrift als notwendige Stütze für das Lernen sehen.
Welche didaktischen Prinzipien gelten beim frühen Fremdsprachenlernen?
Zentrale Prinzipien sind Natürlichkeit der Kommunikation, spielerisches Lernen und die schrittweise Entwicklung der kommunikativen Kompetenz.
Gibt es eine Benotung für Englisch in der Grundschule?
In den meisten Bundesländern, wie zum Beispiel in Hamburg seit 2006, wird Englisch in der 3. und 4. Klasse benotet.
- Quote paper
- Lena Wandschneider (Author), 2007, Die Kontroverse um die Rolle der Schrift im Englischunterricht des Frühbeginns , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78923