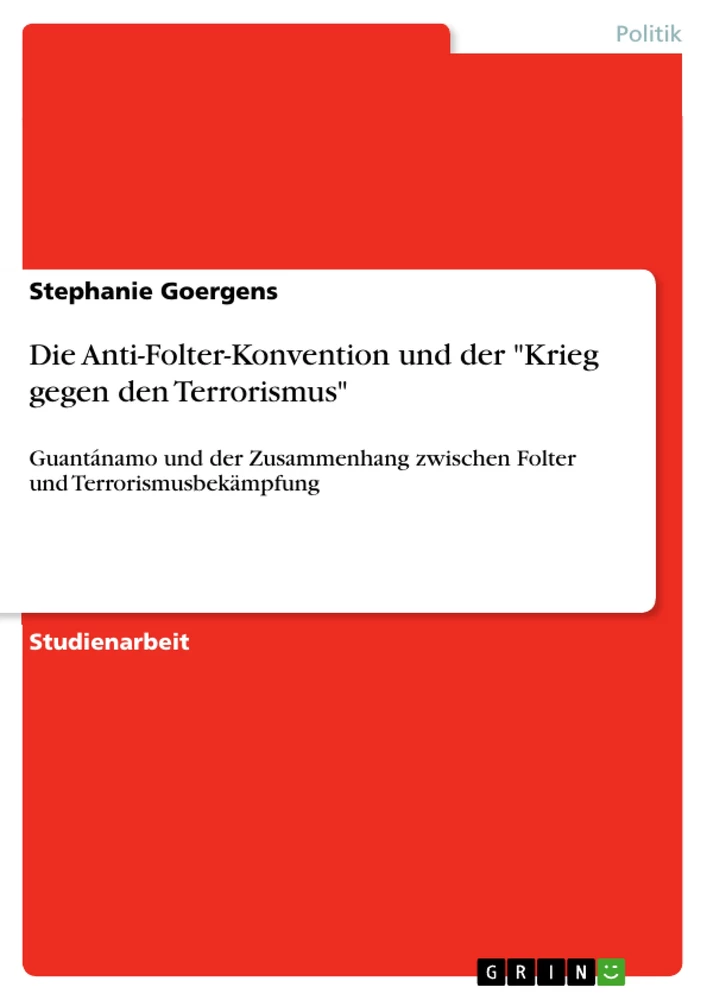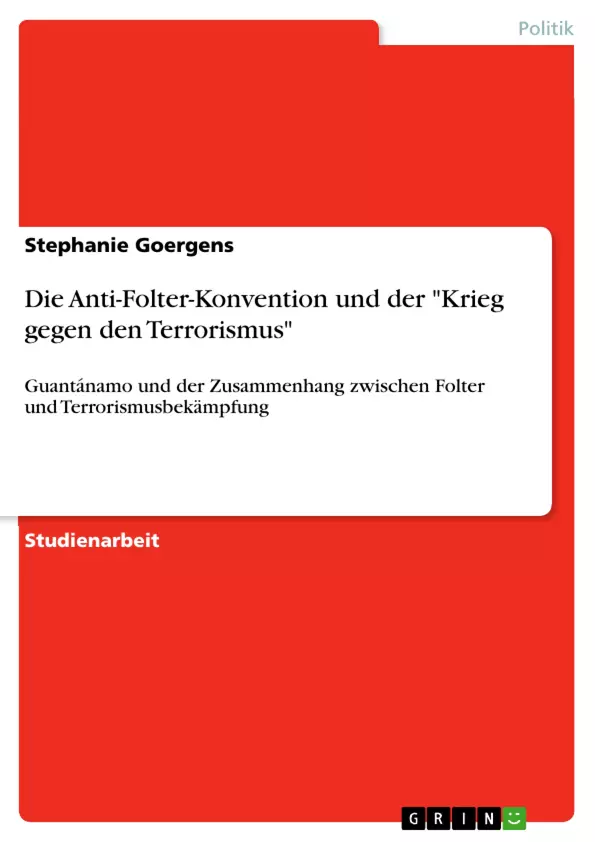1. Einleitung
Die Selbstmordattentate auf das World Trade Center am 11. September 2001 sind als schwerste Terroranschläge in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika eingegangen. Von diesem Tag an hat sich die US-amerikanische Politik gewandelt. Die Regierung erklärte, dass sich die USA im Krieg gegen den Terrorismus befinden. Kein Jahr später am 11. Januar 2002 eröffnen die USA das Hochsicherheitsgefängnis Guantánamo Bay auf Kuba. Bereits einen Tag danach kommt es zu heftiger Kritik seitens Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, welche eine unmenschliche Behandlung der Inhaftierten vorwerfen. Elf Tage später wird in der Öffentlichkeit zum ersten Mal der Verdacht der Folter in Guantánamo geäußert. Heute haben sich die Vorwürfe bestätigt, jedoch existiert das Gefängnis weiterhin.
Thema dieser Arbeit ist es mit dem Augenmerk auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu untersuchen, in welcher Beziehung Folter und Terrorismusbekämpfung stehen. Auf den ersten Blick besteht zwischen beiden Begriffen kein direkter Zusammenhang. Trotzdem werden sie spätestens nach Guantánamo in einem Satz angeführt und auch im Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen gegen Folter wird der Behandlung von Gefangenen aus dem Terrorismusbereich gesondert nachgegangen . Wenn es also so ist, dass diese Begriffe zusammengewachsen sind, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob dieser Zusammenhang begründet ist.
Zunächst werden die Begriffe der Folter und der Terrorismusbekämpfung einzeln vorgestellt und geprüft, ob eine Verbindung zum jeweiligen anderen Begriff besteht. Kapitel 2 beschäftigt sich mit Folter und gibt vorerst in 2.1 eine Definition dessen, was im Allgemeinen als Folter bezeichnet wird. Im Laufe der Arbeit ist hingegen die Festlegung der Anti-Folter-Konvention (2.2) maßgebend.
Das nächste Kapitel behandelt Terrorismusbekämpfung und beschränkt sich dabei auf den religiös motivierten Terror und auf welche Arten man diesen unterbinden kann. Danach gelangt die Arbeit an einen ersten kritischen Punkt. Die USA sind bestrebt, den rechtlichen Rahmen soweit auszudehnen und anders auszulegen, bis geächtete Praktiken wie Folter wieder anwendbar werden. Es wird sich zeigen, wie man künstlich einen Zusammenhang zwischen Folter und Terrorismusbekämpfung schaffen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Folter
- Foltern. Was heißt das?
- Die Anti-Folter-Konvention und ihr Verständnis von Folter
- Folter und Terrorismusbekämpfung
- Was heißt „Kampf gegen Terrorismus“?
- Die „Erweiterung“ des Rechtsrahmens bzw. der Maßnahmen
- Der Präzedenzfall Guantánamo
- Wie lässt sich Guantánamo bewerten?
- Guantánamo in Bezug auf die existierenden Folterhandlungen
- Guantánamo in Bezug auf die Wirksamkeit gegen Terrorismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Folter und Terrorismusbekämpfung, insbesondere im Kontext der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie untersucht, ob und inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen besteht, der insbesondere durch den Fall Guantánamo Bay deutlich wird.
- Definition und Geschichte der Folter
- Die Anti-Folter-Konvention und ihre Bedeutung
- Der Kampf gegen den Terrorismus und seine rechtlichen Rahmenbedingungen
- Die Rolle von Guantánamo Bay im Kampf gegen den Terrorismus
- Die Frage nach der Legitimität von Folter im Kontext der Terrorismusbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Ereignisse nach dem 11. September 2001, die zur Eröffnung von Guantánamo Bay führten. Es wird der Vorwurf der Folter in Guantánamo Bay aufgegriffen und die Beziehung zwischen Folter und Terrorismusbekämpfung in den Vordergrund gestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff der Folter. Es wird zunächst eine allgemeine Definition von Folter gegeben und im Anschluss daran die Definition der Anti-Folter-Konvention näher betrachtet. Die Entwicklung der Folter vom legalen Mittel zur Menschenrechtsverletzung wird beleuchtet, und es wird auf die Verbreitung von Folter in der Welt hingewiesen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Begriff der Terrorismusbekämpfung. Der Fokus liegt dabei auf dem religiös motivierten Terrorismus. Es wird untersucht, wie die USA den rechtlichen Rahmen für die Terrorismusbekämpfung erweitern und interpretieren, um geächtete Praktiken wie Folter wieder anwendbar zu machen.
Kapitel 4 untersucht den Fall Guantánamo Bay im Detail. Es wird die Frage gestellt, ob Guantánamo Bay eine aktive Hilfe bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus leistet oder ob dort Folter und unmenschliche Behandlung überwiegen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Menschenrechtspolitik und Rechtsphilosophie, wobei Folter, Terrorismusbekämpfung, Menschenrechte, Guantánamo Bay, Anti-Folter-Konvention und das Verhältnis von Recht und Gewalt im Vordergrund stehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Anti-Folter-Konvention?
Das UN-Übereinkommen gegen Folter ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Folter unter allen Umständen verbietet und die Vertragsstaaten verpflichtet, Folterprävention zu betreiben.
In welchem Zusammenhang stehen Folter und der "Krieg gegen den Terror"?
Nach dem 11. September 2001 versuchten die USA, den Rechtsrahmen so zu interpretieren, dass bestimmte Verhörmethoden nicht als Folter gelten, um Informationen zur Terrorismusbekämpfung zu gewinnen.
Was macht den Fall Guantánamo Bay so besonders?
Guantánamo gilt als Präzedenzfall, in dem Inhaftierte außerhalb des regulären US-Rechtssystems festgehalten wurden, was zu massiver Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen und Foltervorwürfen führte.
Wie definieren die USA Folter im Kontext der Terrorabwehr?
Die Arbeit untersucht, wie rechtliche Definitionen künstlich "erweitert" wurden, um Praktiken anzuwenden, die nach internationalem Standard als unmenschliche Behandlung oder Folter eingestuft werden.
Ist Folter ein wirksames Mittel gegen den Terrorismus?
Die Arbeit analysiert kritisch die Wirksamkeit dieser Methoden und stellt sie der moralischen und rechtlichen Ächtung durch die Weltgemeinschaft gegenüber.
Welche Rolle spielt religiös motivierter Terrorismus in dieser Arbeit?
Die Untersuchung beschränkt sich bei der Analyse der Terrorismusbekämpfung primär auf die Reaktionen auf religiös motivierten Terror nach 2001.
- Quote paper
- Stephanie Goergens (Author), 2007, Die Anti-Folter-Konvention und der "Krieg gegen den Terrorismus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78936