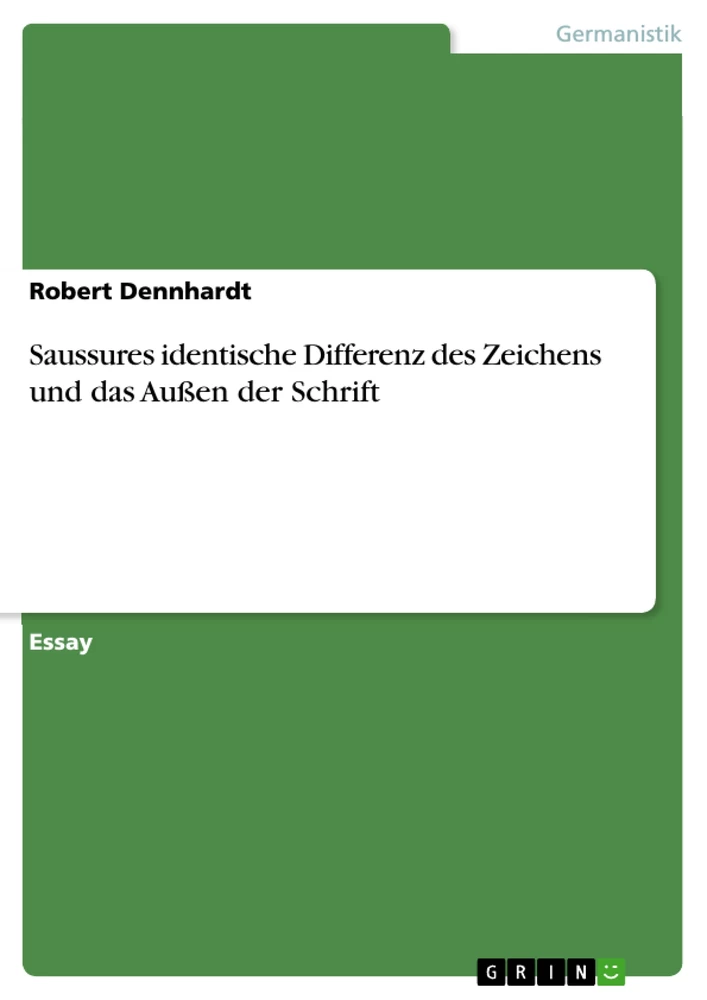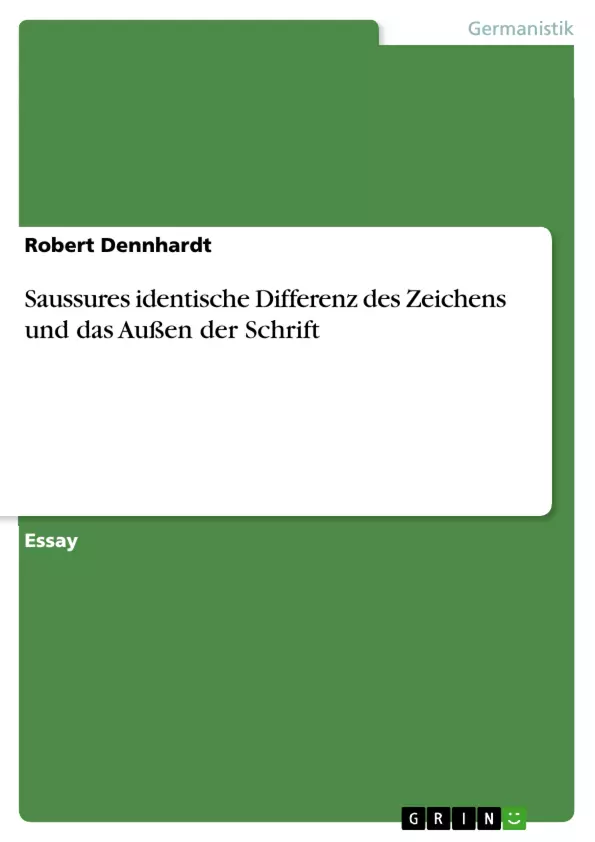Zwei Gedanken werden im Folgenden zu bedenken sein. Erstens geht es um Sassures Theorie der gleichursprünglichen Differentialität und Arbitrarität des Zeichens eines jeden semeologischen Systems sowie seine Synchronizität und Diachronizität innerhalb der Semiose, d. h. dem Prozessieren des Systems. Um es vereinfachend vorweg zu nehmen, ein semeologisches System meint schlechterdings Diskurs. Und sein Prozessieren in der Zeit meint das Generieren von Bedeutung und die Stiftung von Sinn. Zweitens werden diskursanalytische Anschlüsse mithilfe topologischer Metaphern (Moebiusband, Kleinsche Flasche) seiner Zeichenrepräsentationen zusammengedacht.
Inhaltsverzeichnis
- Saussures identische Differenz des Zeichens und das Außen der Schrift
- Diskurs und Semiose
- Topologische Metaphern der Zeichenrepräsentationen
- Saussure und der Strukturalismus
- Sprache und Schrift
- Synchrone und Diachrone Sprachbeschreibung
- Syntagma und Paradigma
- Signifikant und Signifikat
- La langue und das Zeichen
- Das Band der Assoziation
- Der sprachliche Wert eines Zeichens
- Die Arbitrarität des Zeichens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Saussures Theorie des Zeichens und beleuchtet insbesondere die Beziehung zwischen Sprache und Schrift. Er untersucht die Bedeutung von Signifikant und Signifikat, die Arbitrarität des Zeichens und die Rolle des sprachlichen Wertes.
- Die identische Differenz des Zeichens und das Außen der Schrift
- Die Beziehung zwischen Sprache und Schrift
- Die Arbitrarität und Differentialität des Zeichens
- Der sprachliche Wert und die Bedeutungseffekte im System
- Die synchrone und diachrone Perspektive auf Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in Saussures Leben und Werk. Es werden die Grundzüge seines Gedankengebäudes und die wichtigsten Begriffe erläutert, darunter das Konzept der Semeologie, die Unterscheidung zwischen Sprache und Schrift sowie die Konzepte von Signifikant und Signifikat.
Im weiteren Verlauf des Textes werden die Theorien der synchronen und diachronen Sprachbeschreibung sowie die Beziehung zwischen Syntagma und Paradigma analysiert. Der Autor beleuchtet die Bedeutung des Bandes der Assoziation zwischen Signifikant und Signifikat und erläutert die Rolle des sprachlichen Wertes.
Schließlich wird die Arbitrarität des Zeichens und die damit verbundene Unmöglichkeit einer positiven Bestimmung des sprachlichen Werts erörtert. Der Autor bezieht sich dabei auf Saussures Beispiel des französischen "mouton" und des englischen "sheep" und zeigt auf, dass die Bedeutung eines Zeichens immer im Kontext des gesamten sprachlichen Systems zu betrachten ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Semeologie, Sprachwissenschaft, Strukturalismus, Zeichen, Signifikant, Signifikat, Synchronizität, Diachronizität, Syntagma, Paradigma, Arbitrarität, sprachlicher Wert, Bedeutung, Diskurs, Semiose. Die Analyse konzentriert sich auf Saussures Theorien der Sprache und der Schrift und untersucht die Beziehung zwischen beiden, die arbiträre und differentielle Natur des Zeichens sowie die Bedeutung des sprachlichen Wertes im Kontext eines Systems.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Saussure unter Signifikant und Signifikat?
Der Signifikant ist das Lautbild (Ausdruck), während das Signifikat die Vorstellung oder das Konzept (Inhalt) eines Zeichens darstellt.
Was bedeutet die Arbitrarität des Zeichens?
Es bedeutet, dass die Verbindung zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat willkürlich ist und keiner naturgegebenen Logik folgt.
Was ist der Unterschied zwischen Synchronie und Diachronie?
Synchronie betrachtet den Zustand einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt; Diachronie untersucht die historische Entwicklung der Sprache über die Zeit.
Wie definiert Saussure den "sprachlichen Wert"?
Der Wert eines Zeichens ergibt sich nicht aus sich selbst, sondern aus seiner Differenz zu allen anderen Zeichen innerhalb des Sprachsystems.
Was ist das "Außen der Schrift" in Saussures Theorie?
Die Arbeit untersucht die problematische Beziehung zwischen der lebendigen Sprache (Parole) und ihrer Fixierung durch das System der Schrift.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2003, Saussures identische Differenz des Zeichens und das Außen der Schrift, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79012