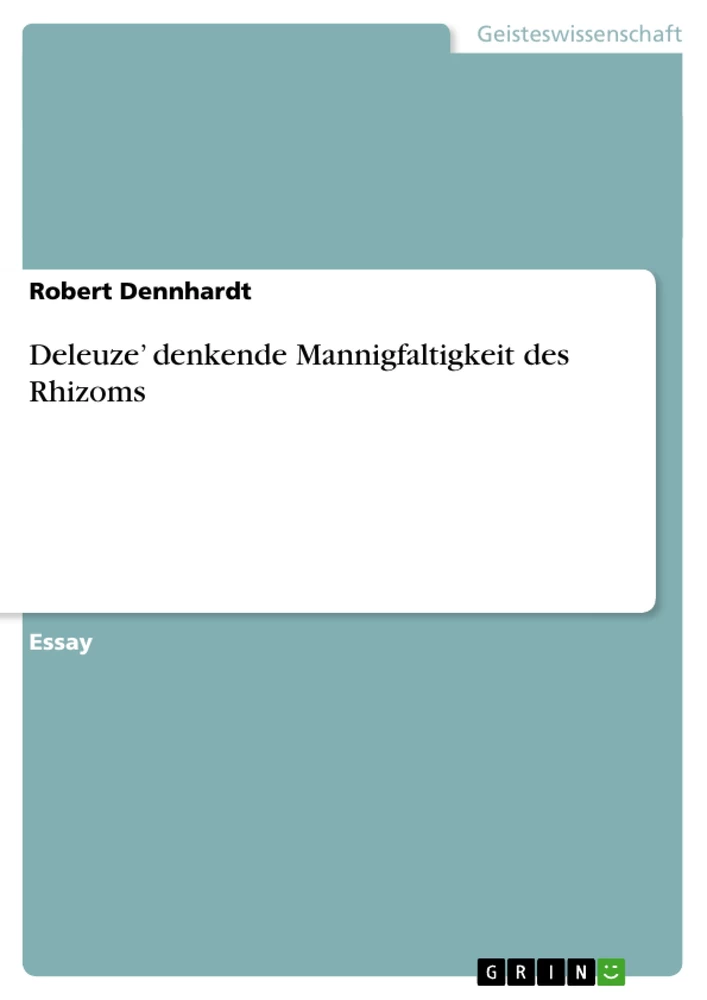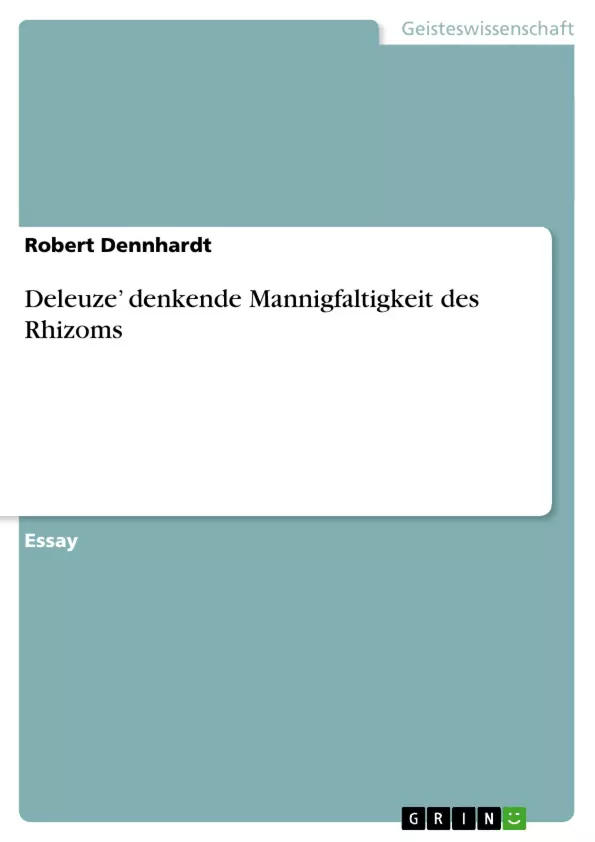Deleuze’ Werk stellt sowohl die Alleinherrschaft des Signifikanten in Frage, als auch seinen sinnvollen Gebrauch im und als Buch. Die zwanglos komponierende Schreibweise seines Buches [Der] Tausend Plateaus wird nur geregelt im und durch den Diskurs der Topologie. Dessen Aussageformationen beginnen hier in jenen Gedankenexperimenten, welche nicht nur von Derrida und Foucault postuliert wurden, um einen zugleich erkenntniserweiternden und anti-wissenschaftlichen Zenit zu markieren. Erreicht wird dieser in seinem später veröffentlichten und dem Titel nach philosophisch anmutenden Buch Logik des Sinns. Inspiriert vom labyrinthischen Kaninchenbau des Mathematikers Lewis Carroll, läßt Deleuze die Gebietsansprüche der Philosophie von rebellischen Armeen mannigfaltiger Metaphernkonstellationen unterwandern. Die Irreführung des Lesers zwischen tausend Plateaus, d. h. Mannigfaltigkeiten des Sinns als Funktion des Unsinns, bleibt Deleuze’ einziger Zweck seines literarischen Stils, der keine neue Schule sein will, sondern eine kreative Werkzeugkiste für die Relektüre des bastelnden Lesers.1 Innerhalb des Buches soll das nomadisierende Denken selbst Teil der Kriegsmaschinerie des Rhizoms werden gegen den genealogischen Baum des Staatsapparates der Philosophie.
Die formelhafte Foucaultrezeption Denken heißt Falten und seinen eigenen poststrukturalistischen Imperativ Setze keinen Punkt, ziehe eine Linie! Verbindet Deleuze in Die Falte zu einer unendlichen Linie des barocken Faltenwurfs. Als gesteigerte Bildlichkeit im Hier und Dort einer Falte schiebt sich an dieser Stelle subversiv das neue Piktorale Paradigma oder Iconic Turn (Mitchell) der kulturphilosophischen Kritik der visuellen Kultur unter Deleuze’ Denken. Alle Diskurse werden ähnlich im expressionistischen Bild einer einzigen ausdrücklichen Falte, fallen zusammen in einer einzigen diskursiven Formation des Piktoralen, d. h. in ähnlichen Variationen derselben Linie (3 obere Abb.). Das subjectum ist Teil der Falte, insofern es Summe der sich mit dem Faltenwurf verändernden Linienbrennpunkte ist (untere Abb.). (Vgl. Deleuze 2000, 30, 37. Vgl. Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch, Berlin 1965, S. 6. An dieser Stelle ließe sich vom topologischen in den mathematischen Diskurs Wechseln: Das Subjekt als Summe der die Falte formierenden Linienbrennpunkte wäre dann selbst die Summenformel der Fourier-Reihe der von der Falte beschriebenen Kurve.)
Inhaltsverzeichnis
- Deleuze' denkende Mannigfaltigkeit des Rhizoms
- Das Rhizom und seine Eigenschaften
- Die Karte und die Kopie
- Lokale Zentren und das Rhizomganze
- Das Rhizom als Antigenealogie
- Rhizom, Diskurs und Mannigfaltigkeit
- Die Wiederkehr des Selben im Differenten
- Deleuze' Konzept des Seins
- Das formlose und potentielle Mannigfaltigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Deleuzes Philosophie des Rhizoms und untersucht, wie diese Theorie die traditionelle Vorstellung von Philosophie, Diskurs und Bedeutung in Frage stellt. Er beleuchtet die zentralen Eigenschaften des Rhizoms, wie seine unendliche Vernetzbarkeit, die Antigenealogie und seine Bedeutung für ein nomadisches Denken.
- Deleuzes Rhizomtheorie
- Kritik der traditionellen Philosophie und des Diskurses
- Das nomadische Denken als Alternative
- Die Bedeutung von Karte und Kopie
- Das Wesen des Seins und die Mannigfaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Einführung in Deleuzes Konzept des Rhizoms und seiner Kritik an der traditionellen Philosophie, die er als "genealogischen Baum" betrachtet. Er argumentiert, dass das Rhizom eine neue Art des Denkens ermöglicht, die sich von den hierarchischen Strukturen des Baumes löst.
- Der zweite Teil untersucht die Eigenschaften des Rhizoms im Detail. Der Text analysiert die Rolle der Karte und der Kopie, sowie das Konzept der lokalen Zentren und das Rhizomganze. Er betont, dass das Rhizom eine Antigenealogie ist, die sich jeder Hierarchie und jeder eindeutigen Ordnung entzieht.
- Das dritte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Rhizom, Diskurs und Mannigfaltigkeit. Der Text argumentiert, dass das Rhizom ein Raum ist, der sich durch die kontinuierliche Produktion von diskursiven Intensitäten konstituiert. Er stellt die Frage, ob Deleuzes Konzept des Rhizoms dem Foucaultschen Konzept der diskursiven Formation entspricht.
- Der vierte Teil analysiert Deleuzes Konzept des Seins und der Mannigfaltigkeit, wobei er insbesondere auf die Idee der "ewigen Wiederkehr des Selben im Differenten" eingeht. Der Text beleuchtet das Würfelspiel des Zufalls und die Schwierigkeiten, die sich aus der Bejahung eines solchen Seins ergeben.
Schlüsselwörter
Deleuze, Rhizom, Philosophie, Diskurs, Mannigfaltigkeit, Karte, Kopie, Antigenealogie, nomadisches Denken, Sein, Differenz, Wiederkehr, Zufall, diskursive Formation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des „Rhizoms“ bei Deleuze?
Das Rhizom ist ein Modell des Denkens, das keine Hierarchien oder festen Zentren kennt. Im Gegensatz zum „Baum-Modell“ ist es unendlich vernetzbar und entzieht sich einer eindeutigen Ordnung.
Was versteht Deleuze unter „nomadischem Denken“?
Nomadisches Denken ist eine Form des Philosophierens, die sich gegen den „Staatsapparat der Philosophie“ richtet und feste Strukturen sowie festgelegte Bedeutungen unterwandert.
Wie unterscheidet Deleuze zwischen „Karte“ und „Kopie“?
Die Karte ist offen, verbindbar und konstruierbar, während die Kopie eine starre Reproduktion darstellt. Das Rhizom orientiert sich am Prinzip der Karte.
Welche Rolle spielt die „Falte“ in Deleuzes Werk?
Die Falte symbolisiert eine unendliche Linie und ein neues piktorales Paradigma, bei dem das Subjekt Teil eines kontinuierlichen Faltenwurfs von Linien und Brennpunkten ist.
Was ist das Ziel von Deleuzes literarischem Stil?
Deleuze will keine neue Schule gründen, sondern dem Leser eine „kreative Werkzeugkiste“ für eine subversiv-bastelnde Relektüre von Texten und Weltbildern bieten.
- Quote paper
- Dr. des. Robert Dennhardt (Author), 2003, Deleuze’ denkende Mannigfaltigkeit des Rhizoms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79017