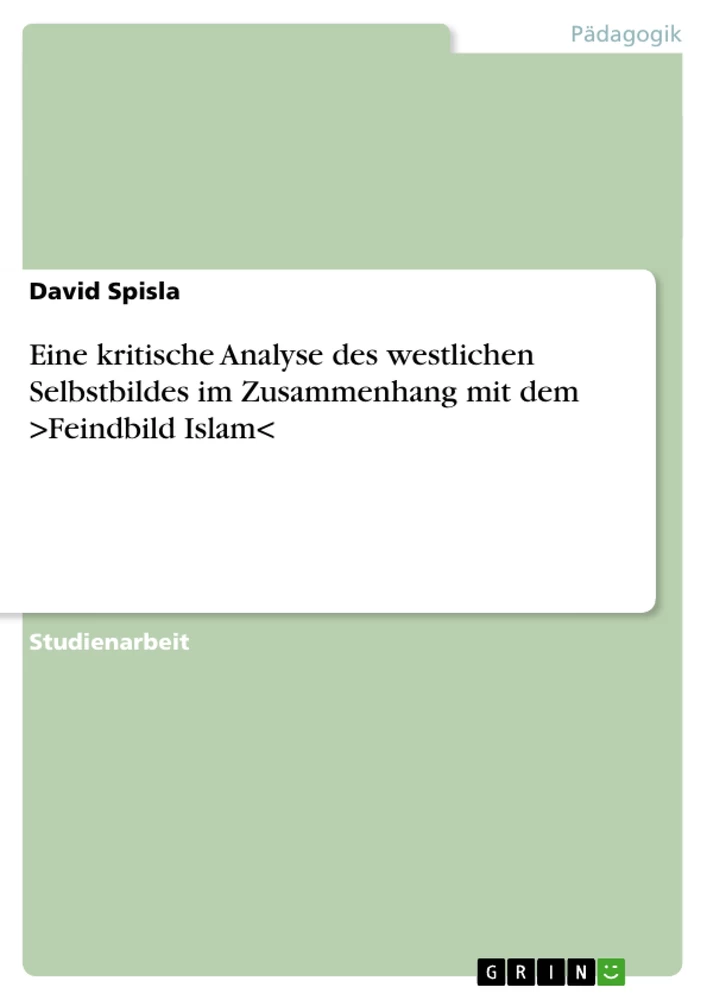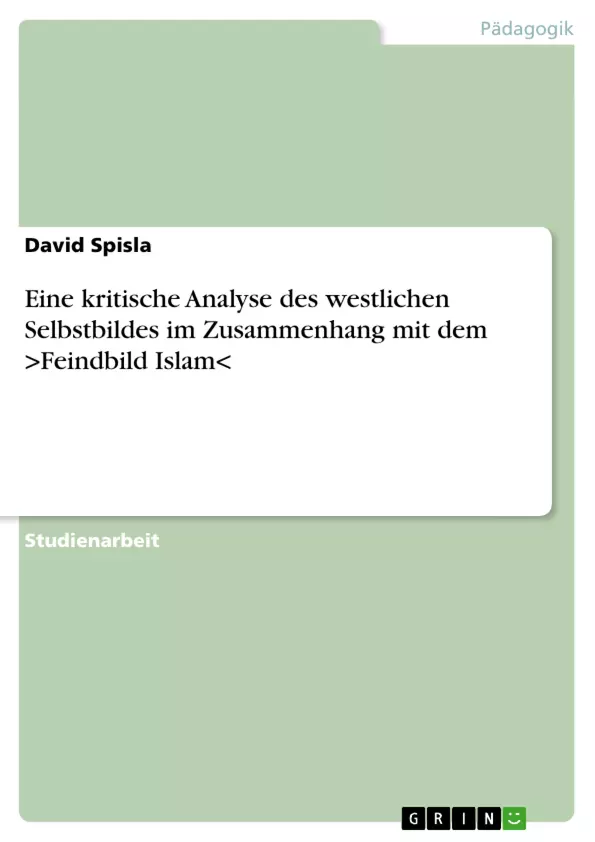Die Anschläge des 11. September 2001 auf das World Trade Center und die darauf folgenden militärischen Interventionen der USA und seinen Verbündeten gegen Afghanistan und den Irak richten in den letzten Jahren das öffentliche Interesse der westlichen Welt vermehrt auf das Konfliktpotential in den Ländern des Nahen Ostens. Hierbei ist auffällig, dass terroristische und militante Organisationen aus diesen Ländern sehr häufig in Verbindung mit der Religion des Islam gebracht werden. Begriffe wie >Heiliger Krieg<, >islamischer Fundamentalismus< und >militante Moslems< kursieren in den Medien und in der Politik und lassen die islamische Zivilisation häufig in einem negativen Licht erscheinen.
Im ersten Kapitel werden daher die eben genannten Begriffe näher untersucht. Es soll geprüft werden, auf welche Art und Weise gesellschaftliche und politische Erscheinungen in den Ländern der islamischen Welt durch die Politik und die Medien der westlichen Welt interpretiert und verarbeitet werden. In diesem Zusammenhang geht es vor allem um das Aufdecken kultureller Stereotype und Vorurteile, die ein Hindernis für einen ehrlichen interkulturellen Dialog darstellen.
Das zweite Kapitel richtet seine Aufmerksamkeit auf das Selbstbild der so genannten >westlichen Welt<. Hier soll kritisch untersucht werden, wie sich >der Westen< im Zusammenhang mit den Konflikten des internationalen Terrorismus und den politischen Unruhen des Nahen Ostens selbst darstellt.
Es sei noch angemerkt, dass es in dieser Arbeit primär darum geht stereotype Vorurteile und andere indifferente und irrationale Betrachtungsweisen, die in der öffentlichen Diskussion vorherrschen, aufzudecken. Es sollte beim Leser nicht der Eindruck entstehen der Autor betreibe eine Art Polarisierung (z.B. rationaler Westen/ fanatische Araber oder imperialer Westen/ romantisierter Orient). Offensichtliche Missstände und Widersprüche in Ländern der islamischen Welt sowie im Westen sollen weder negiert noch beschönigt werden.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich schließlich mit der Frage, welche Relevanz die Betrachtungen der ersten beiden Kapitel für den schulischen Unterricht hat. Insbesondere soll hier unterstrichen werden, dass aufgeklärte und kompetente Lehrkräfte sowie ein demokratisch strukturiertes Schulsystem einen wichtigen Beitrag für den Abbau von Vorurteilen und Konflikten leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Gibt es ein >Feindbild Islam
- 2. Die Selbstwahrnehmung des Westens im Visier der rationalen Kritik
- 2.1 Die Arroganz des Westens
- 2.2 Kritische Stimmen
- 2.3 Philosophischer Exkurs: Die Notwendigkeit einer Aufklärung der Aufklärung
- 3. Die Konsequenzen für die Pädagogik
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das westliche Selbstbild im Kontext des "Feindbildes Islam". Sie befasst sich mit der Frage, wie der Islam in der westlichen Welt wahrgenommen und interpretiert wird und welche Stereotype und Vorurteile diese Wahrnehmung prägen. Darüber hinaus wird kritisch betrachtet, wie sich der Westen selbst im Zusammenhang mit Konflikten im Nahen Osten darstellt und wie diese Selbstwahrnehmung von Intellektuellen aus islamischen Ländern gesehen wird.
- Die Darstellung des Islam als monolithischer Block in der westlichen Medienlandschaft
- Die Verwendung des Begriffs "Djihad" und seine unterschiedlichen Interpretationen innerhalb der islamischen Theologie
- Die kritische Analyse des westlichen Selbstbildes und dessen Selbstverständnis im Kontext des internationalen Terrorismus
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in der öffentlichen Debatte
- Die Bedeutung aufgeklärter Lehrkräfte und eines demokratischen Schulsystems für den Abbau von Vorurteilen und Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um den internationalen Terrorismus und den Islam und führt in das Thema der Arbeit ein. Sie stellt die zentralen Fragen und Ziele der Analyse vor.
Kapitel 1 befasst sich mit der Frage, ob es tatsächlich ein "Feindbild Islam" gibt. Es untersucht, wie gesellschaftliche und politische Erscheinungen in Ländern der islamischen Welt von der westlichen Politik und Medien interpretiert und verarbeitet werden. Dabei werden kulturelle Stereotype und Vorurteile aufgedeckt, die einen ehrlichen interkulturellen Dialog erschweren. Am Ende des Kapitels wird die Frage geklärt, ob es wirklich ein neues "Feindbild Islam" gibt.
Kapitel 2 richtet den Fokus auf das Selbstbild der "westlichen Welt". Es untersucht kritisch, wie sich "der Westen" im Zusammenhang mit den Konflikten des internationalen Terrorismus und den politischen Unruhen des Nahen Ostens selbst darstellt. Hierbei werden auch Wahrnehmungen über den Westen von Intellektuellen aus islamischen Ländern vorgestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Auswirkungen der vorherigen Kapitel auf den schulischen Unterricht. Es wird betont, dass aufgeklärte und kompetente Lehrkräfte sowie ein demokratisch strukturiertes Schulsystem einen wichtigen Beitrag für den Abbau von Vorurteilen und Konflikten leisten können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Thema des "Feindbildes Islam" und untersucht dessen Entstehung und Auswirkungen. Zentrale Schlüsselwörter sind: Islam, Stereotype, Vorurteile, Selbstbild, Wahrnehmung, Interkultureller Dialog, Internationale Beziehungen, Naher Osten, Terrorismus, Islamischer Fundamentalismus, Medien, Politik, Bildung, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es ein „Feindbild Islam“ in der westlichen Welt?
Die Arbeit untersucht, wie Medien und Politik nach dem 11. September 2001 den Islam oft monolithisch und negativ darstellen, was zur Entstehung eines Feindbildes beigetragen hat.
Wie wird der Begriff „Djihad“ missverstanden?
Oft wird er im Westen nur als „Heiliger Krieg“ interpretiert, während er in der islamischen Theologie vielfältige Bedeutungen hat, einschließlich der inneren Anstrengung zur moralischen Verbesserung.
Was kritisiert der Autor am westlichen Selbstbild?
Kritisiert wird eine gewisse „Arroganz des Westens“, die sich selbst als rein rational darstellt und dabei eigene Vorurteile und machtpolitische Interessen übersieht.
Warum ist ein interkultureller Dialog oft schwierig?
Kulturelle Stereotype und die Polarisierung zwischen einem „rationalen Westen“ und einem „fanatischen Orient“ stellen erhebliche Hindernisse für eine ehrliche Kommunikation dar.
Welche Aufgabe hat die Pädagogik beim Abbau von Vorurteilen?
Aufgeklärte Lehrkräfte und ein demokratisches Schulsystem können Schülern helfen, Medienberichte kritisch zu hinterfragen und Empathie für andere Kulturen zu entwickeln.
- Citar trabajo
- David Spisla (Autor), 2007, Eine kritische Analyse des westlichen Selbstbildes im Zusammenhang mit dem >Feindbild Islam<, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79087