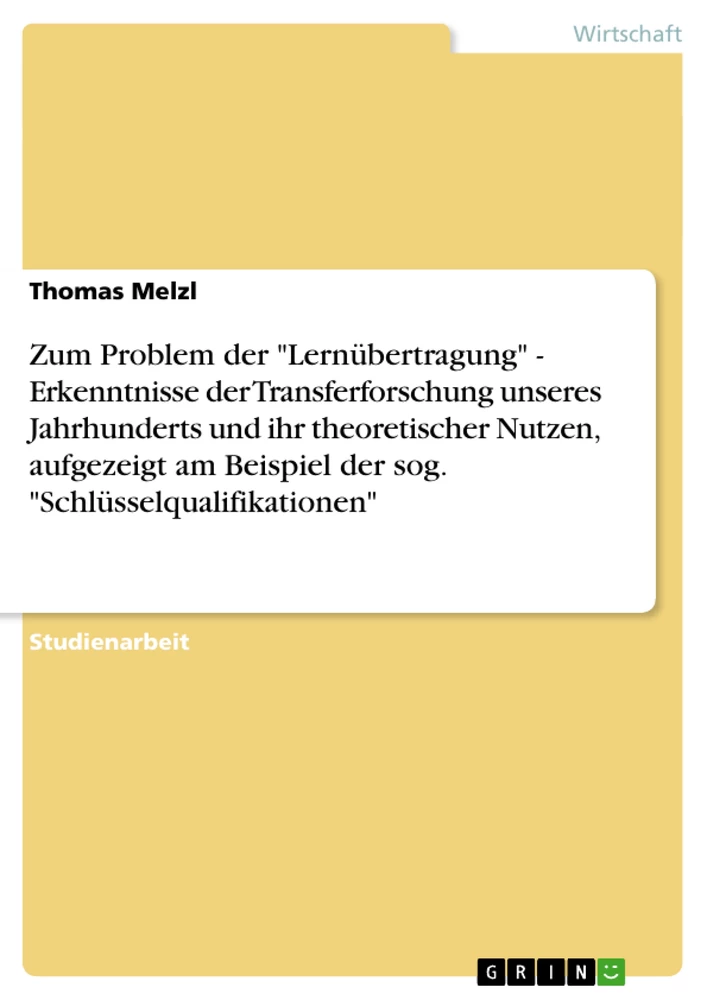„Sie bieten […] ausgeprägtes analytisches Denken, hohe eigenständige Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, Ideen zu strukturieren und durchzusetzen – überzeugendes Auftreten, Engagement und Flexibilität“, heißt es in einer Stellenanzeige der BSH-Group (siehe Anhang).
Dies sind die Anforderungen, die die heutige Arbeitswelt an den Arbeitnehmer und an die damit verbundene Berufsausbildung stellt. Die Betriebe fordern aufgrund der Schnelllebigkeit des Marktes qualifiziert ausgebildete Mitarbeiter, die die Bereitschaft mitbringen und in der Lage sind, unerwartete Probleme selbständig zu lösen.
Die fachlichen Kenntnisse rücken damit in den Hintergrund. Mertens schlägt im Konzept über die Schlüsselqualifikationen erstmals vor, einen Teil des betrieblichen Faktenwissens durch Schlüsselqualifikationen zu ergänzen. „Eine übliche Tendenz im Bildungswesen angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der speziellen Arbeitsanforderungen besteht in der Verbreiterung des Faktenwissens (Breitenbildung). Diese Tendenz bringt wegen der zunehmenden Überschaubarkeit von Fakten keinen Gewinn für eine Existenz in der Zukunft. Die Lösung liegt vielmehr eher bei der Suche nach „gemeinsamen Dritten“ von Arbeits- und sonstigen Umweltanforderungen.“ (Mertens, 1974, S. 36)
Es stellt sich also die Frage, ob Schlüsselqualifikationen betriebliches Wissen verdrängen. „Oder sollen gar Fachwissen und Arbeitsplatzkönnen durch Schlüsselqualifikationen ersetzt werden, so dass schließlich auf fachspezifisches Wissen weniger Wert zu legen wäre, da ja angesichts der Veränderungen durch neue Technologien ohnehin seine baldige Entwertung droht?“ (Reetz, 1990, S.18)
Inhaltsverzeichnis
- Aktuelle Problemstellung
- Transfer
- Definition
- Das Problem des Lerntransfers
- Lösungsansätze für das Transferproblem
- Das Modell der Schlüsselqualifikationen
- Modell nach Mertens
- Kritik und Fortführung nach Zabeck
- Kritik und Fortführung nach Reetz
- Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Problem der „Lernübertragung" und analysiert die Erkenntnisse der Transferforschung im Kontext der Schlüsselqualifikationen. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten, fachliches Wissen in die berufliche Praxis zu übertragen, und untersucht die Rolle von Schlüsselqualifikationen in diesem Zusammenhang. Sie analysiert verschiedene Modelle und Kritikpunkte im Hinblick auf die Relevanz von Fachwissen und Schlüsselqualifikationen in der heutigen Arbeitswelt.
- Transferforschung und ihre Relevanz für die Berufsausbildung
- Das Konzept der Schlüsselqualifikationen und seine Bedeutung in der Arbeitswelt
- Die Rolle von Fachwissen und Schlüsselqualifikationen in der heutigen Berufsausbildung
- Die Herausforderungen und Chancen der Lernübertragung in verschiedenen Arbeitsfeldern
- Kritikpunkte und Fortführung des Konzepts der Schlüsselqualifikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die aktuelle Problemstellung ein und beleuchtet den Wandel der Anforderungen in der Arbeitswelt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Schlüsselqualifikationen Fachwissen verdrängen oder ergänzen sollen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Transfer von Wissen, definiert den Begriff des Lerntransfers und beleuchtet die Problematik der Übertragung von theoretischem Wissen in die Praxis. Das dritte Kapitel analysiert das Modell der Schlüsselqualifikationen nach Mertens, Zabeck und Reetz und diskutiert Kritikpunkte und Weiterentwicklungen.
Schlüsselwörter
Schlüsselqualifikationen, Lerntransfer, Transferforschung, Berufsausbildung, Fachwissen, Arbeitswelt, Problemlösungskompetenz, Flexibilität, Engagement, analytisches Denken, Mertens, Zabeck, Reetz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem der „Lernübertragung“?
Es beschreibt die Schwierigkeit, theoretisch erworbenes Wissen erfolgreich in die berufliche Praxis zu übertragen (Lerntransfer).
Was sind Schlüsselqualifikationen?
Dies sind fachübergreifende Fähigkeiten wie Problemlösungskompetenz, Flexibilität und analytisches Denken, die in einer sich schnell ändernden Arbeitswelt wichtig sind.
Verdrängen Schlüsselqualifikationen das Fachwissen?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Fachwissen an Bedeutung verliert oder ob Schlüsselqualifikationen dieses sinnvoll ergänzen müssen.
Welches Konzept schlug Mertens 1974 vor?
Mertens schlug vor, angesichts unsicherer Arbeitsanforderungen Faktenwissen durch „gemeinsame Dritte“ – also Schlüsselqualifikationen – zu ergänzen.
Welche Lösungsansätze gibt es für das Transferproblem?
Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Modelle und Fortführungen nach Zabeck und Reetz, um den Lerntransfer zu verbessern.
- Citation du texte
- Thomas Melzl (Auteur), 2006, Zum Problem der "Lernübertragung" - Erkenntnisse der Transferforschung unseres Jahrhunderts und ihr theoretischer Nutzen, aufgezeigt am Beispiel der sog. "Schlüsselqualifikationen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79139