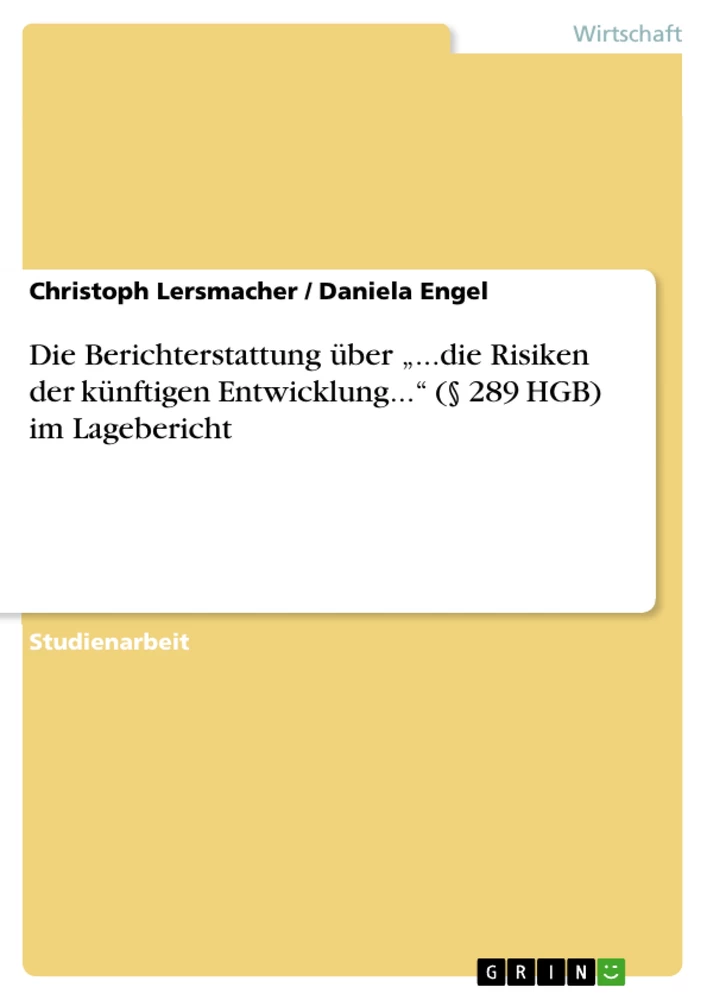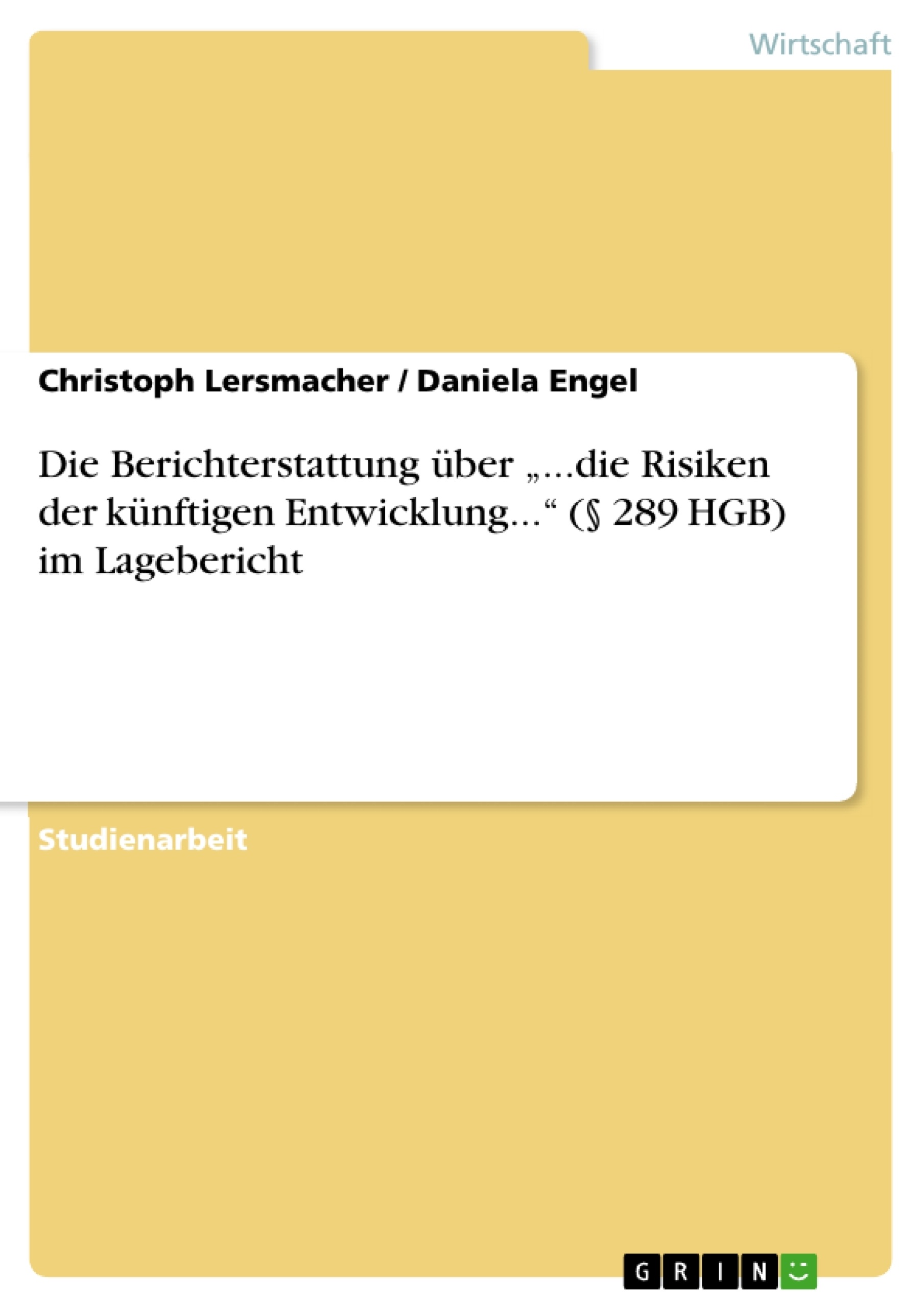Aufgrund zahlreicher Unternehmenskrisen und Insolvenzen sah sich der deut-sche Gesetzesgeber 1998 veranlasst, den Lagebericht durch das KonTraG um eine Risikoberichtspflicht zu erweitern. Die §§ 289 und 315 HGB wurden um den Halbsatz „dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen“ ergänzt. Zusätzlich wurde der Gesetzeswortlaut durch den DRS 5 und den IDW RS HFA 1 konkretisiert.
Das Ziel dieser Seminararbeit ist herauszustellen, welche inhaltlichen und formalen Anforderungen zur Darstellung der Risiken der künftigen Entwick-lung vorliegen und wie die Risiken identifiziert und bewertet werden können. Ferner werden die Risikoberichte von BMW und VW verglichen, um zu über-prüfen, ob die Anforderungen an die Risikoberichte eingehalten werden. Als Problem wird deutlich, dass durch die abstrakt gehaltenen Formulierungen der Konkretisierungen des Gesetzeswortlautes erhebliche Ermessensspielräume in Bezug auf die Anforderungen an die Risikoberichterstattung auftreten. Es be-steht eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Diese wird beim Vergleich der Risikoberichte von BMW und VW deutlich. Die formalen Anforderungen werden überwiegend eingehalten. Inhaltlich bestehen aber erhebliche Mängel, insbesondere bei der Quantifizierung der Risiken. Außerdem beschreiben die Konzerne, obwohl sie in derselben Branche agieren, in den einzelnen Kategorien unterschiedliche Risiken. Dadurch sind die beiden Risikoberichte schwer vergleichbar.
Um die Ermessensspielräume zu verkleinern, erhöhen sich die Anforderungen an den Risikobericht ab 1.1.2005. Gemäß den §§ 289 Abs. 1 und 315 Abs.1 HGB-E wird „eine Beurteilung und Erläuterung von wesentlichen Risiken und Chancen“ erforderlich. Zur Lösung der erörterten Probleme reicht die zukünftige Erweiterung nicht aus. Es sind zusätzliche Konkretisierungen des DRS 5 und der IDW Stellungnahme notwendig. Offen bleibt, ob die Risikoberichterstattung aufgrund der angesprochenen Probleme und des hohen Aufwandes bei der Identifikation und Bewertung der Risiken überhaupt Sinn macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen der Risikoberichterstattung
- 1.1. Definition des Risikobegriffs
- 1.2. Entwicklungen der gesetzlichen Regelungen
- 1.3. Zweck und Aufgaben der Risikoberichterstattung
- 2. Risikobewertung
- 2.1. Formale und inhaltliche Anforderungen an den Risikobericht
- 2.2. Berichtspflichtige Risiken
- 2.3. Stellung und Zeitraum des Risikoberichts
- 2.4. Intensität der Berichterstattung
- 3. Risikoanalyse
- 3.1. Inventur und Identifikation der Risiken
- 3.2. Kategorisierung der Risiken
- 3.2.1. Quantifizierbare Risiken
- 3.2.2. Qualifizierbare Risiken
- 4. Darstellung der Wirklichkeit der Risikoberichterstattung anhand der Unternehmen BMW und VW
- 5. Ausblick für die Risikoberichterstattung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die formalen und inhaltlichen Anforderungen an die Risikoberichterstattung gemäß den gesetzlichen Regelungen und deren Umsetzung in der Praxis. Sie analysiert die Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung und vergleicht die Risikoberichte von BMW und VW, um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit aufzuzeigen.
- Analyse der gesetzlichen Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung
- Vergleich der Risikoberichte von BMW und VW
- Bewertung der Praxisrelevanz der Risikoberichterstattung
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Risikoberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlagen der Risikoberichterstattung: Dieses Kapitel legt die Basis für das Verständnis der Risikoberichterstattung. Es definiert den Begriff des Risikos, beleuchtet die Entwicklungen der gesetzlichen Regelungen (insbesondere KonTraG) und beschreibt den Zweck und die Aufgaben der Risikoberichterstattung. Es unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung von Risiken für Investoren und andere Stakeholder. Die Entwicklung von gesetzlichen Regelungen wird im Detail nachgezeichnet, wobei der Fokus auf der Erweiterung der Berichtspflichten durch das KonTraG liegt. Die Bedeutung der klaren Definition des Risikobegriffs wird hervorgehoben, um ein einheitliches Verständnis zu gewährleisten und eine vergleichbare Berichterstattung zu ermöglichen. Die verschiedenen Zwecke der Risikoberichterstattung, wie z.B. die Risikominimierung und die Verbesserung der Transparenz, werden eingehend erklärt.
2. Risikobewertung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Risiken. Es beschreibt die formalen und inhaltlichen Anforderungen an den Risikobericht, die Berichtspflichtigen Risiken sowie den Zeitpunkt und den Umfang der Berichterstattung. Es betont die Notwendigkeit einer differenzierten Darstellung der Risiken, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigt werden müssen. Der Abschnitt über die formalen Anforderungen beleuchtet die gesetzliche Grundlage und die damit verbundenen Vorgaben hinsichtlich der Struktur und des Inhalts des Berichts. Die Diskussion der berichtspflichtigen Risiken klärt, welche Arten von Risiken im Bericht explizit zu behandeln sind. Die Aspekte des Zeitraums und der Intensität der Berichterstattung verdeutlichen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Aktualisierung und der Anpassung an die jeweilige Risikosituation. Es wird die Herausforderung der angemessenen Darstellung von Risiken ohne Über- oder Unterbewertung hervorgehoben.
3. Risikoanalyse: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der systematischen Analyse von Risiken. Es erläutert die Inventur und Identifikation von Risiken sowie deren Kategorisierung in quantifizierbare und qualifizierbare Risiken. Die Methoden zur Risikoidentifikation werden detailliert beschrieben, um eine umfassende und systematische Erfassung aller relevanten Risiken zu gewährleisten. Die Kategorisierung in quantifizierbare und qualifizierbare Risiken schafft eine Grundlage für eine differenzierte Risikobewertung und -steuerung. Die jeweiligen Methoden zur Quantifizierung und Qualifizierung werden ebenfalls erläutert, um das Verständnis für den Umgang mit unterschiedlichen Risikotypen zu verbessern. Die Bedeutung einer systematischen Vorgehensweise bei der Risikoanalyse wird betont, um die Vollständigkeit und die Aussagekraft der Risikoberichterstattung zu erhöhen.
4. Darstellung der Wirklichkeit der Risikoberichterstattung anhand der Unternehmen BMW und VW: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, die den tatsächlichen Umgang der Unternehmen BMW und VW mit der Risikoberichterstattung untersucht. Es analysiert und vergleicht die Risikoberichte beider Unternehmen, um die Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung aufzuzeigen. Der Vergleich dient dazu, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Berichterstattung aufzuzeigen und die Herausforderungen einer praxisgerechten Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu diskutieren. Die Unterschiede in der Darstellung der Risiken bei zwei Unternehmen derselben Branche werden analysiert, um die Schwierigkeiten einer standardisierten und vergleichbaren Risikoberichterstattung hervorzuheben. Die Ergebnisse der Fallstudie liefern wichtige Erkenntnisse für die Verbesserung der Risikoberichterstattung.
Schlüsselwörter
Risikoberichterstattung, KonTraG, HGB, Risikoanalyse, Risikobewertung, BMW, VW, Quantifizierung, Qualifizierung, gesetzliche Anforderungen, Diskrepanz, Transparenz, Unternehmenskrisen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Risikoberichterstattung am Beispiel BMW und VW
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die formelle und inhaltliche Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Risikoberichterstattung, insbesondere im Hinblick auf das KonTraG. Sie untersucht Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung und vergleicht die Praxis anhand der Risikoberichte von BMW und VW, um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Grundlagen der Risikoberichterstattung; 2. Risikobewertung; 3. Risikoanalyse; 4. Darstellung der Wirklichkeit der Risikoberichterstattung anhand der Unternehmen BMW und VW; 5. Ausblick für die Risikoberichterstattung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Risikoberichterstattung, von der Definition des Risikobegriffs bis hin zur praktischen Umsetzung und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Was wird im Kapitel "Grundlagen der Risikoberichterstattung" behandelt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff des Risikos, beleuchtet die Entwicklung der gesetzlichen Regelungen (insbesondere KonTraG) und beschreibt den Zweck und die Aufgaben der Risikoberichterstattung. Es betont die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung von Risiken für Investoren und andere Stakeholder.
Was sind die Schwerpunkte des Kapitels "Risikobewertung"?
Das Kapitel beschreibt die formalen und inhaltlichen Anforderungen an den Risikobericht, die berichtspflichtigen Risiken, den Zeitpunkt und den Umfang der Berichterstattung. Es betont die Notwendigkeit einer differenzierten Darstellung quantitativer und qualitativer Aspekte.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Risikoanalyse"?
Dieses Kapitel erläutert die systematische Analyse von Risiken, inklusive Inventur und Identifikation sowie die Kategorisierung in quantifizierbare und qualifizierbare Risiken. Es beschreibt Methoden zur Risikoidentifikation und deren Bedeutung für die Vollständigkeit und Aussagekraft der Berichterstattung.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Darstellung der Wirklichkeit der Risikoberichterstattung anhand der Unternehmen BMW und VW"?
Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, die den tatsächlichen Umgang von BMW und VW mit der Risikoberichterstattung untersucht und vergleicht. Es analysiert die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung und diskutiert die Herausforderungen einer praxisgerechten Umsetzung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die gesetzlichen Anforderungen an die Risikoberichterstattung, untersucht Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung, vergleicht die Risikoberichte von BMW und VW und bewertet die Praxisrelevanz der Risikoberichterstattung. Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Risikoberichterstattung, KonTraG, HGB, Risikoanalyse, Risikobewertung, BMW, VW, Quantifizierung, Qualifizierung, gesetzliche Anforderungen, Diskrepanz, Transparenz, Unternehmenskrisen.
Welche Methoden werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Seminararbeit verwendet Methoden der Analyse gesetzlicher Regelungen, der Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung sowie eine Fallstudienanalyse der Risikoberichte von BMW und VW. Ein Vergleich der Ergebnisse dient der Aufdeckung von Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im Bereich Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement. Sie ist auch von Interesse für Praktiker im Bereich der Finanzberichterstattung und des Risikomanagements.
- Quote paper
- Christoph Lersmacher (Author), Daniela Engel (Author), 2005, Die Berichterstattung über „...die Risiken der künftigen Entwicklung...“ (§ 289 HGB) im Lagebericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79230