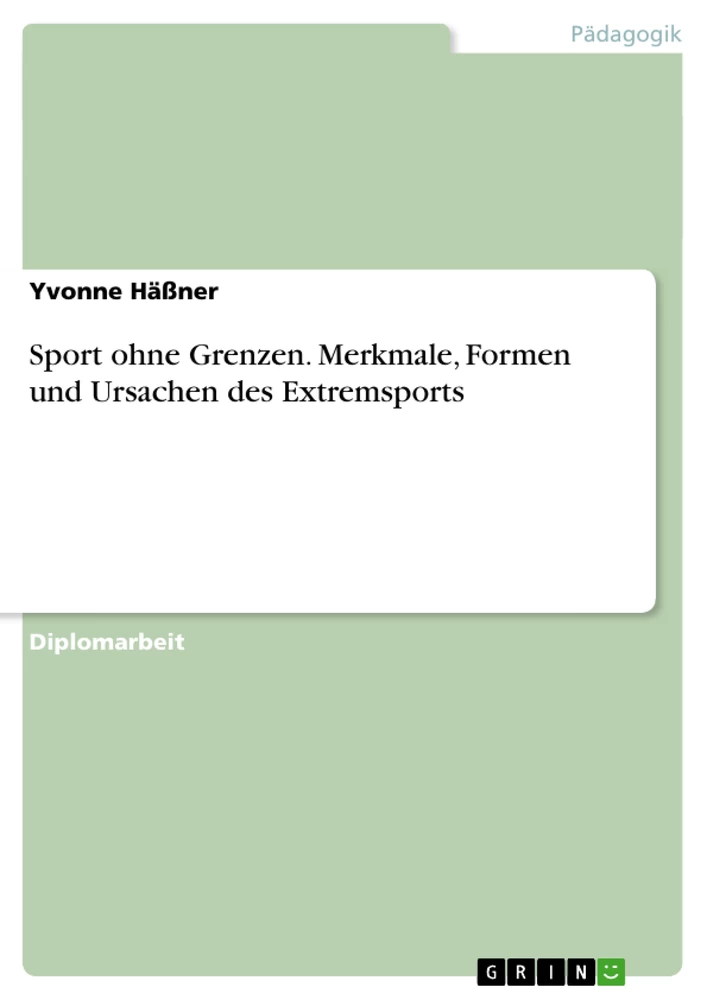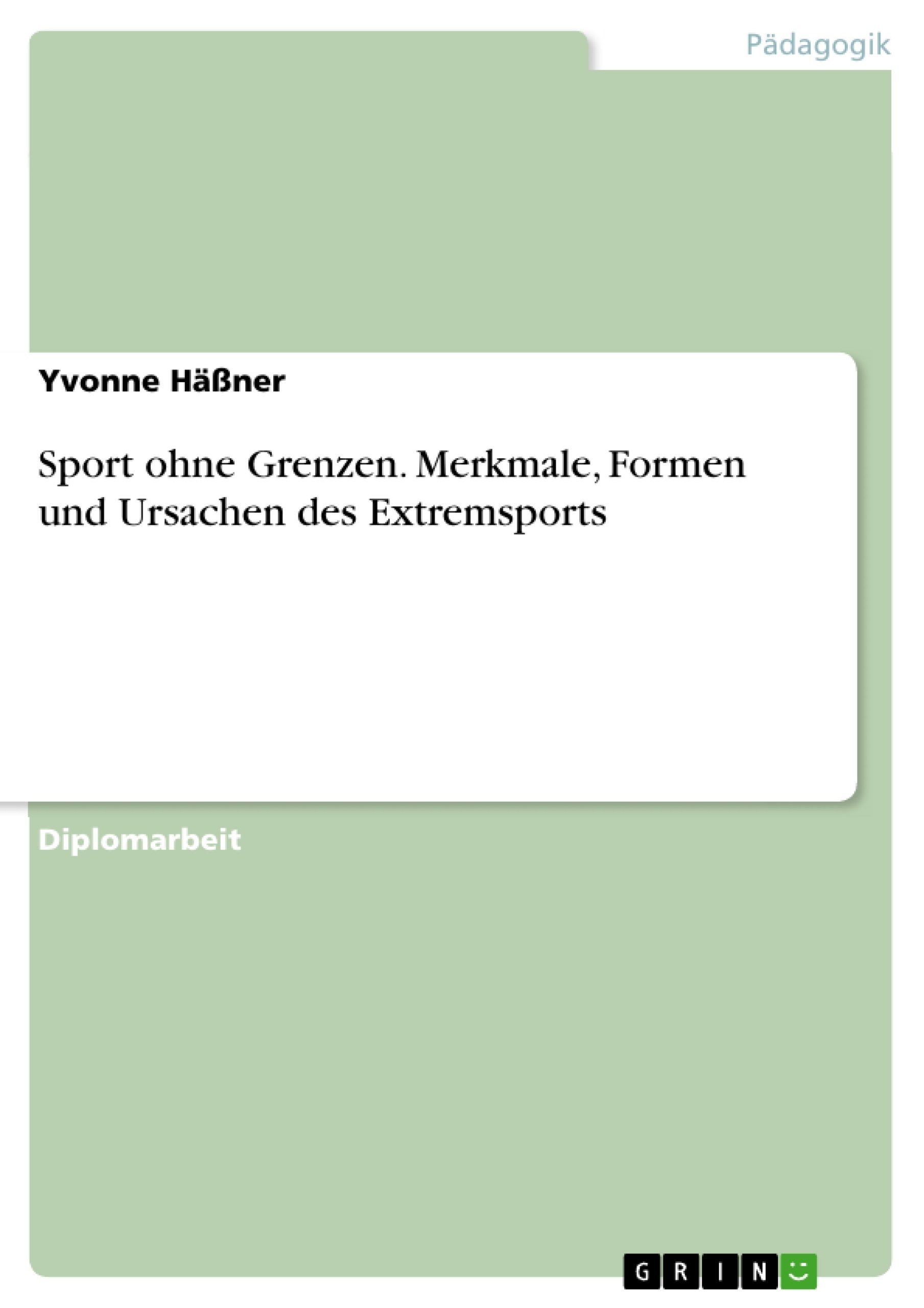Wüstenmarathon in der Sahara... Surfen auf Wellen, die größer sind als mehrstöckige Häuser... Die höchsten Berge ohne technische Hilfsmittel erklimmen... Sich aus Tausenden von Metern aus Flugzeugen fallen lassen, um kurz vor dem tödlichen Aufprall den Fallschirm zu öffnen... Im Dschungel, in den Bergen oder auf dem Meer ums Überleben kämpfen... Mit Snowboard oder Skiern in Lawinengebieten durch Tiefschnee pflügen... Ohne Sauerstoffgerät immer länger und immer tiefer tauchen...
Der Sport heutzutage scheint keine Grenzen mehr zu kennen, bzw. werden seine Grenzen immer weiter verschoben. So kommt dem offiziellen Motto der Olympischen Spiele „Citius, Altius, Fortius“ vor dem Hintergrund der modernen Extremsportarten eine ganz neue Bedeutung zu. Leistungen im Extremsport setzen sich über jegliche Beschränkungen und Regeln hinweg. Noch nicht mal der Tod als die ultimative Grenze alles Seienden wird von den Sportlern gefürchtet. Unter immer extremeren Bedingungen wird Sport getrieben und dies in immer extremeren Raum- und Zeitrelationen.
Besonders in den letzten 10 Jahren hat sich Extremsport zu einem vielbeobachteten Phänomen entwickelt. Durch die Spektakularität der Aktivitäten hat die Unterhaltungsindustrie und Werbung den Extremsport für sich nutzbar gemacht. In Form von Berichterstattungen, Kinofilmen, Büchern oder Dokumentationen wird bereits seit Jahren der ‚Flair des Abenteuerhaften’, der diesem Sport anhängt, lukrativ vermarktet. Und von wissenschaftlicher Seite gibt es mittlerweile einige Publikationen über die Gründe für das Ausüben von Extremsport. Darüber hinaus erfreuen sich viele Extremsportarten wachsenden Zulaufs und es macht den Eindruck, dass beinahe täglich eine neue Extremsportart erfunden wird.
Auch auf mich wirkten die Extremsportarten schon immer anziehend. Besonders die Extremität der Tat, die den Sportler von der Masse abhob und ihn zu einem verwegenen Rebellen gegen die Naturgesetze und gesellschaftlichen Normen machte, faszinierte mich dabei. Aus meinem Umfeld hörte ich dagegen oft, dass ‚solche Leute’ nur lebensmüde Verrückte sein könnten. Um die Faszination des Extremsports zu ergründen, lag es nah meine Diplomarbeit über dieses Thema zu schreiben. Durch einen Job als Sicherheits-Supervisor im Hochseilgarten, den ich seit einigen Monaten ausübe, konnte ich mich noch mal intensiver mit den Themen Risiko und Sicherheit auseinandersetzten. Zwar handelt es sich beim gesicherten Klettern in den Bäumen nicht um einen Extremsport, trotzdem wurden durch das Klettern in 12 Meter Höhe einige Theorien plausibel.
Da heutzutage sehr heterogene Verhaltensweisen unter dem Begriff „Extremsport“ verstanden werden, inklusive dem Extrembügeln (vgl. www.funsporting.de/Sports/crazy_sports/Extreme_Ironing/extreme_ironing.html), möchte ich mich in den ersten Kapiteln der Frage widmen, was Extremsport ist. Zunächst soll dabei in Kapitel 2 geklärt werden, was unter dem Begriff „Sport“ im wissenschaftlichen Kontext verstanden wird. Danach werden bisherige Definitionsversuche des Extremsportbegriffs dargestellt, um anschließend eine eigene Definition vorzustellen. In Kapitel 3 möchte ich dann näher auf die Phänomenologie der verschiedenen Formen des Extremsports eingehen. Hierzu habe ich aus den beiden Extremsportkategorien „Risikosport“ und „extremer Belastungssport“, die aus der eigenen Definition hervorgehen, exemplarisch einige Sportarten ausgewählt. Um die Entstehung der Extremsportarten zu ergründen, beschäftigt sich Kapitel 4.1. mit dem gesellschaftlichen Wandel, der maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung dieser Handlungspraxen genommen hat. Kapitel 4.2. beleuchtet danach den Einfluss der Gesellschaft auf das Bedürfnis des Individuums Extremsport zu praktizieren. Ein Überblick über die bisherigen subjektorientierten Ansätze und Konzepte zur Erklärung von extremsportlichem Verhalten wird in Kapitel 5 gegeben. Hierbei wird insbesondere auf Risikoverhalten eingegangen. In Kapitel 6 werden dann die Aspekte Sucht, Lebensstil und Jugendliches Risikoverhalten in Verbindung mit Extremsport behandelt. Abschließend wird in Kapitel 7 ein Modell der Einflussfaktoren auf die Ausübung von Extremsport vorgestellt. Hierbei werden einige der in der Arbeit dargestellten Ursachenfaktoren, die auf die Entscheidung und Motivation des Individuums, Extremsport auszuüben, Einfluss nehmen, in Beziehung zueinander gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Extremsport“ - Versuch einer definitorischen Erfassung
- 2.1. Zum Sportbegriff
- 2.1.1. Herkunft des Wortes „Sport“
- 2.1.2. Definitionen von Sport
- 2.2. Bisherige Deutungen und Abgrenzungsversuche des Begriffs „Extremsport“ in der Literatur
- 2.3. Eigene Definition
- 3. Extremsportarten: Ein Überblick
- 3.1. Phänomenologie
- 3.2. Risikosport
- 3.2.1. Big Wave Surfing
- 3.2.2. B.A.S.E.-Jumping
- 3.2.3. Freiklettern/ Freeclimbing
- 3.3. Extremer Belastungssport
- 3.3.1. Abenteuerrennen/ Adventure Racing
- 3.3.2. Triathlon und Ultramarathon
- 3.3.3. Distanzschwimmen
- 4. Extremsport als Folge von gesellschaftlichem Struktur- und Wertewandel
- 4.1. Gesellschaftlicher Wandel
- 4.1.1. Der Ökonomische Aufschwung und seine Folgen
- 4.1.2. Wertewandel: Von der Leistungsorientierung zur Freizeitorientierung
- 4.1.3. Individualisierung
- 4.1.4. Die Erlebnisgesellschaft
- 4.1.5. Sport in der Gegenwartsgesellschaft
- 4.2. Gesellschaftlicher Wandel und Extremsport
- 4.2.1. Suche nach Spannung und Risiko
- 4.2.2. Außergewöhnliche Körpererfahrungen
- 4.2.3. Selbstermächtigung
- 4.2.4. Distinktion und Prestige
- 4.2.5. Sinn- und Heilssuche
- 4.2.6. Kontrastive Naturabenteuer
- 4.2.7. Gesellschaftsflucht und Nonkonformismus
- 5. Subjektorientierte Theorien
- 5.1. Risikoverhalten und Evolution
- 5.2. Risikosport als Triebhandlung
- 5.3. Reizsuche-Konzepte
- 5.3.1. Das optimale Erregungsniveau
- 5.3.2. Die Psychologie des „schützenden Rahmens“
- 5.4. Identitätsstörungen, Traumata und Angstbewältigung
- 5.5. Motivationen
- 5.5.1. Das Flow-Erlebnis
- 5.5.2. Sinnsuche: Wagen in wachsenden Ringen
- 5.5.3. Grenz- und Erlebnissuche
- 6. Sucht, Lebensstil und jugendliches Risikoverhalten
- 6.1. Suchtverhalten im Extremsport
- 6.1.1. Sport als stoffungebundene Sucht
- 6.1.2. Sucht im Risikosport
- 6.1.3. Lauf- und Ausdauersucht
- 6.2. Extremsport und Lebensstil
- 6.3. Übergangsrituale, Initiationsriten und Mutproben
- 7. Schlussfolgerungen
- 7.1. Das Einflussfaktorenmodell
- 7.2. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Phänomen Extremsport. Ziel ist es, den Begriff Extremsport zu definieren, verschiedene Extremsportarten zu kategorisieren und die gesellschaftlichen und individuellen Ursachen für dessen Ausübung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen, wie Wertewandel und Individualisierung, auf die Entstehung und Verbreitung von Extremsportarten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Extremsport“
- Kategorisierung und Beschreibung verschiedener Extremsportarten
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Entwicklung des Extremsportes
- Individuelle Motivationen und psychologische Aspekte extremsportlichen Verhaltens
- Zusammenhang zwischen Extremsport, Sucht und Lebensstil
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Extremsportes ein und beschreibt dessen zunehmende Popularität und die damit verbundene Faszination. Sie umreißt die Forschungsfrage der Arbeit und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel.
2. „Extremsport“ - Versuch einer definitorischen Erfassung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Sport“ und analysiert bestehende Definitionen und Abgrenzungsversuche des Begriffs „Extremsport“ in der Literatur. Es mündet in eine eigene, präzise Definition des Begriffs, die die Grundlage für die weitere Arbeit bildet.
3. Extremsportarten: Ein Überblick: Kapitel 3 präsentiert einen Überblick über verschiedene Extremsportarten, kategorisiert nach Risikosport und extremen Belastungssport. Es beschreibt exemplarisch ausgewählte Sportarten aus beiden Kategorien, beleuchtet deren Charakteristika und verdeutlicht die Vielfalt extremer sportlicher Aktivitäten.
4. Extremsport als Folge von gesellschaftlichem Struktur- und Wertewandel: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Entstehung und Verbreitung von Extremsport. Es werden Aspekte wie ökonomischer Aufschwung, Wertewandel, Individualisierung und die Erlebnisgesellschaft beleuchtet und in Bezug zu den Bedürfnissen gesetzt, die durch Extremsport befriedigt werden.
5. Subjektorientierte Theorien: Kapitel 5 bietet einen Überblick über subjektorientierte Theorien, die extremsportliches Verhalten erklären. Es werden Konzepte wie Risikoverhalten, Reizsuche, das optimale Erregungsniveau und die Bedeutung von Identität, Traumata und Angstbewältigung im Kontext von Extremsport diskutiert.
6. Sucht, Lebensstil und jugendliches Risikoverhalten: Hier wird der Zusammenhang zwischen Extremsport, Suchtverhalten und Lebensstil untersucht. Die Kapitel analysieren verschiedene Aspekte von Sucht im Zusammenhang mit Extremsport und beleuchtet den Einfluss auf den Lebensstil sowie den Zusammenhang mit jugendlichem Risikoverhalten.
Schlüsselwörter
Extremsport, Risikosport, extremer Belastungssport, Gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung, Erlebnisgesellschaft, Risikoverhalten, Reizsuche, Motivation, Sucht, Identität, Flow-Erlebnis, Sinnsuche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Extremsport
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht das Phänomen Extremsport. Ziel ist die Definition des Begriffs, die Kategorisierung verschiedener Sportarten und die Analyse der gesellschaftlichen und individuellen Ursachen für dessen Ausübung.
Wie wird der Begriff „Extremsport“ definiert?
Die Arbeit analysiert bestehende Definitionen von „Extremsport“ in der Literatur und entwickelt eine eigene, präzise Definition, die als Grundlage für die weitere Analyse dient. Der Prozess beinhaltet die Betrachtung des allgemeinen Sportbegriffs und Abgrenzungsversuche gegenüber anderen Sportarten.
Welche Extremsportarten werden betrachtet?
Die Arbeit kategorisiert Extremsportarten in Risikosportarten (z.B. Big Wave Surfing, BASE-Jumping, Freiklettern) und Extremen Belastungssport (z.B. Adventure Racing, Triathlon, Ultramarathon, Distanzschwimmen). Ausgewählte Sportarten werden exemplarisch beschrieben.
Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche Wandel auf Extremsport?
Die Arbeit untersucht den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen wie ökonomischer Aufschwung, Wertewandel (von Leistungs- zu Freizeitorientierung), Individualisierung und die Erlebnisgesellschaft auf die Entstehung und Verbreitung von Extremsport. Es wird analysiert, wie diese Faktoren die Bedürfnisse befriedigen, die durch Extremsport gestillt werden.
Welche individuellen Motivationen und psychologischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet subjektorientierte Theorien, die extremsportliches Verhalten erklären. Dazu gehören Konzepte wie Risikoverhalten, Reizsuche (inkl. optimales Erregungsniveau und der „schützende Rahmen“), die Bedeutung von Identität, Traumata, Angstbewältigung, das Flow-Erlebnis und die Sinnsuche.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Extremsport, Sucht und Lebensstil dargestellt?
Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Extremsport und Suchtverhalten (stoffgebunden und -ungebunden), untersucht den Einfluss auf den Lebensstil und beleuchtet den Zusammenhang mit jugendlichem Risikoverhalten und Übergangsritualen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Extremsport, Risikosport, extremer Belastungssport, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung, Erlebnisgesellschaft, Risikoverhalten, Reizsuche, Motivation, Sucht, Identität, Flow-Erlebnis, Sinnsuche.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition von Extremsport, Überblick über Extremsportarten, Extremsport und gesellschaftlicher Wandel, Subjektorientierte Theorien, Sucht, Lebensstil und jugendliches Risikoverhalten, sowie Schlussfolgerungen mit einem Einflussfaktorenmodell und Fazit.
Gibt es ein Fazit und einen Ausblick?
Ja, die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick, der die Ergebnisse zusammenfasst und potentielle zukünftige Forschungsrichtungen aufzeigt.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Extremsportarten?
Kapitel 3 der Arbeit bietet einen detaillierten Überblick und Beschreibungen ausgewählter Extremsportarten, kategorisiert nach Risikosport und extremen Belastungssport.
- Citar trabajo
- Yvonne Häßner (Autor), 2006, Sport ohne Grenzen. Merkmale, Formen und Ursachen des Extremsports, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79235