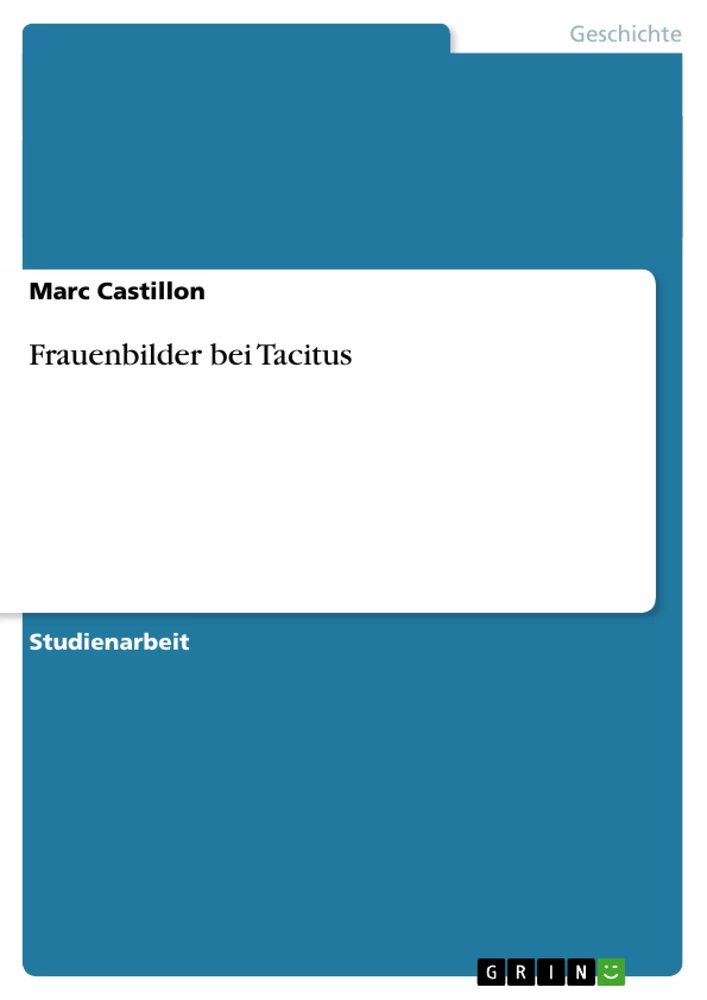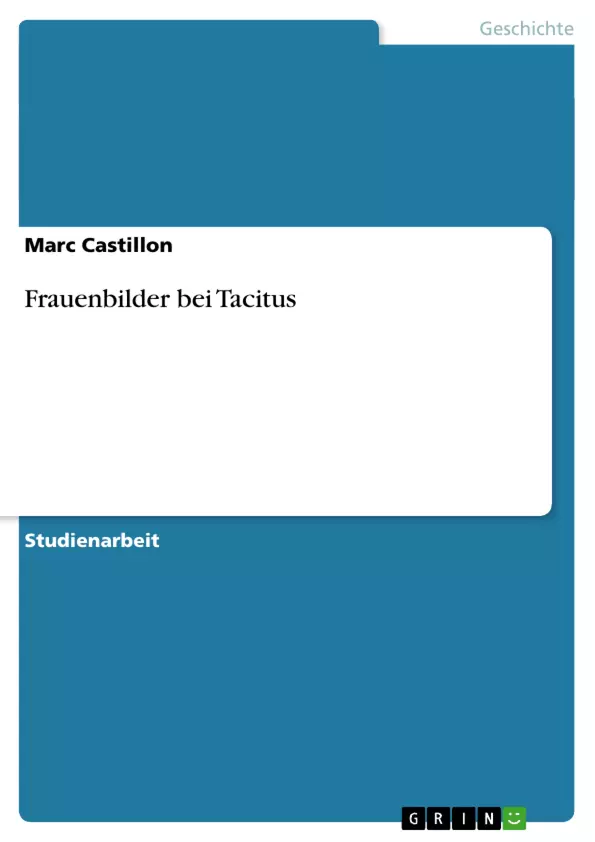Cornelius Tacitus, der von zirka 55 bis 120 n. Chr. lebte, wird vielerorts als einer der größten Geschichtsschreiber im antiken Rom beschrieben. In diesem Büchlein werden die Frauenbilder bei Tacitus erfasst, erläutert und bewertet. Der gewählte Buchtitel lässt vor dem Hintergrund, dass Tacitus sein eigenes Urteil meist sorgfältig hinter der Darlegung der Widersprüchlichkeiten seiner Zeit zurückhielt, offen, wie die Frauenbilder anteilig zu werten sind, eher aufgrund der von Historikern im weiteren Rahmen als objektiv eingeschätzten Geschichtsschreibung des Tacitus oder aber eher in Bezug auf das private Frauenbild des Tacitus, sprich auch aufgrund seiner suggestiv erkennbaren subjektiven Meinung.
Die unter Historikern vertretene These, dass Frauen das Bild der römischen Geschichte, anders als männliche Hauptpersonen, nicht aufgrund von Posten und Machtpositionen imponieren, sondern einzig allein als Frauen, erscheint hier weiterhelfend. Tacitus Bild von Frauen muss hier jedoch én detail beleuchtet werden. Deshalb wird im Folgenden ein konkreter Fall nach dem anderen untersucht, denn zumindest ist doch fraglich, ob oben genannte These tatsächlich auch auf alle Frauen zutrifft. Es bestehen hier doch Zweifel, ob der bei Tacitus dargestellte Mensch, respektive die Frau, sich dem Spannungsfeld von Mächten und Gruppen entziehen konnte und sich damit rein durch seine Persönlichkeit gewürdigt sieht. Diese Grundgedanken werden in diesem Büchlein zu klären sein.
Neben historischen Zügen werden auch frauensoziologische Ansätze diese Untersuchung tragen. Ziel dieser gesellschaftshistorischen Darstellung ist es, die Frau als Individuum innerhalb einer Gruppe darzustellen. Eine repräsentative Untersuchung des Frauenbildes kann methodisch jedoch nur weitgehend im Rahmen des damaligen Verständnisses von familia und domus erfolgen, da Frauen zum ganz überwiegenden Teil nur dort präsent waren. Außerdem war das spezielle Frauenbild des Tacitus durch seine Gesichtskreisfixierung vor allem auf die oberen Gesellschaftsschichten und auf das Kaiserhaus des 1. Jh. n. Chr. eingeengt. Die Frauenbilder des Tacitus werden hier dennoch breit gefächert dargestellt, werden diese doch anhand dreier unterschiedlicher Untersuchungsfelder analysiert und bewertet: 1.) Das taciteische Frauenbild der Frauen im domus unter sich. 2.) Das Bild der Frau-Mann-Beziehungen, am Beispiel der Livia. 3.) Das Germanenfrauenbild des Tacitus außerhalb der römischen Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Forschungsstand zu den Frauenbildern bei Tacitus
- II. Tacitus Bild römischer Frauen
- 1. Interaktionäre Beziehungen zwischen Frauen innerhalb der domus
- a) Positive unberechnete Beziehungen
- b) Positive berechnete Beziehungen
- c) Negative berechnete Beziehungen
- d) Zwischenergebnis
- 2. Interaktionäre Beziehungen zwischen Frau und Mann innerhalb der domus
- a) Liviabild bei Tacitus
- b) Historische Würdigung des Liviabildes bei Tacitus
- c) Zwischenergebnis
- 1. Interaktionäre Beziehungen zwischen Frauen innerhalb der domus
- III. Frauenbild der Germaninnen bei Tacitus
- 1. Sittsamkeit der Germaninnen
- 2. Frauenverehrung
- 3. Zwischenergebnis
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Frauenbildern des römischen Geschichtsschreibers Tacitus. Ihr Ziel ist es, diese Bilder zu erfassen, zu erläutern und zu bewerten. Die Analyse betrachtet dabei sowohl das Bild der Frauen innerhalb der römischen Gesellschaft als auch die Darstellung von Germaninnen. Der Fokus liegt auf den individuellen Rollen und Beziehungen von Frauen innerhalb der römischen Familie und der domus sowie auf der Frage, inwieweit sich das Frauenbild des Tacitus von den allgemeinen Auffassungen der Zeit unterscheidet.
- Das taciteische Frauenbild in der römischen domus
- Die Beziehung zwischen Frauen und Männern in der römischen Gesellschaft
- Das Frauenbild der Germaninnen bei Tacitus
- Die Rolle von Macht und Einfluss in der Konstruktion der Geschlechterrollen
- Der historische Kontext und die Bedeutung des Frauenbildes für die gesellschaftliche Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Tacitus als Historiker und die Thematik der Arbeit vor. Kapitel I behandelt den Forschungsstand zu den Frauenbildern bei Tacitus. In Kapitel II werden die Frauenbilder des Tacitus innerhalb der römischen Gesellschaft beleuchtet. Kapitel II.1 analysiert die Interaktionen zwischen Frauen innerhalb der römischen Familie, während Kapitel II.2 die Beziehungen zwischen Frauen und Männern, am Beispiel von Livia, beleuchtet. Kapitel III widmet sich den Frauenbildern der Germaninnen bei Tacitus, insbesondere deren Sittsamkeit und Frauenverehrung.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Frauenbildern bei Tacitus, insbesondere mit den Rollen und Beziehungen von Frauen innerhalb der römischen Familie und der domus. Sie beleuchtet außerdem die Darstellung von Germaninnen und deren kulturelle Besonderheiten. Schlüsselbegriffe sind: Tacitus, Frauenbilder, Römisches Frauenbild, Germaninnen, domus, familia, Geschlechterverhältnisse, Geschichte, Historiographie, gesellschaftliche Interpretation.
- Quote paper
- Marc Castillon (Author), 2002, Frauenbilder bei Tacitus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7927