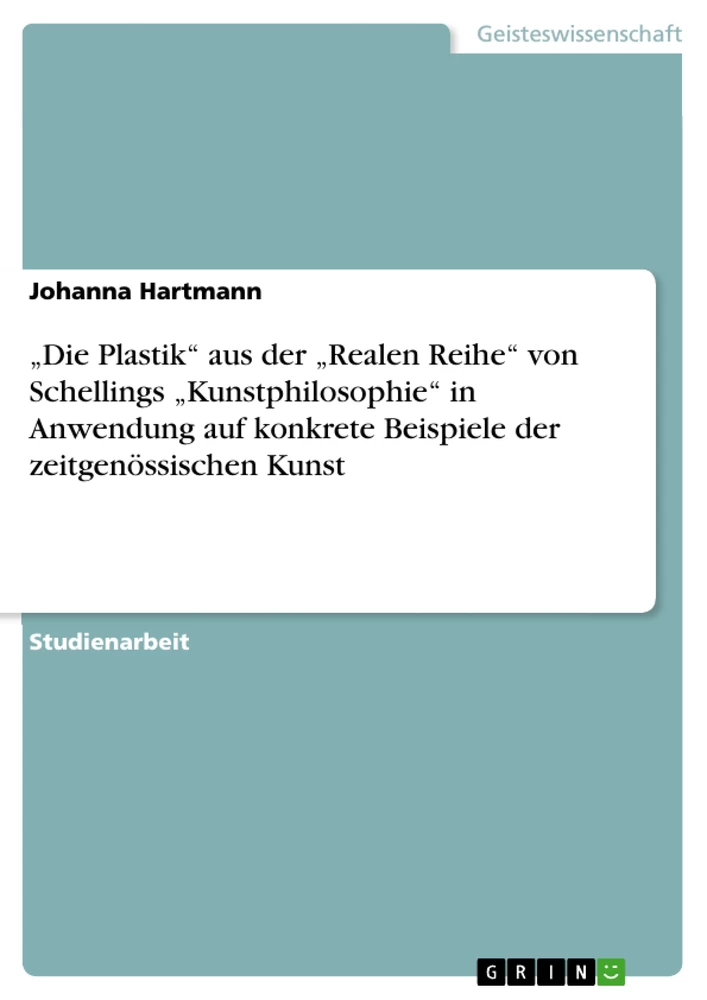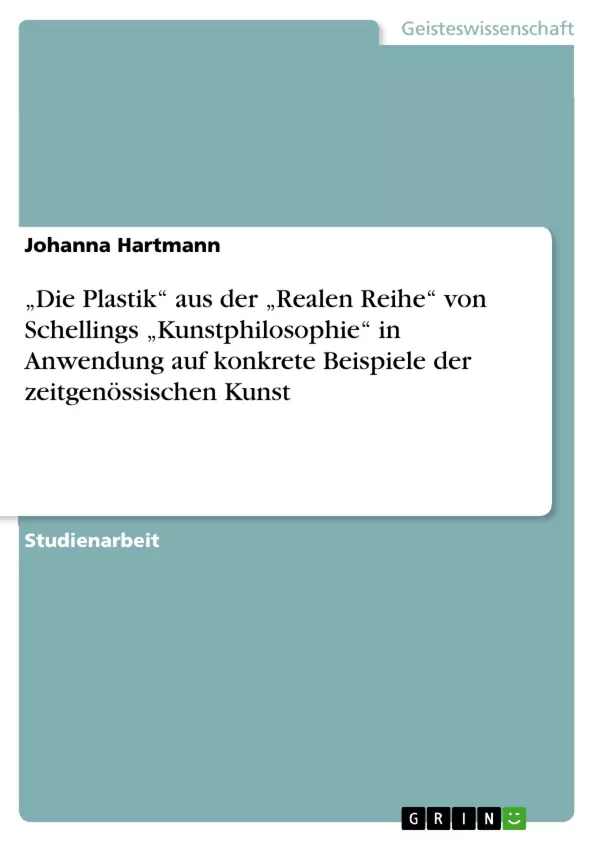Zunächst soll es darum gehen die Plastik in den Kontext von Schellings Kunstphilosophie stellen. Dabei beschäftigt die Frage weshalb Schelling eine solche überhaupt bearbeiten will und welche Aufgabe sie hat. Das bietet zunächst den großen Rahmen, von dem aus die Stellung der Plastik im System der Kunstphilosophie erläutert wird, um dann die Plastik an sich zu behandeln. Nachfolgend werden das Kunstwerk und das Kunstprodukt nach Schelling näher erläutert, um dann zu einer Interpretation der Kunst McCarthys durch Schelling überzugehen. Dabei soll Schellings „Philosophie der Kunst“ auf McCarthys „Selbstbildnis“ von 2005 als konkretes Beispiel angewendet werden. Interessant ist hierbei, ob Schellings „Kunstphilosophie“ von 1802 auch auf ein Kunstwerk von 2005 bezogen werden kann. Der Vergleich zwischen Schelling und Herder soll zeigen, wie verschiedenartig man mit der Betrachtung der Plastik umgehen kann, auch wenn man eine ähnliche Kunstauffassung vertritt. Zwei Beispiele von Paul McCarthy und Ron Mueck sollen in der Folge auf Herders Vorstellung der Plastik in Abgleich zu Schelling bezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Schellings Beweggründe zur Bearbeitung der Wissenschaft der Kunst
- Die Aufgabe der „Kunstphilosophie“
- Die reale und ideale Seite der Kunst und Ihre Indifferenz
- Die Plastik als Einheit von: Architektur, Basrelief und Plastik
- Die Architektur
- Das Basrelief
- Die Plastik
- Die Potenzen:
- Das Kunstwerk: Versuch einer Gattungsbeschreibung:
- Das Kunstprodukt, das Genie und der Charakter des Kunstprodukts
- Die Anwendung Schellings auf ein konkretes Beispiel aus der ,,realen Reihe❝ der Kunst
- Schelling in Anwendung auf Paul McCarthy
- Schelling und Herder- Ein Vergleich
- Herder in Anwendung auf Ron Mueck und McCarthy (siehe Abbildung 1-3)
- Schlussbemerkung:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Plastik im Kontext von Schellings Kunstphilosophie und analysiert die Bedeutung des Mediums innerhalb des Systems der Kunstphilosophie. Die Arbeit befasst sich mit Schellings Beweggründen für die Bearbeitung der Kunstwissenschaft und der Aufgabe der Kunstphilosophie. Sie untersucht das Kunstwerk und das Kunstprodukt im Rahmen von Schellings Theorie und wendet die Theorie anschließend auf konkrete Beispiele aus der zeitgenössischen Kunst an. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Paul McCarthys "Selbstbildnis" aus dem Jahr 2005 und die Frage, ob Schellings Kunstphilosophie von 1802 auch auf ein Kunstwerk des 21. Jahrhunderts angewendet werden kann. Darüber hinaus werden die Perspektiven von Schelling und Herder auf die Plastik im Vergleich beleuchtet.
- Schellings Kunstphilosophie und ihre Anwendung auf die Plastik
- Die Bedeutung von Kunst im Kontext der Natur und der Kultur
- Die Rolle von Ideen, Potenzen und dem Absoluten in der Kunst
- Analyse von Paul McCarthys "Selbstbildnis" (2005) im Licht von Schellings Theorie
- Vergleich von Schellings und Herders Kunstauffassung anhand von Beispielen zeitgenössischer Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Plastik in den Kontext von Schellings Kunstphilosophie und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt Schellings Beweggründe für die Bearbeitung der Kunstwissenschaft. Es geht dabei um Schellings Auffassung von Kunst als einem „geschlossenen, organischen Ganzen“ und die Bedeutung des „Kunstsinns“ für das Verstehen von Kunst. Das dritte Kapitel widmet sich der Aufgabe der „Kunstphilosophie“, welche darin besteht, das Reale der Kunst im Idealen darzustellen. Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Potenzen und erläutert, wie die Philosophie in ihrer vollkommenen Erscheinung in der Totalität aller Potenzen zum Ausdruck kommt. Das vierte Kapitel diskutiert die reale und ideale Seite der Kunst und ihre Verbindung. Das fünfte Kapitel widmet sich der Plastik als Einheit von Architektur, Basrelief und Plastik und geht auf die Potenzen dieser Kunstformen ein. Das sechste Kapitel behandelt das Kunstwerk im Sinne von Schellings Theorie.
Schlüsselwörter
Schelling, Kunstphilosophie, Plastik, Architektur, Basrelief, Kunstwerk, Kunstprodukt, Potenzen, Absolute, Idee, Paul McCarthy, Selbstbildnis, Ron Mueck, Herder
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Schellings „Kunstphilosophie“ in Bezug auf die Plastik?
Schelling untersucht die Plastik als Teil seines Systems der Kunstphilosophie, wobei er sie als Einheit von Architektur, Basrelief und Plastik im engeren Sinne betrachtet.
Kann Schellings Theorie von 1802 auf moderne Kunst angewendet werden?
Ja, die Arbeit zeigt dies am Beispiel von Paul McCarthys „Selbstbildnis“ aus dem Jahr 2005.
Wie unterscheiden sich Schelling und Herder in ihrer Sicht auf die Plastik?
Trotz ähnlicher Grundauffassungen gibt es Unterschiede in der methodischen Betrachtung, die in der Arbeit anhand von Beispielen von Ron Mueck und Paul McCarthy verdeutlicht werden.
Was versteht Schelling unter dem „Genie“?
Das Genie ist in Schellings Theorie der Schöpfer des Kunstprodukts, das durch den Charakter des Werkes zum Ausdruck kommt.
Welche Rolle spielen die „Potenzen“ in der Kunst?
Potenzen sind Stufen der Darstellung des Realen im Idealen, die Schelling nutzt, um die verschiedenen Gattungen der Kunst einzuordnen.
- Quote paper
- Magister Artium Johanna Hartmann (Author), 2006, „Die Plastik“ aus der „Realen Reihe“ von Schellings „Kunstphilosophie“ in Anwendung auf konkrete Beispiele der zeitgenössischen Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79270