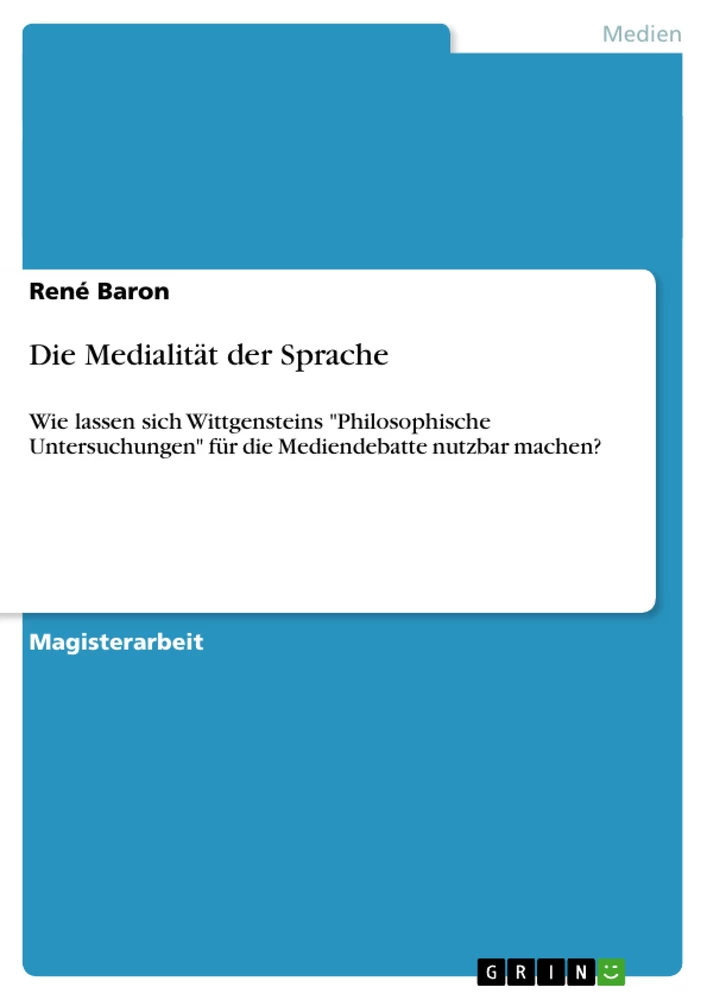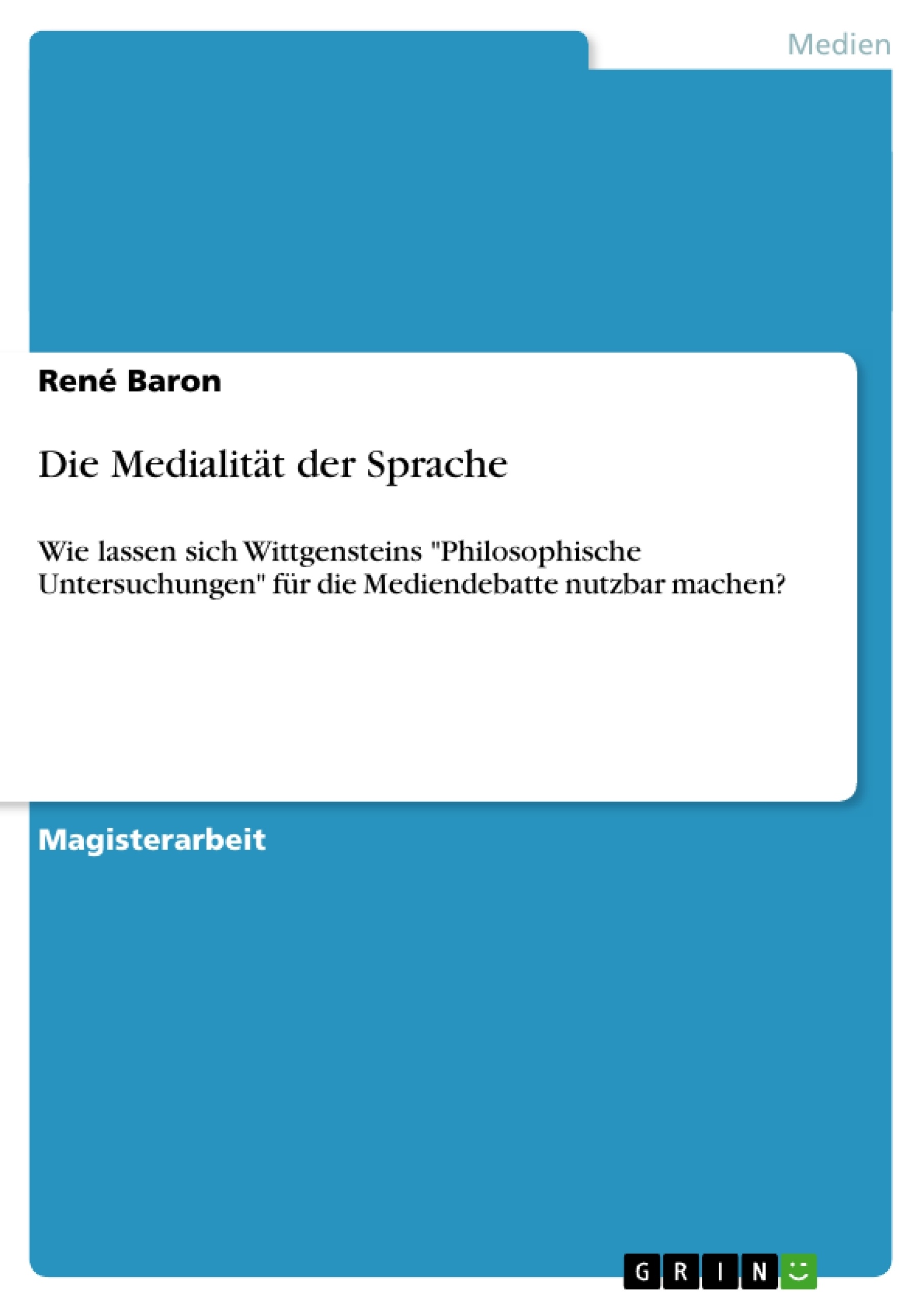Ludwig Wittgensteins Konzeption sozialer Sprachspiele eignet sich auch heute noch hervorragend dazu, verstehbar zu machen, wie zwischenmenschliche Kommunikation und Sprache überhaupt funktionieren. Darüber hinaus können seine Ausführungen für den Nachweis nutzbar gemacht werden, dass Sprache als ein universelles Medium aufzufassen ist. Hierbei handelt es sich um eine Sichtweise, die in weiten Teilen der wissenschaftlichen Mediendebatte kaum Beachtung findet. Während unterschiedliche Formen elektronischer Kommunikation im Zentrum des Interesses stehen, wird der Medialitätsstatus der Sprache häufig bewusst geleugnet. Das liegt zum einen daran, dass in der genannten Debatte keineswegs Einigkeit darüber herrscht, was eigentlich unter einem Medium zu verstehen ist; ein anderer Grund ist, dass Sprache in sehr vielen Theorien lediglich als Transportmittel zur bloßen Übertragung medienunabhängiger Informationen konzipiert wird. Es ist allerdings fraglich, ob dieses Modell dem Phänomen gerecht werden kann. Die in den PU vertretene Sprachauffassung weist diesbezüglich einen völlig anderen Weg: Natürlich spricht Wittgenstein an keiner Stelle explizit von der ‚Medialität’ der Sprache. Dennoch lassen sich bei genauer Lektüre sehr viele Charakteristika von Sprache herausstellen, die mit der Behauptung, dass Sprache ein Medium ist, in Einklang gebracht werden können. In dieser Magisterarbeit wird daher der Versuch unternommen, mit Hilfe von Wittgensteins Spätphilosophie den Sonderstatus der Sprache zunächst deutlich herauszuarbeiten. Die hieraus gewonnenen Ergebnisse sollen anschließend dazu benutzt werden, eine angemessene Antwort auf die Frage zu geben, was denn eigentlich ein Medium ist und warum sich üblicherweise die Medialität von Sprache (und anderen Medien) so schwer fassen lässt. Die PU liefern insofern einen profitablen Zugang zum Medialitätsproblem und es zeigt sich, inwieweit Wittgenstein diesbezüglich schon als eine Art Vordenker zu gelten hat. Zur weiteren Vertiefung wird letztlich die Notationstheorie von Nelson Goodman in die Analyse einbezogen, da sie das logische Handwerkszeug bereitstellt, das Wittgenstein uns vorenthalten hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wittgensteins Sprachauffassung in den Philosophischen Untersuchungen
- Kritik an der Gegenstandstheorie der Bedeutung
- Sprachspiel und Grammatik
- Regelgeleitete Sprache als Kalkül und als Spiel
- Die Sprachen (2) und (8)
- Wittgensteins Begriff der Grammatik
- Sprache, Denken und Intentionalität
- Die Unmöglichkeit einer Privatsprache
- Das Medialitätsproblem – Sprache als Medium
- Was ist ein Medium?
- Medientheoretische Erklärungsversuche
- Mittel & Medium
- Das Medium als Performanz
- Die Medialität der Sprache
- Zum Verhältnis von Kompetenz und Performanz
- Mentalität und Medialität
- Ein Ausblick: Von Wittgenstein zu Goodman
- Orale Rede und Schrift
- Goodmans Notationstheorie
- Was ist ein Medium?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Medialität der Sprache anhand der Philosophischen Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein. Ziel ist es, Wittgensteins Spätphilosophie zu nutzen, um den Sonderstatus der Sprache als Medium herauszuarbeiten und einen angemessenen Medienbegriff zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet, warum die Medialität von Sprache in der wissenschaftlichen Debatte oft vernachlässigt wird.
- Wittgensteins Kritik an traditionellen Bedeutungsauffassungen
- Analyse der Sprachspielkonzeption und ihrer Implikationen für die Kommunikation
- Reflexion des Medienbegriffs und Abgrenzung von "Mittel"
- Die performative Dimension von Medialität und deren Bedeutung für das Verständnis von Sprache
- Einbezug von Goodmans Notationstheorie zur Erweiterung der Wittgensteinschen Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Nutzbarkeit von Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen für die Mediendebatte dar. Sie kritisiert die Vernachlässigung des Medialitätsstatus der Sprache in der wissenschaftlichen Diskussion und hebt die Bedeutung von Wittgensteins Spätphilosophie für ein vertieftes Verständnis von Sprache als Medium hervor. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Methodik, die auf einer detaillierten Analyse der Philosophischen Untersuchungen und ergänzenden medientheoretischen Ansätzen basiert.
Wittgensteins Sprachauffassung in den Philosophischen Untersuchungen: Dieses Kapitel analysiert Wittgensteins Sprachphilosophie, insbesondere seine Sprachspielkonzeption. Es beleuchtet seine Kritik an der traditionellen Gegenstandstheorie der Bedeutung und präsentiert eine detaillierte Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen wie Regel, Grammatik und Unhintergehbarkeit der Sprache. Die Unmöglichkeit einer Privatsprache wird erläutert, um die soziale Einbettung von Sprachgebrauch zu betonen. Die Kapitel unterstreichen die erkenntnistheoretischen Konsequenzen von Wittgensteins Ansatz und seine Bedeutung für das Verständnis von Kommunikation und Bedeutung.
Das Medialitätsproblem – Sprache als Medium: Dieses Kapitel befasst sich mit den medientheoretischen Implikationen von Wittgensteins Sprachspielkonzeption. Es beginnt mit einer Klärung des Medienbegriffs, um ihn vom Begriff des Mittels abzugrenzen und die performative Dimension von Medialität herauszustellen. Die Analyse kritisiert kognitive Ansätze, die die Medialität der Sprache ausblenden, und argumentiert für die Auffassung von Sprache als universelles Medium. Schließlich wird Goodmans Notationstheorie herangezogen, um die Wittgensteinsche Perspektive zu erweitern und das logische Handwerkszeug zu liefern, das in Wittgensteins Werk fehlt.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Sprachspiel, Grammatik, Bedeutung, Medialität, Medium, Kommunikation, Performanz, Privatsprache, Nelson Goodman, Notationstheorie, Mediendebatte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Wittgensteins Sprachauffassung und das Medialitätsproblem
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Medialität der Sprache, indem sie Ludwig Wittgensteins Spätphilosophie, insbesondere seine Philosophischen Untersuchungen, heranzieht. Ziel ist es, den Sonderstatus von Sprache als Medium zu beleuchten und einen angemessenen Medienbegriff zu entwickeln. Ein weiterer Fokus liegt auf der oft vernachlässigten Medialität der Sprache in der wissenschaftlichen Debatte.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Wittgensteins Kritik an traditionellen Bedeutungsauffassungen, analysiert seine Sprachspielkonzeption und deren Implikationen für die Kommunikation. Sie reflektiert den Medienbegriff, grenzt ihn vom Begriff des „Mittels“ ab und untersucht die performative Dimension von Medialität im Zusammenhang mit Sprache. Zusätzlich wird Nelson Goodmans Notationstheorie einbezogen, um die Wittgensteinsche Perspektive zu erweitern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Wittgensteins Sprachauffassung in den Philosophischen Untersuchungen (inkl. Kritik an der Gegenstandstheorie, Sprachspiel und Grammatik, Unmöglichkeit einer Privatsprache), ein Kapitel zum Medialitätsproblem – Sprache als Medium (inkl. Klärung des Medienbegriffs, Medialität der Sprache, Ausblick auf Goodman), und ein Resümee. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Analysen und Argumentationen.
Welche Rolle spielt Wittgenstein in dieser Arbeit?
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen bilden die Grundlage der Arbeit. Seine Sprachspielkonzeption, seine Kritik an traditionellen Bedeutungsauffassungen und sein Verständnis von Grammatik werden ausführlich analysiert, um den Medialitätsstatus der Sprache zu beleuchten. Wittgensteins Ansatz dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines angemessenen Medienbegriffs.
Welche Bedeutung hat Goodmans Notationstheorie?
Goodmans Notationstheorie wird herangezogen, um die Wittgensteinsche Perspektive zu erweitern und ein logisches Handwerkszeug bereitzustellen, das in Wittgensteins Werk fehlt. Sie hilft, die Medialität der Sprache umfassender zu verstehen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Sprachspiel, Grammatik, Bedeutung, Medialität, Medium, Kommunikation, Performanz, Privatsprache, Nelson Goodman, Notationstheorie, Mediendebatte.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert für ein vertieftes Verständnis von Sprache als Medium, indem sie Wittgensteins Spätphilosophie nutzt und die oft vernachlässigte Medialität der Sprache in der wissenschaftlichen Diskussion hervorhebt. Sie entwickelt einen differenzierten Medienbegriff und integriert Goodmans Notationstheorie, um die Analyse zu vertiefen.
- Quote paper
- René Baron (Author), 2007, Die Medialität der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79292