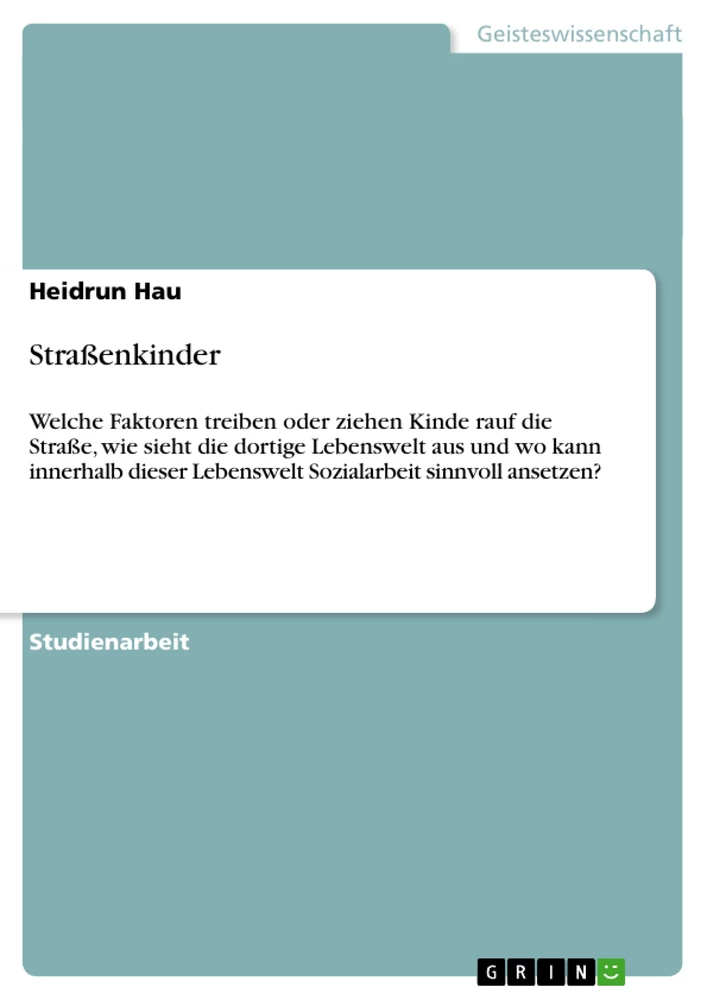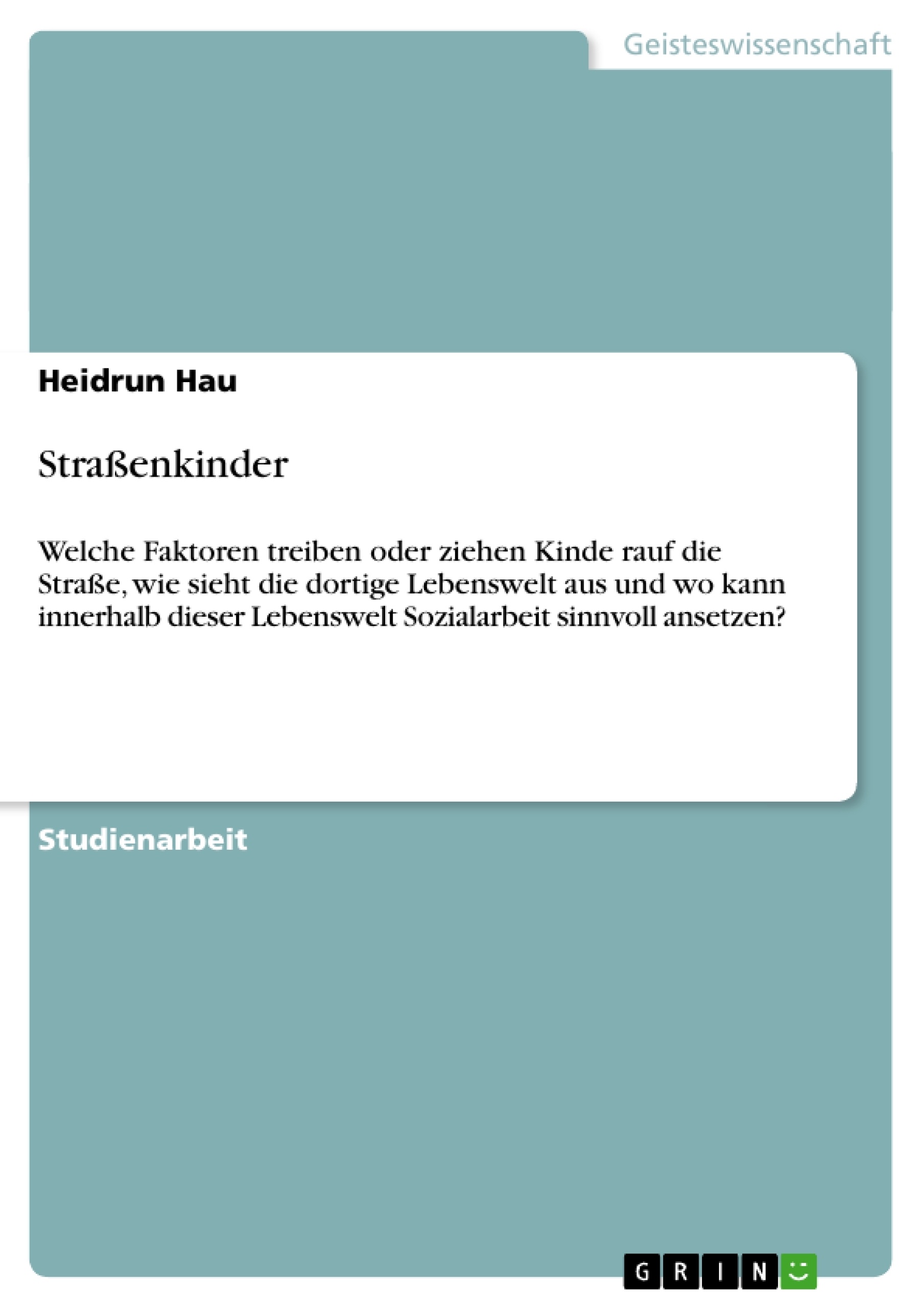Das Phänomen „Straßenkinder“ ist heutzutage nichts mehr, mit dem sich die deutsche
Gesellschaft und die Sozialarbeit hierzulande nicht auseinander zu setzen braucht. Es ist seit
langem kein Phänomen, das sich auf Entwicklungsländer reduzieren lässt. Breits in den 80er
Jahren flüchteten sogenannte Trebegänger aus den Elternhäusern und Heimen auf die Straße.
Diese „Ausflüge“ waren zwar zahlreich, aber nur von kurzer Dauer. Die Kinder und
Jugendlichen hatten keine Andockmöglichkeiten und das Überleben auf der Straße gestaltete
sich als schwierig. Zu Beginn der 90er Jahre waren durch die Entstehung der Bahnhof- und
Cityszenen diese Andockmöglichkeiten gegeben und die Ausreißer und Trebegänger stoßen
heute auf komplexe Sozialsysteme, in denen sie untertauchen können und in denen sie für
längere Zeiträume auf der Straße überleben und leben können. In dieser Hausarbeit soll sich
zunächst mit dem neuen Begriff „Straßenkinder“ auseinandergesetzt werden, um dann im
Folgenden die Ursachen für die Flucht auf die Straße oder das bewusste Entscheiden für ein
Leben auf der Straße aufzuzeigen. Im weiteren Verlauf wird die Lebenswelt der
Straßenkinder beschrieben um dann auf sozialarbeiterische Modelle einzugehen, die auf diese
Lebenswelt eingehen und sie berücksichtigen. Vorgestellt werden das Modell des
Schwellenstufensystems und erlebnispädagogische Maßnahmen. Im Kapitel „Eigene
Stellungnahme“ soll die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden. Dabei wird in
Ansätzen die Lebenswelt von Straßenkindern rekonstruiert und sich kritisch mit den
vorgestellten sozialarbeiterischen Ansätzen auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Darstellung des Themas
- 2. Annäherung an den Begriff des Straßenkindes mit Hilfe einer Klassifizierung
- 3. Ursachen für das Leben auf der Straße
- 3.1 Ursachen auf der Mikroebene
- 3.2 Ursachen auf der Makroebene
- 4. Das Leben auf der Straße
- 4.1 Leben ohne Obdach
- 4.2 Leben in und mit der Illegalität
- 4.3 Leben in der Gruppe
- 4.4 Selbstbild der Straßenkinder und Zukunftswünsche
- 5. Das Schwellenstufensystem
- 6. Erlebnispädagogik
- 7. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Faktoren, die Kinder auf die Straße führen, ihre Lebenswelt und mögliche sozialarbeiterische Interventionspunkte. Sie analysiert den Begriff "Straßenkind" kritisch und differenziert zwischen verschiedenen Kategorien von Straßenkindern. Die Arbeit beleuchtet sowohl mikro- als auch makro-soziale Ursachen und beschreibt die Lebensrealität von Straßenkindern.
- Definition und Klassifizierung des Begriffs "Straßenkind"
- Ursachen für das Leben auf der Straße (Mikro- und Makroebene)
- Beschreibung der Lebenswelt von Straßenkindern
- Sozialarbeiterische Ansätze (Schwellensystem, Erlebnispädagogik)
- Bewertung sozialarbeiterischer Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Darstellung des Themas: Das Kapitel führt in die Thematik der Straßenkinder in Deutschland ein und betont, dass es sich nicht um ein rein auf Entwicklungsländer beschränktes Phänomen handelt. Es wird der Wandel vom kurzzeitigen "Trebegängertum" der 80er Jahre hin zu längerfristigen Lebensformen auf der Straße in den 90er Jahren, bedingt durch die Entstehung von Bahnhof- und Cityszenen, beschrieben. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit dem Begriff "Straßenkind", den Ursachen für das Leben auf der Straße, der Beschreibung der Lebenswelt der Straßenkinder und der Vorstellung sozialarbeiterischer Modelle an.
2. Annäherung an den Begriff des Straßenkindes mit Hilfe einer Klassifizierung: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit dem Begriff "Straßenkind" und seinen verschiedenen Ausprägungen. Es wird zwischen Kindern mit weiterhin bestehendem Kontakt zu Familie und Schule und Kindern, die vollständig ausgegrenzt sind, differenziert. Der Autor kritisiert die Gefahr der Verallgemeinerung und betont die Notwendigkeit, individuelle Faktoren und den Grad der Bindung an die Straße zu berücksichtigen. Die Klassifizierung nach Romahn mit seinen drei Kategorien – Kinder, die tagsüber auf der Straße leben, Kinder, die bei Freunden unterkommen, und Kinder, die vollständig von der Gesellschaft ausgegrenzt sind – wird vorgestellt.
3. Ursachen für das Leben auf der Straße: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für das Leben auf der Straße auf Mikro- und Makroebene. Auf der Mikroebene werden familiäre Probleme und Defizite in den primären und sekundären Sozialisationsinstanzen thematisiert, wie z.B. schwierige Familienstrukturen und mangelnde Unterstützung. Der Text erwähnt den Mythos der Straße, verstärkt durch die Medien, als "Pull-Faktor", der die Flucht auf die Straße attraktiv erscheinen lässt.
4. Das Leben auf der Straße: Dieses Kapitel beschreibt die Lebenswelt der Straßenkinder, einschließlich der Herausforderungen des Lebens ohne Obdach, der Erfahrungen mit Kriminalität und Illegalität, sowie des Lebens in Gruppen. Es soll der Einblick in die Selbstwahrnehmung der Kinder und ihre Zukunftsperspektiven gegeben werden, was die komplexen Lebensumstände dieser Gruppe zeigt. Die verschiedenen Aspekte des Lebens auf der Straße werden detailliert dargestellt und sollen ein umfassendes Bild der Situation vermitteln.
Schlüsselwörter
Straßenkinder, Obdachlosigkeit, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Mikroebene, Makroebene, Sozialisation, Familie, Lebenswelt, Schwellensystem, Erlebnispädagogik, Bahnhofszene, Cityszene, Armut.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Straßenkinder in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Faktoren, die Kinder auf die Straße führen, ihre Lebenswelt und mögliche sozialarbeiterische Interventionspunkte. Sie analysiert den Begriff "Straßenkind" kritisch und differenziert zwischen verschiedenen Kategorien von Straßenkindern. Die Arbeit beleuchtet sowohl mikro- als auch makro-soziale Ursachen und beschreibt die Lebensrealität von Straßenkindern. Die Arbeit betrachtet den Wandel vom kurzzeitigen "Trebegängertum" der 80er Jahre hin zu längerfristigen Lebensformen auf der Straße in den 90er Jahren, bedingt durch die Entstehung von Bahnhof- und Cityszenen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Klassifizierung des Begriffs "Straßenkind", die Ursachen für das Leben auf der Straße (Mikro- und Makroebene), die Beschreibung der Lebenswelt von Straßenkindern, sozialarbeiterische Ansätze (Schwellensystem, Erlebnispädagogik) und die Bewertung sozialarbeiterischer Interventionsmöglichkeiten.
Wie wird der Begriff "Straßenkind" definiert und klassifiziert?
Die Hausarbeit kritisiert den Begriff "Straßenkind" und seine unpräzisen Ausprägungen. Es wird zwischen Kindern mit bestehendem Kontakt zu Familie und Schule und Kindern, die vollständig ausgegrenzt sind, differenziert. Die Klassifizierung nach Romahn (drei Kategorien: Kinder, die tagsüber auf der Straße leben, Kinder, die bei Freunden unterkommen, und Kinder, die vollständig von der Gesellschaft ausgegrenzt sind) wird vorgestellt. Die Gefahr der Verallgemeinerung und die Notwendigkeit, individuelle Faktoren und den Grad der Bindung an die Straße zu berücksichtigen, werden betont.
Welche Ursachen für das Leben auf der Straße werden untersucht?
Die Ursachen werden auf Mikro- und Makroebene analysiert. Auf der Mikroebene werden familiäre Probleme und Defizite in den primären und sekundären Sozialisationsinstanzen thematisiert (z.B. schwierige Familienstrukturen, mangelnde Unterstützung). Auf der Makroebene wird der gesellschaftliche Kontext betrachtet. Der Mythos der Straße als "Pull-Faktor", verstärkt durch die Medien, wird ebenfalls erwähnt.
Wie wird das Leben auf der Straße beschrieben?
Das Kapitel beschreibt die Lebenswelt der Straßenkinder, einschließlich des Lebens ohne Obdach, der Erfahrungen mit Kriminalität und Illegalität, sowie des Lebens in Gruppen. Es beleuchtet die Selbstwahrnehmung der Kinder und ihre Zukunftsperspektiven. Die verschiedenen Aspekte des Lebens auf der Straße werden detailliert dargestellt, um ein umfassendes Bild der Situation zu vermitteln.
Welche sozialarbeiterischen Ansätze werden vorgestellt?
Die Hausarbeit stellt das Schwellensystem und die Erlebnispädagogik als sozialarbeiterische Ansätze vor und bewertet deren Interventionsmöglichkeiten. Diese Ansätze werden im Kontext der komplexen Lebensumstände der Straßenkinder diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Straßenkinder, Obdachlosigkeit, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Mikroebene, Makroebene, Sozialisation, Familie, Lebenswelt, Schwellensystem, Erlebnispädagogik, Bahnhofszene, Cityszene, Armut.
- Arbeit zitieren
- Heidrun Hau (Autor:in), 2005, Straßenkinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79338