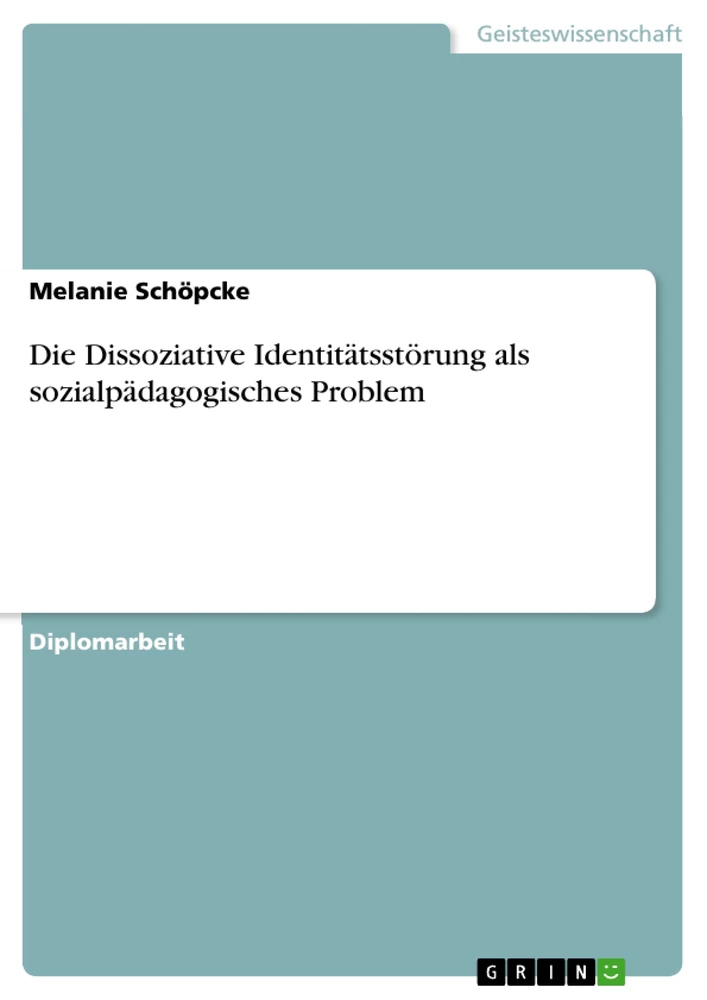Die Fachliteratur bezeichnet die „Welt der multiplen Persönlichkeiten“ heute vorwiegend mit dem Begriff Dissoziative Identitätsstörung (DIS). Es handelt sich um eine klinisch anerkannte, psychische Störung, bei der sich nicht etwa reale Personen einen gemeinsamen Körper teilen, sondern verschiedene Anteile eines Menschen sich als so sehr voneinander getrennt erleben, daß sie jeweils über eine eigene Identität verfügen...
Die Diplomarbeit soll zum einen wichtiges Grundwissen über DIS vermitteln.
Im Besonderen wird der Zusammenhang zwischen dem Erleben extremster Gewalt und der psychischen Verarbeitung durch Dissoziation hergestellt sowie das Störungsbild selbst und daraus resultierende (störungs-)spezifische Probleme aufgezeigt. Menschen mit DIS wurden bereits in frühester Kindheit physischer und/oder psychischer und/oder sexueller Mißhandlung ausgesetzt, die über das Maß menschlicher Vorstellungskraft hinausreicht. Um das physische, wie psychische Überleben zu sichern, wurden sie gezwungen ihre intimsten Körpergrenzen aufzugeben und dissoziative Mechanismen als einzige Möglichkeit zu nutzen, um ihre überwältigenden Ängste und Schmerzen zu bewältigen.
Im Erwachsenenalter sind die „Überlebenskünstler“ allerdings mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert, die ihr Überleben erneut gefährden, so daß diese Arbeit auch den Umgang und die Behandlungsmöglichkeiten Betroffener aufzeigt. Beachtung finden sowohl der psychologisch- therapeutische, wie auch der sozialpädagogische Unterstützungsrahmen...
Im 2. Kapitel stehen das Konzept der Dissoziation, dissoziative Phänomene und Störungen, einschließlich der DIS, im Vordergrund. Begriffe, das dissoziative Kontinuum und Diagnosekriterien der Störungen werden vorgestellt. Anschließend erfolgt neben einem geschichtlichen Rückblick, die Hinwendung zur Prävalenz und der kontrovers geführten Diskussion über das Phänomen DIS.
Das 3. Kapitel beschäftigt sich mit den ätiologischen Bedingungen. Es wird der Zusammenhang zwischen Dissoziation, Mißbrauch und Trauma dargestellt, Formen und TäterInnen zu Missbrauch beschrieben sowie die DIS- Entstehung als Strategie der Bewältigung dargelegt. Im Anschluß daran, erhält der Leser einen Einblick in Diagnostik, Symptomatologie und Komorbidität des Störungsbildes sowie in das „normal- verrückte Leben eines multiplen Systems“...
Möglichkeiten und Grenzen, die Psychologie und Sozialpädagogik für die Behandlung Betroffener anbieten, stellt das abschließende, 4. Kapitel heraus...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die dissoziative Identitätsstörung als sozialpädagogisches Problem. Sie beleuchtet die Auswirkungen schwerer traumatischer Erlebnisse, insbesondere satanisch-ritueller Gewalt, auf die Entwicklung und die psychische Gesundheit betroffener Personen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entstehung und den Umgang mit Dissoziation als Überlebensmechanismus.
- Satanisch-rituelle Gewalt und ihre Folgen
- Dissoziation als Überlebensstrategie
- Die Entstehung multipler Persönlichkeiten
- Soziokulturelle Aspekte der Traumatisierung
- Herausforderungen der sozialpädagogischen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beginnt mit einer poetischen Metapher, die den kalten, harten Stein als Symbol für die erlittene Gewalt darstellt. Es führt dann in die Geschichte eines Kindes ein, das satanisch-ritueller Gewalt ausgesetzt ist und durch Dissoziation – die Aufspaltung der Persönlichkeit in verschiedene Identitäten – versucht zu überleben. Die beschriebenen Ereignisse zeigen die Grausamkeit der Misshandlung und die Entstehung multipler Persönlichkeiten als Schutzmechanismus vor unerträglichem Leid. Die Geschichte dient als eindrückliche Einführung in die Thematik der dissoziativen Identitätsstörung und verdeutlicht die Notwendigkeit sozialpädagogischer Interventionen. Die Verbindung zwischen dem kalten Stein und dem kalten, harten Erleben des Kindes unterstreicht den emotionalen Schock und die nachhaltigen Folgen der Traumatisierung. Die erwähnte „Biographie einer in viele Einzelteile zerbrochenen, menschlichen Seele“ kündigt den Fokus der Arbeit auf die psychischen Auswirkungen an.
Schlüsselwörter
Dissoziative Identitätsstörung, Satanisch-rituelle Gewalt, Trauma, Persönlichkeitsspaltung, Überlebensmechanismen, Sozialpädagogische Intervention, Kindesmissbrauch, Identität, Dissoziation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dissoziative Identitätsstörung als sozialpädagogisches Problem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die dissoziative Identitätsstörung (DID) als sozialpädagogisches Problem, insbesondere im Kontext satanisch-ritueller Gewalt (SRG). Sie analysiert die Auswirkungen schwerer traumatischer Erlebnisse auf die Entwicklung und psychische Gesundheit Betroffener und konzentriert sich auf Dissoziation als Überlebensmechanismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Satanisch-rituelle Gewalt und ihre Folgen, Dissoziation als Überlebensstrategie, die Entstehung multipler Persönlichkeiten, soziokulturelle Aspekte der Traumatisierung und die Herausforderungen sozialpädagogischer Interventionen.
Wie beginnt das Vorwort?
Das Vorwort verwendet eine poetische Metapher (kalter Stein) um die erlittene Gewalt zu symbolisieren. Es führt die Geschichte eines Kindes ein, das SRG erfährt und durch Dissoziation – die Aufspaltung der Persönlichkeit – zu überleben versucht. Die Geschichte verdeutlicht die Grausamkeit der Misshandlung und die Entstehung multipler Persönlichkeiten als Schutzmechanismus.
Welche Rolle spielt die Dissoziation?
Die Arbeit betrachtet die Dissoziation als zentralen Überlebensmechanismus bei schwerer Traumatisierung, insbesondere bei SRG. Sie untersucht, wie die Aufspaltung der Persönlichkeit Betroffenen hilft, mit unerträglichem Leid umzugehen.
Welche Bedeutung hat satanisch-rituelle Gewalt?
Satanisch-rituelle Gewalt wird als eine besonders schwere Form von Trauma dargestellt, die die Entstehung einer dissoziativen Identitätsstörung begünstigt. Die Arbeit beleuchtet die langfristigen Folgen dieser Gewaltform.
Welche sozialpädagogischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der sozialpädagogischen Intervention bei Betroffenen mit DID, die durch SRG traumatisiert wurden. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit den komplexen psychischen Folgen und der Entwicklung geeigneter Hilfestellungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dissoziative Identitätsstörung, Satanisch-rituelle Gewalt, Trauma, Persönlichkeitsspaltung, Überlebensmechanismen, Sozialpädagogische Intervention, Kindesmissbrauch, Identität, Dissoziation.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält eine Zusammenfassung des Vorworts, welche die zentralen Aspekte der Einleitung und die Thematik der Arbeit vorstellt.
- Citation du texte
- Diplom-Pädagogin Melanie Schöpcke (Auteur), 2006, Die Dissoziative Identitätsstörung als sozialpädagogisches Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79609