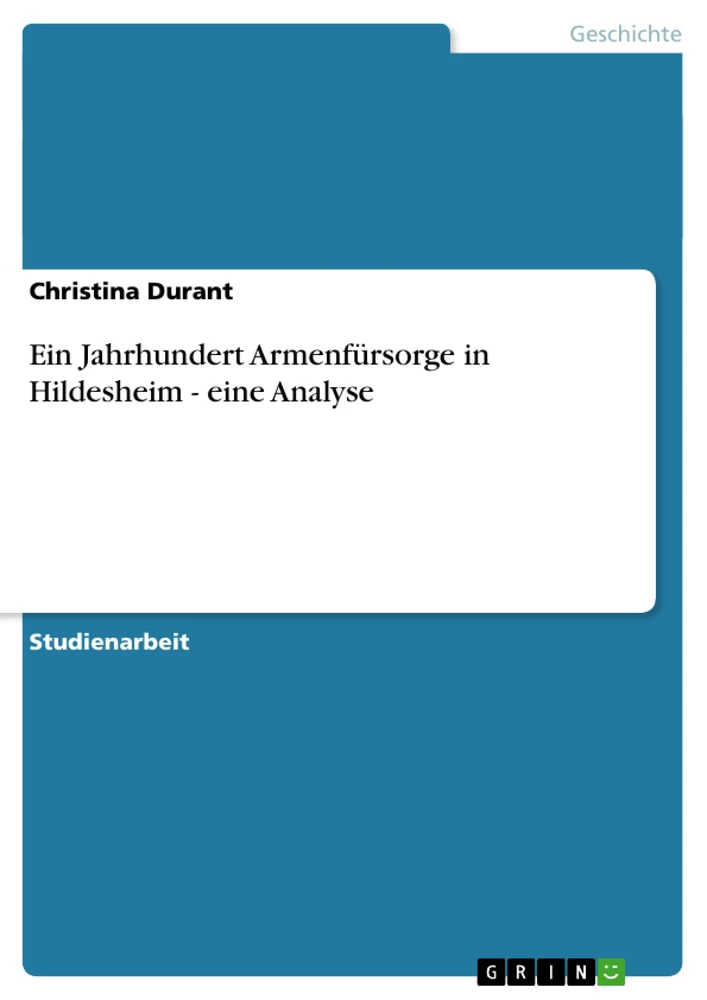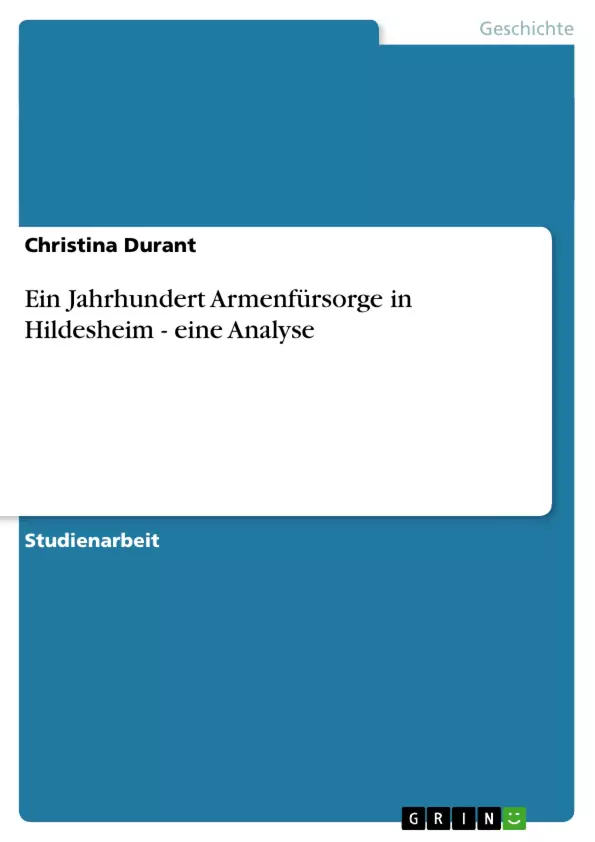Zu Beginn der Neuzeit ist eine umfassende Regulierungstätigkeit der Obrigkeiten zu beobachten. Als Anlass für den massenhaften Erlass vielfältiger Ordnungen in den Bereichen Verwaltung, Wirtschafts- und Sozialpolitik werden gemeinhin tiefgreifende soziale Veränderungen, ausgelöst durch Bevölkerungswachstum und zunehmende soziale Mobilität, gesehen. Die damit einhergehende Lockerung der Ständegesellschaft, also eine Veränderung der bestehenden Gesellschaftsordnung, wurde als bedrohlich empfunden. Es entstand das Bedürfnis für „gute Policey“ zu sorgen, also den Zustand einer funktionierenden Ordnung innerhalb einer Gesellschaft herzustellen und für das Wohl ihrer Bürger zu sorgen. Die zu diesem Zwecke erlassenen Ordnungen betreffen fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und verfolgen das Ziel, als positiv bewertertete Zustände zu erhalten und Missständen abzuhelfen. Ein Teilgebiet der Policeygesetzgebung ist das der Armen- bzw. Fürsorgeordnungen. Dieser Typ der Policeyordnungen ist ein weit verbreiteter. Bestreben aller Armenordnungen ist es, Personengruppen zu definieren, die unterstützungsberechtigt sind, Kriterien zu entwickeln, die Personen unterstützungsberechtigt machen, deren Unterstützung zu sichern und Personen, die diese nicht erfüllen, davon auszuschließen bzw. sie ganz aus dem jeweiligen Gemeinwesen fernzuhalten. Diese Arbeit gibt in einem ersten Schritt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Armenfürsorge ab dem ausgehenden Mittelalter und versucht in ihrem zweiten Teil diese Entwicklung an der Armengesetzgebung der Stadt Hildesheim nachzuvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Forschungsüberblick
- Entwicklung der Armenfürsorge
- Almosenpraxis im ausgehenden Mittelalter
- Entwicklung in der frühen Neuzeit: Der Prozess der Rationalisierung
- Weitere Entwicklung bis ins 18. Jahrhundert
- Die Armengesetzgebung Hildesheims 1693 bis 1771
- Fazit
- Quellen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Armenfürsorge in der Stadt Hildesheim vom ausgehenden Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Sie untersucht die Veränderungsprozesse von der traditionellen Almosenpraxis hin zu einer rationalisierten und staatlich kontrollierten Armenfürsorge.
- Die Entwicklung der Armenfürsorge vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit
- Die Rationalisierung der Armenfürsorge und die Einführung von Armenordnungen
- Die Armengesetzgebung Hildesheims im 17. und 18. Jahrhundert
- Die Rolle der Stadtverwaltung und die Bedeutung von "gute Policey" in der Armenfürsorge
- Die Definition von Armut und Bedürftigkeit im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über den Forschungsstand zur Armenfürsorge in der frühen Neuzeit und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext der damaligen Zeit.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklung der Armenfürsorge vom ausgehenden Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Es beschreibt die traditionelle Almosenpraxis und die Veränderungen, die mit der Einführung von Armenordnungen einhergingen. Dieses Kapitel beleuchtet den Prozess der Rationalisierung, die zunehmenden staatlichen Kontrollen und die Ausgrenzung von Armut.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Armengesetzgebung der Stadt Hildesheim im 17. und 18. Jahrhundert. Es untersucht die spezifischen Gesetze und Verordnungen, die zur Regulierung der Armenfürsorge erlassen wurden, sowie die Rolle der Stadtverwaltung in diesem Prozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Thema der Armenfürsorge in der frühen Neuzeit. Es werden die Entwicklungen von der traditionellen Almosenpraxis hin zu einer rationalisierten Armenfürsorge im Kontext von "gute Policey", staatlicher Kontrolle und der Definition von Armut und Bedürftigkeit untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Armenfürsorge in Hildesheim?
Die Arbeit analysiert den Wandel von der mittelalterlichen Almosenpraxis hin zu einer staatlich kontrollierten und rationalisierten Armengesetzgebung zwischen 1693 und 1771.
Was bedeutet der Begriff „gute Policey“?
Er beschreibt das frühneuzeitliche Bestreben der Obrigkeit, eine funktionierende öffentliche Ordnung herzustellen und für das Wohl der Bürger zu sorgen.
Welches Ziel verfolgten die Armenordnungen?
Ziel war es, unterstützungsberechtigte Personen klar zu definieren, Kriterien für Hilfe festzulegen und „unwürdige“ Arme vom Gemeinwesen fernzuhalten.
Warum wurde Armut in der frühen Neuzeit als Bedrohung empfunden?
Bevölkerungswachstum und soziale Mobilität lockerten die Ständegesellschaft, was die Obrigkeit dazu veranlasste, durch strengere Regulierungen die soziale Ordnung zu sichern.
Was versteht man unter dem Prozess der Rationalisierung der Fürsorge?
Es ist der Übergang von spontaner, religiös motivierter Wohltätigkeit zu einer organisierten, bürokratischen und bedingungsknüpften Unterstützung durch die Stadtverwaltung.
- Quote paper
- Christina Durant (Author), 2007, Ein Jahrhundert Armenfürsorge in Hildesheim - eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79636