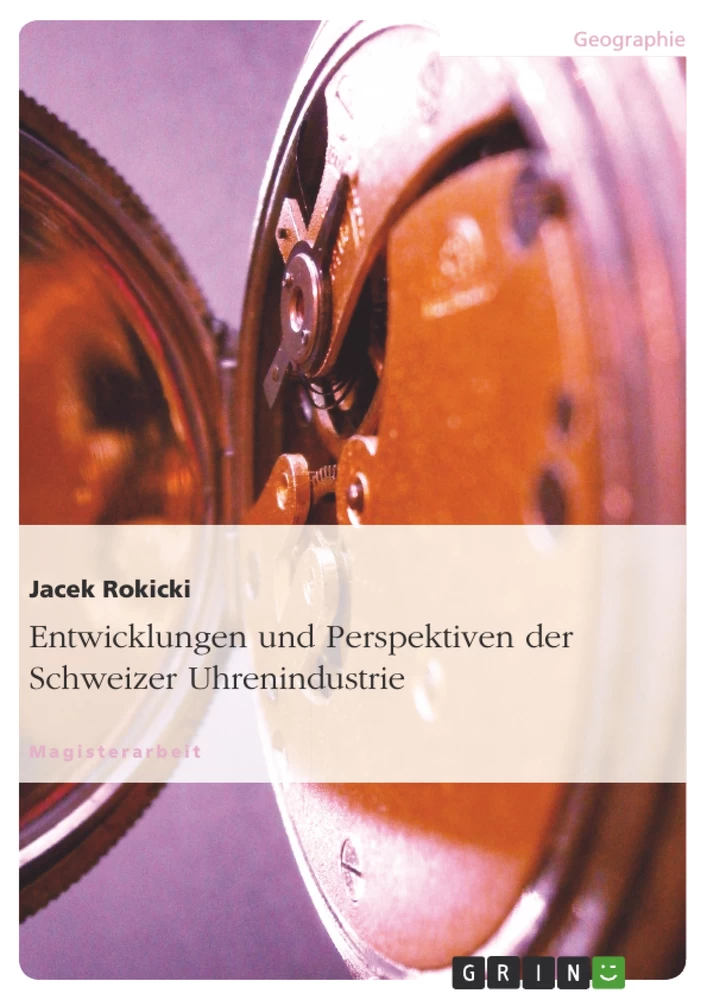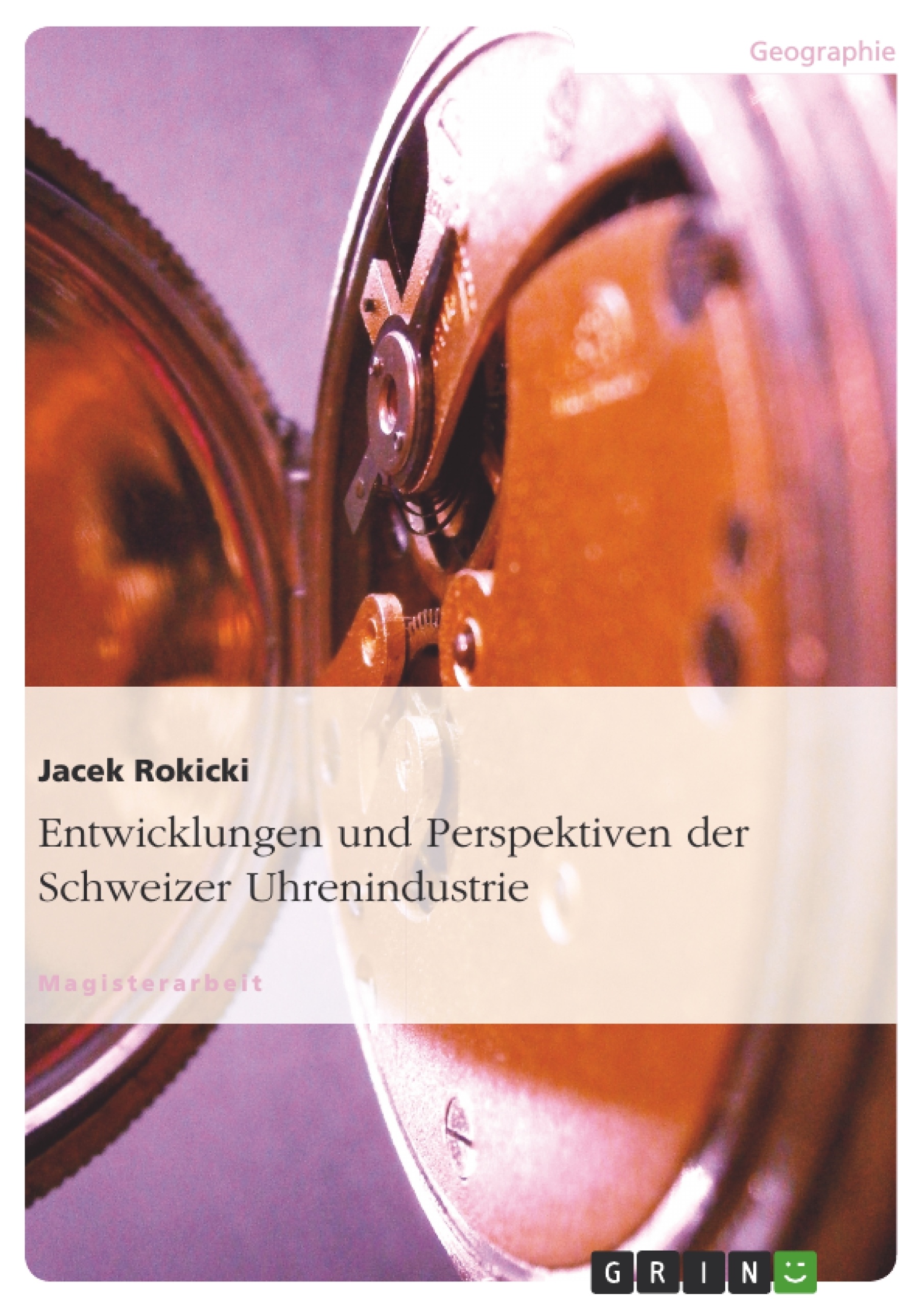Was sind in der heutigen schnelllebigen und digitalisierten Welt, in der wir überall von Uhren umgeben sind, die Gründe eine eigene Uhr besitzen zu wollen, ein „Relikt“ aus alten Tagen, ein Stück Geschichte, dessen Ursprung in der Schweiz liegt?
Was veranlasst einen Käufer dazu eine Uhr aus Schweizer Fabrikation zu erwerben, die zwar im Vergleich zu Produkten aus dem asiatischen Ausland einen hohen qualitativen Standard erfüllt, aber wesentlich teurer ist und nüchtern betrachtet auch „nur“ die Uhrzeit angibt. Damit ist in der Schweiz ein ganzer Industriezweig verbunden, der für viele Menschen eine Arbeitsstelle bedeutet. Über Jahrhunderte hat sich in diesem Land, dass auch als „Wiege der Zeitmessung“ bezeichnet werden kann, ein florierender Wirtschaftsraum entwickelt, der durch eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren geprägt wurde. Unzählige Einflüsse bildeten im Endeffekt ein Produkt, ohne das die heutige moderne Welt nicht existieren könnte. Dieses Produkt wird zusammen mit Stichwörtern wie Banken, den Alpen und Schokolade assoziiert, wenn man an die „Schweiz“ denkt.
Aber wie aktuell ist diese Aussage noch oder hat die Zeit der Schweizer Uhrenindustrie bereits ausgetickt? Wo befindet sie sich heute und vor allem, wie wird sie sich in Zukunft entwickeln?
Darauf soll diese Arbeit antworten geben und versuchen aufzuzeigen, in welche Richtung sich dieser Industriezweig entwickeln wird. Unter den bisher bekannten Aspekten der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird versucht werden, eine Zukunftsprognose zu erstellen, die sich nicht nur auf wirtschaftliche Prosperität beschränken wird. Darüber hinaus soll einerseits auf Risiken aufmerksam gemacht werden, die der Uhrenindustrie eventuell bevorstehen, und andererseits die Chancen aufgezeigt werden, die sie als Herausforderung vor sich sieht.
Um eine Prognose in diesem Sinne erstellen zu können, muss man zurückblicken, denn „ohne historische Aspekte ist ein Verständnis der Zukunftsperspektive nur sehr schwer möglich“ (Heer, 1907). Aus diesem Grund beginnt diese Arbeit mit den Anfängen der Schweizer Uhrenindustrie und verfolgt deren Entwicklung bis in die heutige Zeit. Jedoch wird sie sich nicht mit der gesamten Zeitmessung befassen, sondern nur auf den wirtschaftshistorischen Aspekt der Herstellung von Klein- und Taschenuhren eingehen.
Da sich diese hauptsächlich auf den Schweizer Jura konzentriert, wird auch hier das Zentrum des Untersuchungsgebietes liegen, mit dem sich diese Arbeit befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Themenwahl
- Intention der Arbeit
- Quellenlage
- Geographische Vorstellung des Untersuchungsgebietes
- Physisch-geographische Aspekte
- Kulturgeographische Aspekte
- Methodische Vorgehensweise
- Entscheidung für eine Teilerhebung
- Fragebogenstruktur
- Theoretische Einordnung der Arbeit
- Wirtschaftsgeographie
- Wirtschaftsgeographie in der Schweizer Uhrenindustrie
- Entwicklung der Uhrenindustrie
- Die ersten Jahre
- Ausbreitung im Juragebirge
- Der Weg zur industriellen Fabrikation
- Wirtschaftswachstum im 19. Jahrhundert
- Folgen des Wachstums
- Krisenzeiten
- Ursachen und Folgen
- Überwindung und Anfälligkeit
- Aufschwung
- Aktuelle Lage
- Der Swatch-Effekt
- Vergleich mit anderen Industriebranchen in der Schweiz
- Perspektiven der Uhrenindustrie
- Zukunftstrend
- Zukünftige Risiken
- Plagiate
- SWISS MADE
- Schlussfolgerung
- Rückblick
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Perspektiven der Schweizer Uhrenindustrie. Ziel ist es, die geographischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Faktoren zu analysieren, die die Entwicklung der Branche im Laufe der Zeit beeinflusst haben. Darüber hinaus werden aktuelle Herausforderungen und zukünftige Chancen der Schweizer Uhrenindustrie beleuchtet.
- Die geographische Lage der Schweizer Uhrenindustrie
- Die historische Entwicklung der Uhrenindustrie
- Die wirtschaftlichen Faktoren, die die Uhrenindustrie prägen
- Die Bedeutung von Innovation und Qualität für den Erfolg der Schweizer Uhrenindustrie
- Die Herausforderungen und Chancen der Uhrenindustrie in der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit der Themenwahl und den Intentionen des Autors. Es erläutert die Relevanz der Schweizer Uhrenindustrie für die Wirtschaftsgeographie und die Motivation des Autors, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das zweite Kapitel gibt eine geographische Vorstellung des Untersuchungsgebietes, wobei sowohl physisch-geographische als auch kulturgeographische Aspekte beleuchtet werden. Im dritten Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert, wobei der Fokus auf der Entscheidung für eine Teilerhebung und der Fragebogenstruktur liegt. Kapitel vier befasst sich mit der theoretischen Einordnung der Arbeit im Kontext der Wirtschaftsgeographie und der Schweizer Uhrenindustrie. Die folgenden Kapitel (5-8) beleuchten die Entwicklung der Uhrenindustrie, wobei verschiedene Phasen, wie die ersten Jahre, die Ausbreitung im Juragebirge, das Wirtschaftswachstum im 19. Jahrhundert und die Krisenzeiten, im Detail analysiert werden. Kapitel 7 befasst sich mit der aktuellen Lage der Uhrenindustrie, wobei der Swatch-Effekt und der Vergleich mit anderen Industriebranchen in der Schweiz im Vordergrund stehen. Kapitel 8 behandelt die Perspektiven der Uhrenindustrie und beleuchtet Zukunftstrends, Risiken und Chancen für die Branche.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Schweizer Uhrenindustrie, ihre geographische Lage, ihre historische Entwicklung, die wirtschaftlichen Faktoren, die Innovation und Qualität, sowie die Herausforderungen und Chancen in der Zukunft. Zu den wichtigsten Themen gehören die Rolle der Wirtschaftsgeographie, die Bedeutung der räumlichen Strukturen, die Entwicklung von Innovationen und die Anpassung an neue Marktbedingungen.
- Citation du texte
- Magister Artium Jacek Rokicki (Auteur), 2007, Entwicklungen und Perspektiven der Schweizer Uhrenindustrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79645