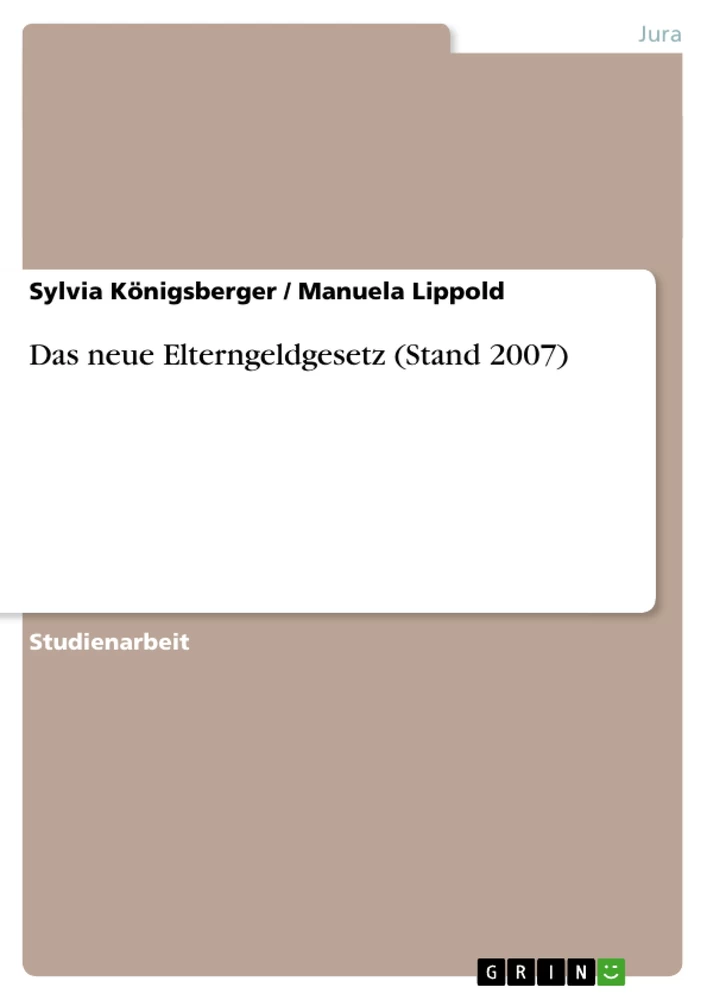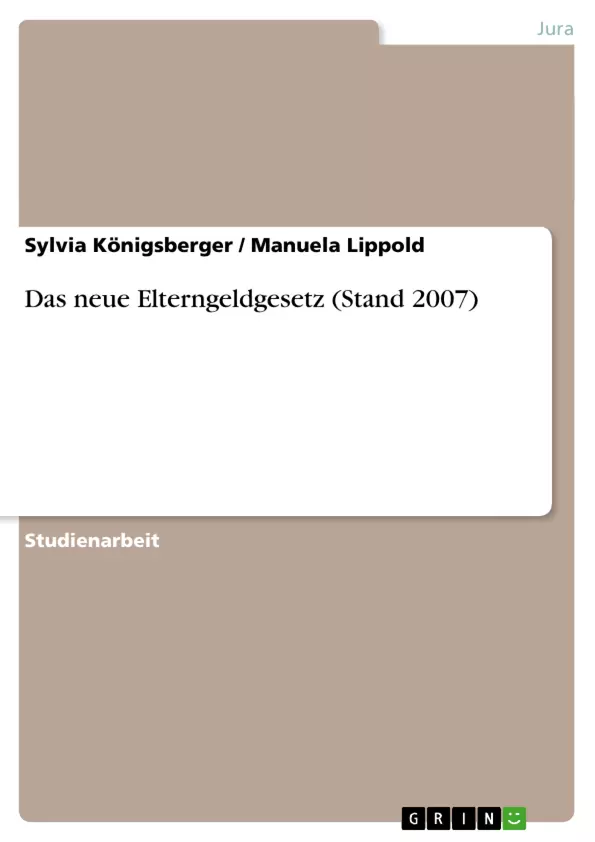1. Vorwort
[...]
Elterngeld erhalten alle Eltern, deren Kinder nach dem 31.12.2006 geboren werden. Kinder, die vor dem 1.1.2007 geboren sind erhalten weiterhin das Erziehungsgeld nach den Vorschriften des Bundeserziehungsgeldgesetzes. Das Elterngeld wird aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert, ist somit also steuerfinanziert. Zur Gegenfinanzierung entfällt das bisherige Erziehungsgeld. Erziehungsgeld wurde zwar nur unterhalb niedriger Einkommensgrenzen gewährt, dafür aber bis zu zwei Jahren in Höhe von monatlich 300 EUR. Somit bewirkt das Elterngeld lediglich eine Umverteilung zwischen verschiedenen Familien. Die Gesamtheit der Familien wird jedoch durch das neue Elterngeld kaum besser gestellt.
[...]
4. Antragstellung
Das Elterngeld wird auf schriftlichen Antrag geleistet. Eine rückwirkende Gewährung ist nur für die letzten drei Monate vor dem Monat der Antragstellung möglich.
Mit der Antragstellung muss die Zahl und Lage der Bezugsmonate angegeben werden. Jeder Elternteil kann für sich einmal einen Antrag auf Elterngeld stellen. Die anspruchsberechtigten Eltern sollen die Entscheidung wer von ihnen Elterngeld erhalten soll grundsätzlich einvernehmlich treffen. Sie müssen selbst entscheiden, wer von ihnen für welche Monate anspruchsberechtigt sein soll. [...]
7. Das Regelelterngeld
Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 % des vor der Geburt erzielten Einkommens
Das einkommensabhängige Elterngeld berechnet sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen der Antragstellerin oder des Antragstellers. Herangezogen wird das persönliche Erwerbseinkommen der letzten zwölf Kalendermonate vor der Geburt des Kindes, für dessen Betreuung jetzt Elterngeld beantragt wird. Monate mit Bezug von Mutterschaftsgeld oder Elterngeld sowie Monate, in denen aufgrund einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung das Einkommen gesunken ist werden bei der Bestimmung der zwölf Kalendermonate grundsätzlich nicht mitgezählt. Statt dieser Monate werden [...]
7.1. Einkommensberechnung bei ArbeitnehmerInnen
[...]
Da sich somit bei Arbeitnehmern das Elterngeld nach dem um eine Werbungskostenpauschale bereinigten Nettoeinkommen richtet kann es für verheiratete ArbeitnehmerInnen günstig sein, ihre bisherige Steuerklasse zu wechseln. Ferner empfiehlt es sich [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Warum führt die Bundesregierung das Elterngeld ein?
- Elternzeit und „Vatermonate“ im internationalen Vergleich
- Antragstellung
- Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Elterngeld
- Bezugszeitraum
- Verfassungsrechtlicher Aspekt
- Verteilung der Partnermonate
- Beispiele für den Elterngeldbezug
- Das Regelelterngeld
- Einkommensberechnung bei ArbeitnehmerInnen
- Muss Elternzeit genommen werden, um Elterngeld zu bekommen?
- Einkommensberechnung Selbstständige
- Besondere Elterngeldbezüge
- Das Mindestelterngeld
- Das Niedrigverdienerelterngeld
- Das Teilzeitarbeitelterngeld
- Das Mehrkinderelterngeld
- Das Mehrlingsgeburtenelterngeld
- Verhältnis von Elterngeld zu anderen Leistungen
- Die Anrechnungsfreiheit des Mindestelterngeldes
- Verhältnis zu Entgeltersatzleistungen
- Anrechnung Mutterschaftsgeld
- Elterngeld und Unterhalt
- Nachweispflichten
- Rechtsweg, Zuständigkeit und Steuerpflicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert das neue Elterngeldgesetz, das am 1. Januar 2007 in Kraft trat. Ziel ist es, die zentralen Bestimmungen des Gesetzes zu erläutern und seine Auswirkungen auf Familien zu beleuchten. Die Arbeit vergleicht das Elterngeld mit dem vorherigen Erziehungsgeld und diskutiert verfassungsrechtliche Aspekte.
- Einführung und Funktionsweise des Elterngeldes
- Vergleich des Elterngeldes mit dem bisherigen Erziehungsgeld
- Anspruchsvoraussetzungen und Bezugszeitraum
- Verfassungsrechtliche Aspekte des Elterngeldes
- Auswirkungen des Elterngeldes auf Familien und die demografische Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die Einführung des Elterngeldgesetzes am 29.09.2006 und dessen Inkrafttreten am 01.01.2007. Es hebt hervor, dass das Elterngeld Kinder betrifft, die nach dem 31.12.2006 geboren wurden, während Kinder, die vorher geboren wurden, weiterhin Erziehungsgeld erhalten. Der Text betont, dass das Elterngeld steuerfinanziert ist und das bisherige Erziehungsgeld ersetzt. Der Unterschied zwischen dem einkommensorientierten Erziehungsgeld und dem am individuellen Einkommen orientierten Elterngeld wird kurz angesprochen.
Warum führt die Bundesregierung das Elterngeld ein?: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für die Einführung des Elterngeldes. Es argumentiert, dass die finanziellen Einbußen durch Erwerbsunterbrechungen in den ersten Lebensjahren der Kinder zu einer Benachteiligung von Familien führen. Die niedrige Geburtenrate in Deutschland, mit weitreichenden Folgen für die soziale Sicherung und die Wirtschaft, wird als zentrale Motivation für die Gesetzesinitiative genannt. Das Elterngeld soll Familien fördern und dem demografischen Wandel entgegenwirken.
Elternzeit und „Vatermonate“ im internationalen Vergleich: (Leider sind keine Informationen über einen solchen Vergleich in dem gegebenen Text enthalten. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Antragstellung: (Leider sind keine Informationen über die Antragstellung im gegebenen Text enthalten. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Elterngeld: (Leider sind keine Informationen über die Anspruchsvoraussetzungen im gegebenen Text enthalten. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Bezugszeitraum: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bezugszeitraum des Elterngeldes, einschließlich der verfassungsrechtlichen Aspekte, der Verteilung der Partnermonate und Beispielen für den Elterngeldbezug. Es wird die Rechtfertigung der Bevorzugung von Doppelverdienern durch das Ziel des Gesetzgebers erläutert, die individuelle Situation der Eltern zu berücksichtigen und unterschiedliche Präferenzen für Beruf und Familie zu unterstützen. Die komplexen Regelungen zur Elternzeit und Elternteilzeit, die weitgehend aus dem alten Recht übernommen wurden, werden kritisch betrachtet.
Das Regelelterngeld: Dieses Kapitel beschreibt das Regelelterngeld, einschließlich der Einkommensberechnung für Arbeitnehmer und Selbstständige und der Frage, ob Elternzeit für den Bezug erforderlich ist. Es geht detailliert auf die Berechnungsmethoden ein und hebt Unterschiede im Vergleich zum vorherigen Recht hervor.
Besondere Elterngeldbezüge: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Sonderformen des Elterngeldes, wie Mindestelterngeld, Niedrigverdienerelterngeld, Teilzeitarbeitelterngeld, Mehrkinderelterngeld und Mehrlingsgeburtenelterngeld. Es erläutert die spezifischen Bedingungen und Berechnungen für jeden dieser Fälle und zeigt die differenzierte Unterstützung für unterschiedliche Familiensituationen.
Verhältnis von Elterngeld zu anderen Leistungen: Dieses Kapitel beschreibt das Zusammenspiel des Elterngeldes mit anderen Leistungen wie Mutterschaftsgeld und Unterhalt. Es beleuchtet die Anrechnungsfreiheit des Mindestelterngeldes und das Verhältnis zu Entgeltersatzleistungen. Die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Sozialleistungen werden analysiert.
Nachweispflichten: (Leider sind keine Informationen über die Nachweispflichten im gegebenen Text enthalten. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Rechtsweg, Zuständigkeit und Steuerpflicht: (Leider sind keine Informationen über den Rechtsweg, die Zuständigkeit und die Steuerpflicht im gegebenen Text enthalten. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Elterngeld, Erziehungsgeld, Elternzeit, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Einkommensersatzleistung, demografischer Wandel, Geburtenrate, Familienförderung, Verfassungsrecht, Sozialleistungen.
Häufig gestellte Fragen zum Elterngeldgesetz
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Elterngeldgesetz, einschließlich Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Es analysiert die zentralen Bestimmungen des Gesetzes und beleuchtet dessen Auswirkungen auf Familien.
Warum wurde das Elterngeld eingeführt?
Die Bundesregierung führte das Elterngeld ein, um finanzielle Einbußen von Familien durch Erwerbsunterbrechungen in den ersten Lebensjahren der Kinder auszugleichen. Die niedrige Geburtenrate in Deutschland und deren Auswirkungen auf die soziale Sicherung und Wirtschaft waren zentrale Motivationsfaktoren. Das Elterngeld soll Familien fördern und dem demografischen Wandel entgegenwirken.
Was sind die wichtigsten Themen des Dokuments?
Das Dokument behandelt unter anderem die Funktionsweise des Elterngeldes, einen Vergleich mit dem vorherigen Erziehungsgeld, Anspruchsvoraussetzungen und Bezugszeitraum, verfassungsrechtliche Aspekte, die Berechnung des Elterngeldes (inkl. Sonderfälle wie Mindestelterngeld, Niedrigverdienerelterngeld etc.), das Verhältnis zu anderen Leistungen (z.B. Mutterschaftsgeld, Unterhalt) und die Nachweispflichten.
Wie ist der Bezugszeitraum des Elterngeldes geregelt?
Das Dokument beschreibt den Bezugszeitraum des Elterngeldes, einschließlich der verfassungsrechtlichen Aspekte, der Verteilung der Partnermonate und Beispiele. Es erläutert die Rechtfertigung der Bevorzugung von Doppelverdienern und kritisch die komplexen Regelungen zur Elternzeit und Elternteilzeit.
Wie wird das Elterngeld berechnet?
Das Dokument beschreibt die Berechnung des Regelelterngeldes für Arbeitnehmer und Selbstständige. Es geht detailliert auf die Berechnungsmethoden ein und hebt Unterschiede im Vergleich zum vorherigen Recht hervor. Zusätzlich werden die Berechnungen für besondere Elterngeldbezüge (Mindestelterngeld, Niedrigverdienerelterngeld, Teilzeitarbeitelterngeld, Mehrkinderelterngeld und Mehrlingsgeburtenelterngeld) erläutert.
Wie verhält sich das Elterngeld zu anderen Leistungen?
Das Dokument analysiert das Zusammenspiel des Elterngeldes mit anderen Leistungen wie Mutterschaftsgeld und Unterhalt. Es beleuchtet die Anrechnungsfreiheit des Mindestelterngeldes und das Verhältnis zu Entgeltersatzleistungen. Die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Sozialleistungen werden untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Elterngeldgesetz verbunden?
Schlüsselwörter sind: Elterngeld, Erziehungsgeld, Elternzeit, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Einkommensersatzleistung, demografischer Wandel, Geburtenrate, Familienförderung, Verfassungsrecht, Sozialleistungen.
Welche Kapitel fehlen im Dokument, obwohl sie im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind?
Die Kapitel "Elternzeit und „Vatermonate“ im internationalen Vergleich", "Antragstellung", "Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Elterngeld", "Nachweispflichten" und "Rechtsweg, Zuständigkeit und Steuerpflicht" enthalten im vorliegenden Text keine Informationen und konnten daher nicht zusammengefasst werden.
- Citation du texte
- Sylvia Königsberger (Auteur), Manuela Lippold (Auteur), 2007, Das neue Elterngeldgesetz (Stand 2007), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79658