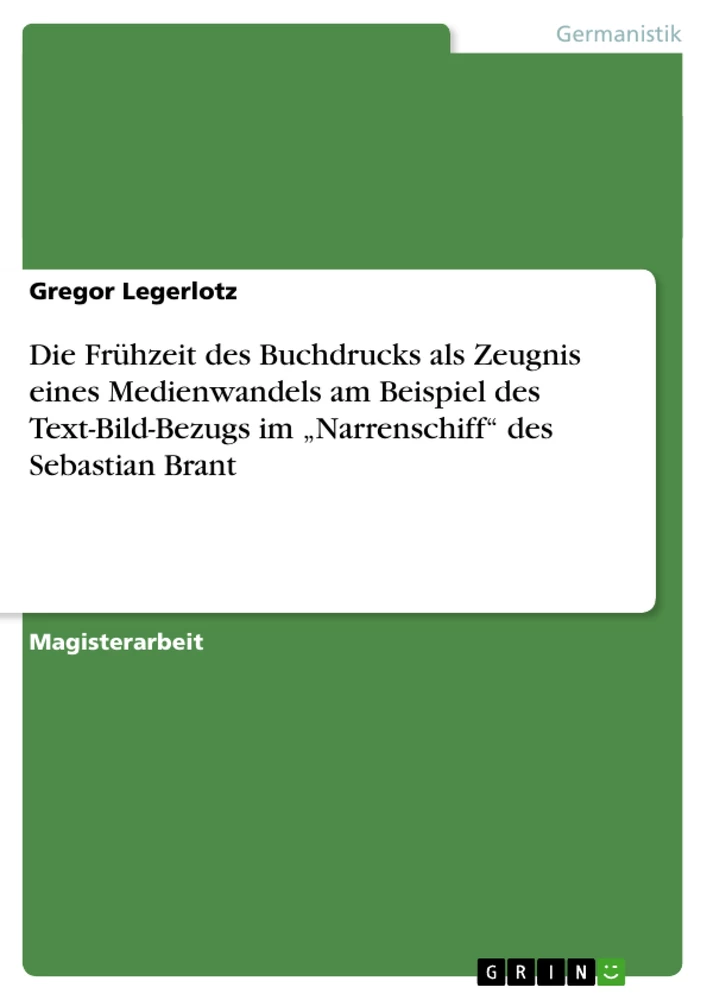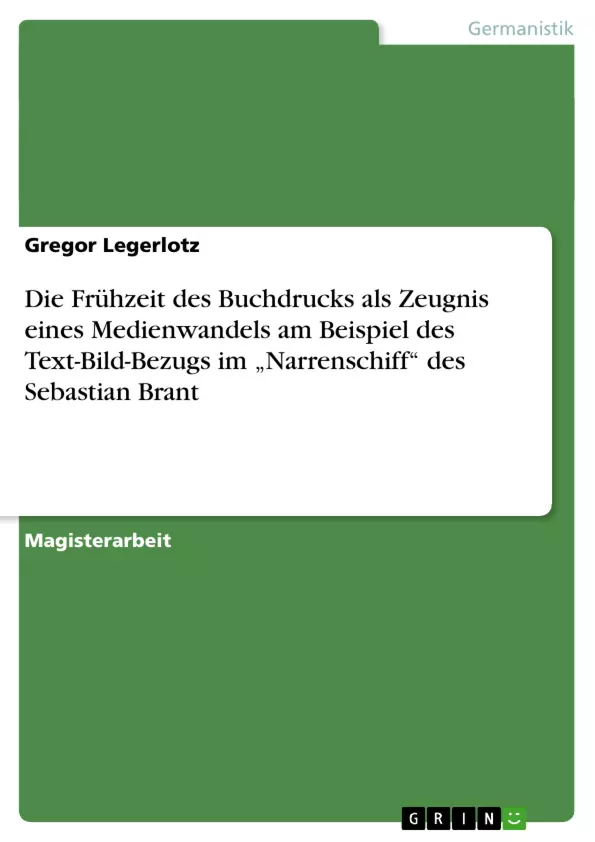Ab den 1440er Jahren experimentiert Gutenberg mit der Möglichkeit, Geschriebenes exakt reproduzieren zu können. Als er 1456 eine gedruckte Vollversion der Bibel vorlegt – des bedeutendsten Buchs, das seine Zeitgenossen kennen – sind sich alle einig: Der Buchdruck ist die Technologie der Zukunft, um Wissen zu bewahren.
Auch der Gelehrte Sebastian Brant aus Straßburg weiß die neue Technik für seine Zwecke zu nutzen. Brant ist Mitte der 1490er-Jahre einer der führenden Humanisten im deutschen Sprachraum. Sein bekanntestes Werk ist „Das Narrenschiff“. Geschickt versteht er es, die neue Buchdrucktechnik für den Zweck der Verbreitung humanistischen Gedankenguts und seiner Ideen über die Erziehung des Menschen zu verwenden.
Diese Arbeit untersucht am Beispiel des „Narrenschiffs“, wie Humanismus und Buchdruck geistesgeschichtlich zusammenhängen und was den Buchdruck von anderen Methoden der Wissensaufbewahrung, etwa bebilderte Sammelhandschriften, unterscheidet. Der zentrale Aspekt ist der Text-Bild-Bezug in Brants Werk. So stellt sich etwa die Frage: Wie funktioniert der Text-Bild-Bezug im gedruckten Buch im Unterschied zur Sammelhandschrift?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Medien als Forschungsproblem
- Gegenstandsbestimmung
- Grundlegende Positionen zum Medien-Begriff
- Medientheorie zwischen Aktualität und Forschungstradition
- Bebilderte Bücher als Medien
- Medienwandel: Oralität – Skriptographie – Typographie
- Oralität
- Mündlich tradierte Information und ihre Kodierung
- Die Schaffensbedingungen oral tradierter Literatur
- Mündlichkeit und Bildlichkeit: Bilder im Kopf
- Skriptographie
- Die sozialen Voraussetzungen für die Prämierung der Skriptographie
- Text und Bild in bebilderten Sammelhandschriften
- Die Typographie: Eine Brücke zwischen Bild und Text
- Das „Narrenschiff“ als Produkt seiner Zeit
- Zeit als Zeugnis und Zeugnisse einer Zeit
- Das Wissen über die Anfänge der Typographie: Die Quellenlage
- Das Kolophon des „Catholicons“ als Zeugnis des frühen Buchdrucks
- Der Holzschnitt aus „La Danse macabre“ und die Buchdruckkunst
- Die Quellenlage der bildlichen Überlieferung des Buchdrucks
- Exkurs: Der mittelalterliche Totentanz
- Der Holzschnitt von 1499/1500 als Zeugnis seiner Zeit
- Die Kritik der Typographie: der zeitgeschichtliche Blickwinkel
- Die Kritik der Typographie: Der mediengeschichtliche Blickwinkel
- Text- und Bildmedien der frühen Typographie - Das Beispiel: Die Flugschriften von Sebastian Brant
- Das Kolophon des Catholicons als Textmedium
- Die Flugschriften Brants als Bildmedium
- Die Flugschriften Brants als Textmedium
- Der Text-Bild-Bezug im „Narrenschiff“ als Medium
- Der Text im „Narrenschiff“ als Medium
- Die Bilder im „Narrenschiff“ als Medium
- Medienwandel: Die Arbeit verfolgt die Entwicklung von der Oralität über die Skriptographie zur Typographie.
- Frühzeit des Buchdrucks: Die Arbeit untersucht die technologischen und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Typographie anhand von frühen Quellen.
- Text-Bild-Bezug: Die Arbeit analysiert die Verwendung von Bild und Text im „Narrenschiff“ und untersucht deren medialen Eigenschaften.
- Visualisierung: Die Arbeit erörtert die Bedeutung der Zentralperspektive als Resultat der Visualisierung und deren Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit.
- Wissenswandel: Die Arbeit beleuchtet den Wandel vom analogen Wissensspeicher zum dynamischen Wissenserweiterungsprozess, der mit der Prämierung der Typographie einhergeht.
- Kapitel 1 beleuchtet den Medienbegriff und analysiert verschiedene Ansätze, die ein Medium als Informationsträger, Informationsüberträger und „Ausweitung des Menschen“ begreifen.
- Kapitel 2 beschreibt die mediengeschichtliche Entwicklung von der Oralität über die Skriptographie zur Typographie. Dabei werden die sozialen und kulturellen Voraussetzungen für die Prämierung der einzelnen Medien beleuchtet.
- Kapitel 3 beleuchtet die Frühzeit des Buchdrucks anhand von frühen Quellen, wie dem Kolophon des „Catholicons“ und dem Holzschnitt aus „La Danse macabre“.
- Kapitel 4 erörtert die Visualisierung im „Narrenschiff“ und analysiert die Bedeutung der Zentralperspektive in Bild und Text als Werkzeug zur Konstruktion von Wirklichkeit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Einführung des Buchdrucks als Medienwandel in der Geschichte. Das Werk „Das Narrenschiff“ von Sebastian Brant wird dabei als Beispiel für die Nutzung von Bild und Text als Medien untersucht, da die Bilder zu den einzelnen Kapiteln den dazugehörigen Text illustrieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet die Mediengeschichte, beginnend mit der Oralität, über die Skriptographie bis hin zur Typographie. Sie untersucht, wie Informationen in den verschiedenen Epochen verwaltet und tradiert wurden. Dabei wird die Rolle von Bild und Text als Medien und deren Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit beleuchtet. Die Arbeit analysiert „Das Narrenschiff“ von Sebastian Brant als Beispiel für die medialen Entwicklungen der frühen Typographie. Sie zeigt, wie Brant das Medium Buchdruck für die Verbreitung seiner moralischen Ansichten und zur Vermittlung seines Weltbildes nutzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Schlüsselbegriffen wie Oralität, Skriptographie, Typographie, Medienwandel, Visualisierung, Zentralperspektive, Text-Bild-Bezug, „Narrenschiff“, Sebastian Brant, Wissenswandel, „Neue Welt“, und die Bedeutung von Medien für die Konstruktion von Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung von Gutenbergs Buchdruck für den Humanismus?
Der Buchdruck ermöglichte die exakte Reproduktion und schnelle Verbreitung humanistischen Gedankenguts, wie es Sebastian Brant im „Narrenschiff“ tat.
Worum geht es in Sebastian Brants „Narrenschiff“?
Es ist ein moralisierendes Werk, das menschliche Laster und Fehlverhalten als „Narrheiten“ darstellt und zur Erziehung des Menschen beitragen soll.
Wie unterscheidet sich der Text-Bild-Bezug im Druck von der Handschrift?
Im gedruckten Buch wie dem „Narrenschiff“ sind Text und Holzschnitte fest einander zugeordnet und bilden eine mediale Einheit zur Wissensvermittlung.
Was ist der „Medienwandel“ von Oralität zur Typographie?
Es beschreibt den Übergang von mündlicher Überlieferung (Oralität) über handgeschriebene Texte (Skriptographie) hin zum mechanischen Buchdruck (Typographie).
Welche Rolle spielt die Visualisierung in frühen Drucken?
Bilder dienten nicht nur der Illustration, sondern halfen als Bildmedium dabei, komplexe moralische Botschaften auch weniger gebildeten Schichten zugänglich zu machen.
- Citation du texte
- Gregor Legerlotz (Auteur), 2000, Die Frühzeit des Buchdrucks als Zeugnis eines Medienwandels am Beispiel des Text-Bild-Bezugs im „Narrenschiff“ des Sebastian Brant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79833