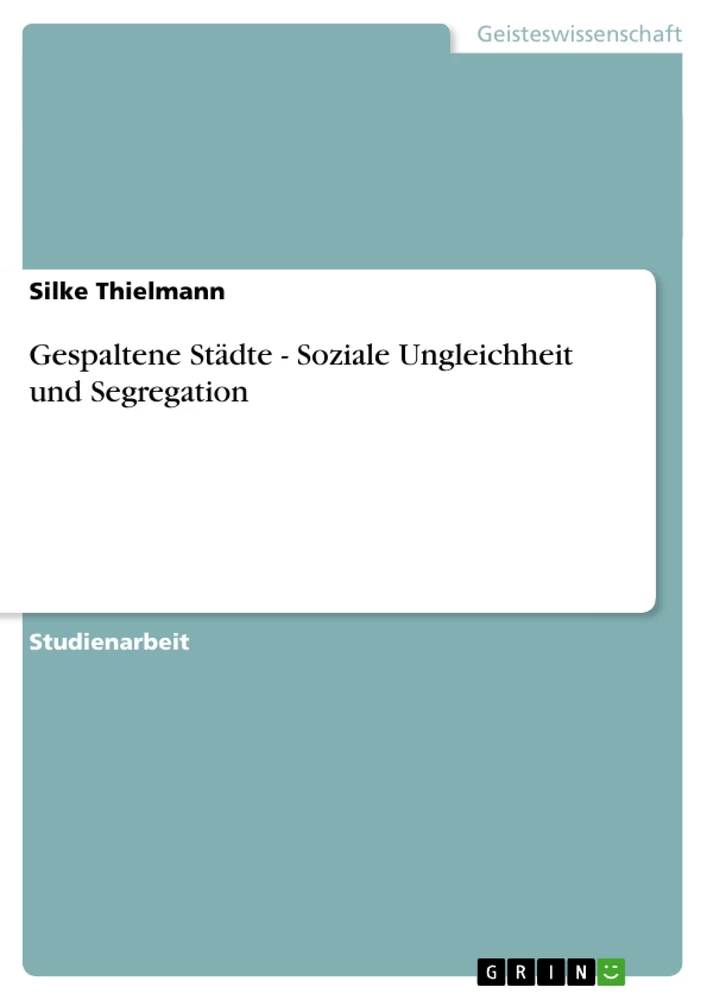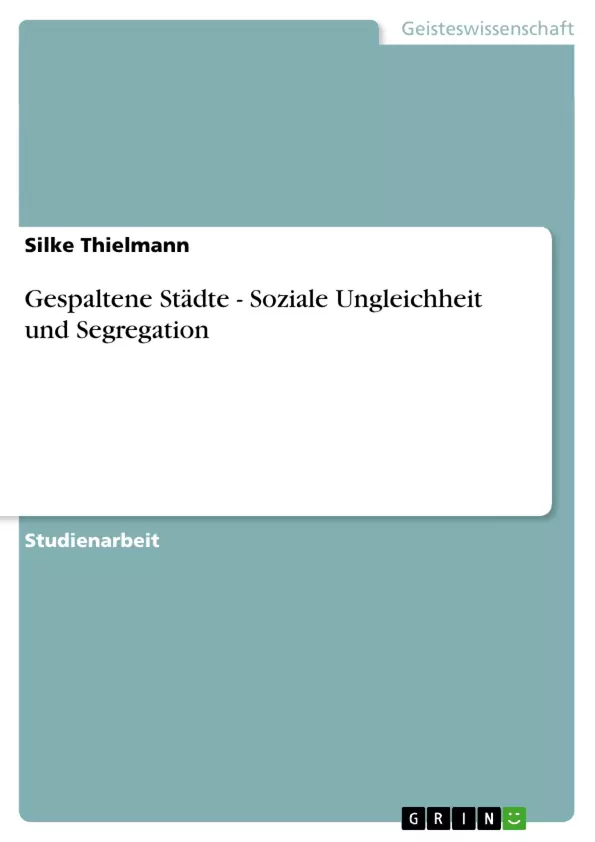Es scheint einfach zu sein, aus Problemvierteln attraktive Einzugsgebiete zu machen. Es stellt sich mir die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, das Kranichstein sich zu einem ‚Brennpunkt’ entwickelte und wieso es nicht eine ähnlich positive Entwicklung für alle anderen ‚Brennpunkte’ in anderen Städten Deutschlands gibt. Städte, in denen sich Armut und sozialer Abstieg in einem Maße zu kumulieren scheinen, dass diese Bildung von Armutsinseln in unserer Wohlstandsgesellschaft kaum von Zufall bestimmt sein kann.
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich mich erst mit den Begriffen Armut und Ausgrenzung beschäftigen, um dann zu betrachten, in welchem Wirkungsverhältnis sie mit der zunehmenden Polarisierung innerhalb der deutschen Großstädte stehen. Sind sie Ursache oder Folge, welche Prozesse spielen außerdem eine Rolle und welche Auswirkungen haben sie auf die Bewohner dieser so genannten marginalen1 Quartiere?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armut und Ausgrenzung
- Armut in Deutschland
- Soziale Ausgrenzung
- Ausgrenzung durch räumliche Segregation?
- Polarisierungstendenzen deutscher Städte
- Die makrosoziale Perspektive: Gesellschaftliche Trends und Segregation
- Die mikrosoziale Perspektive: Handlungen, Entscheidungen und Präferenzen
- Die mesosoziale Perspektive: Quartierseigenschaften und Quartierstypen
- Multiple Deprivation im Quartier
- Lage- und Quartierseffekte auf die Bewohner benachteiligter Quartiere:
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die zunehmende räumliche Konzentration von marginalisierten Gruppen in deutschen Städten auf die Lebenschancen der Bewohner auswirkt. Sie untersucht dabei den Zusammenhang zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung und räumlicher Segregation, indem sie verschiedene Polarisierungstendenzen und deren Ursachen aus makrosozialer, mikrosozialer und mesosozialer Perspektive analysiert.
- Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland
- Die Folgen der ökonomischen Umstrukturierung für die Stadtentwicklung
- Räumliche Segregation und ihre Auswirkungen auf die Lebenschancen der Bewohner
- Das Zusammenspiel von makrosozialen, mikrosozialen und mesosozialen Faktoren bei der Bildung von marginalen Quartieren
- Die Rolle von Wohnungsmarkt, Politik und Migration bei der Segregation benachteiligter Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der räumlichen Konzentration von marginalisierten Gruppen in deutschen Städten anhand des Beispiels Kranichstein in Darmstadt vor und erläutert den Zusammenhang zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung und Segregation.
- Armut und Ausgrenzung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Armut“ und „soziale Ausgrenzung“ und stellt die aktuelle Situation in Deutschland dar. Es werden verschiedene Ansätze zur Messung von Armut sowie die unterschiedlichen Dimensionen der sozialen Ausgrenzung erläutert.
- Ausgrenzung durch räumliche Segregation?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Polarisierungstendenzen in deutschen Städten und analysiert die Ursachen der Segregation aus makrosozialer, mikrosozialer und mesosozialer Perspektive. Es werden dabei verschiedene Modelle der „geteilten Stadt“ sowie die Prozesse der Gentrifizierung, Suburbanisierung und Segregation benachteiligter Gruppen vorgestellt.
- Lage- und Quartierseffekte auf die Bewohner benachteiligter Quartiere: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen von marginalen Quartieren auf die Bewohner. Es werden die Herausbildung homogener Netze, der Mangel an alternativen Handlungsvorbildern, Stigmatisierungsprozesse und die Verringerung der sozialen Stabilität im Quartier betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen soziale Ungleichheit, Segregation, Armut, Ausgrenzung, Stadtentwicklung, Wohnungsmarkt, Gentrifizierung, Suburbanisierung, ethnische Segregation, Quartierstypen, Multiple Deprivation und soziale Mobilität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet räumliche Segregation in deutschen Städten?
Segregation bezeichnet die räumliche Trennung und Konzentration bestimmter Bevölkerungsgruppen (z. B. nach Einkommen oder ethnischer Herkunft) in spezifischen Stadtvierteln, was oft zur Bildung von „Problemvierteln“ führt.
Wie hängen Armut und soziale Ausgrenzung zusammen?
Armut ist oft die Ursache für soziale Ausgrenzung. In benachteiligten Quartieren kumulieren sich Faktoren wie Arbeitslosigkeit und geringe Bildungschancen, was die Teilhabe an der Gesellschaft erschwert.
Was sind Quartierseffekte?
Quartierseffekte beschreiben den Einfluss des Wohnumfelds auf die Bewohner. Dazu gehören Stigmatisierungsprozesse, der Mangel an positiven Rollenvorbildern und die Herausbildung homogener, wenig hilfreicher sozialer Netzwerke.
Welche Rolle spielt die Gentrifizierung bei der Stadtspaltung?
Gentrifizierung führt zur Aufwertung von Vierteln, verdrängt aber gleichzeitig einkommensschwache Gruppen in andere, oft marginalisierte Quartiere, was die Polarisierung der Stadt verstärkt.
Was ist mit "Multiple Deprivation" gemeint?
Dieser Begriff beschreibt das gleichzeitige Auftreten mehrerer Benachteiligungen in einem Quartier, wie schlechte Wohnverhältnisse, hohe Kriminalität, mangelnde Infrastruktur und soziale Armut.
- Citation du texte
- Silke Thielmann (Auteur), 2006, Gespaltene Städte - Soziale Ungleichheit und Segregation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79860