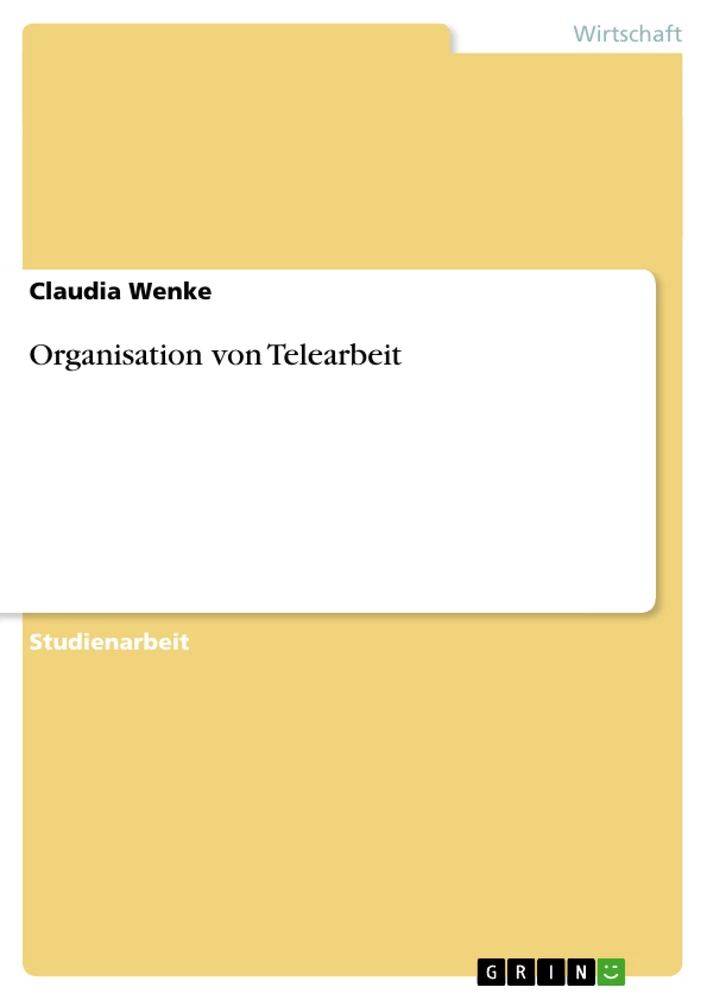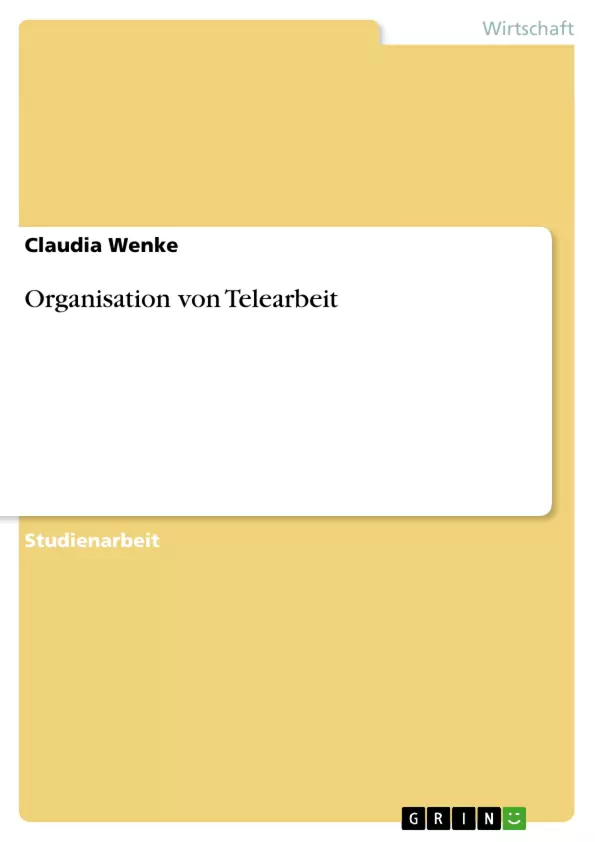So wie die Erfindung der Dampfmaschine, welche die Industrielle Revolution ins Rollen brachte und Erwerbsarbeit grundlegend veränderte, wird Telearbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts als die Arbeitsform der Zukunft diskutiert.
Telearbeit als Begriff ist schwer zu fassen, da die unterschiedlichsten organisatorischen und technischen Ausprägungen existieren.
Die klassische Definition der Telearbeit könnte verkürzt heißen:
Tätigkeiten an einem Computerarbeitsplatz außerhalb eines Unternehmens, der in der Regel eine Kommunikationsanbindung hat.
Telearbeit ist in Anlehnung an eCommerce bzw. eBusiness, als eWork zu sehen.
Laut einer Informationsschrift des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ,, Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts"1 ist ,,das Potential von Telearbeit in Deutschland bei weitem noch nicht erschlossen. Bisher gibt es erst rund 800.000 Telearbeitsplätze. Dem steht ein Gesamtvolumen von 2 bis 4 Millionen möglichen Telearbeitsplätzen gegenüber. Telearbeiterinnen und Telearbeiter machen in der Bundesrepublik nach einer Studie der Frauenhofer-Gesellschaft erst einen Anteil von 2,2 % am Arbeitskräftepotential aus, im Vergleich zu einem Anteil von 14 % in Großbritannien/ Irland und 8,7 % in den USA/ Kanada. Dabei ist auch hier die Beteiligung von Frauen unterproportional. Nur etwa 40 % der Telearbeiter sind Frauen."
Neben den offiziell initiierten Telearbeitsprojekten, vor allem in größeren Firmen (wie zum Beispiel die Deutsche Telekom und der deutsche Personaldienstleister timepower - Personal - Dienstleistungen, die im Januar 1999 das erste Telearbeit Service Center in Stendal(Sachsen - Anhalt) eröffnet haben2), ist festzustellen, dass Telearbeit häufig nicht offen auftritt. Gerade kleinere Unternehmen wollen den Begriff Telearbeit vermeiden, um rechtliche und organisatorische Aufwendungen möglichst gering zu halten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Aspekte der Telearbeit
- Klassische Definition der Telearbeit
- Differenzierungsmerkmale von Telearbeit
- Formen der Telearbeit
- Teleheimarbeit
- Alternierende Arbeit
- Mobile Telearbeit
- Telecenter
- Satellitenbüro
- Organisatorische und personelle Aspekte der Telearbeit
- Umsetzung von Telearbeit in Unternehmen
- Die Wirtschaftlichkeit von Telearbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Organisation von Telearbeit, beleuchtet verschiedene Aspekte und Formen der Telearbeit und analysiert deren Vor- und Nachteile für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Region. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den organisatorischen Herausforderungen.
- Definition und Abgrenzung von Telearbeit
- Verschiedene Formen der Telearbeit (Teleheimarbeit, mobile Telearbeit etc.)
- Organisatorische und personelle Aspekte der Telearbeit
- Umsetzung von Telearbeit in Unternehmen
- Wirtschaftliche Aspekte der Telearbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt Telearbeit als Arbeitsform des 21. Jahrhunderts und hebt die Schwierigkeiten hervor, den Begriff präzise zu definieren, da es zahlreiche organisatorische und technische Ausprägungen gibt. Sie verweist auf das noch weitgehend unerschlossene Potential von Telearbeit in Deutschland und nennt Statistiken zur aktuellen Verbreitung und zur Unterrepräsentation von Frauen in diesem Bereich. Des Weiteren wird die Tendenz kleinerer Unternehmen angesprochen, den Begriff Telearbeit zu vermeiden, um rechtliche und organisatorische Aufwände zu minimieren.
Aspekte der Telearbeit: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Telearbeit aus verschiedenen Perspektiven. Es präsentiert Definitionen aus offiziellen Quellen wie dem Bundeswirtschaftsministerium und aus Fachliteratur, wobei die unterschiedlichen Aspekte wie die Art der Tätigkeit, der Ort, die Zeit und die rechtliche Einordnung beleuchtet werden. Die Definitionen umfassen die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken für die Arbeitsausübung außerhalb des traditionellen Betriebssitzes. Die verschiedenen Definitionsansätze verdeutlichen die Komplexität und Vielschichtigkeit des Konzepts.
Formen der Telearbeit: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen der Telearbeit, darunter Teleheimarbeit (ausschließlich in der Wohnung), alternierende Telearbeit (Wechsel zwischen Büro und Wohnung), mobile Telearbeit (ortsunabhängig), Telecenter (dezentrale, kollektive Form) und Satellitenbüro (Büroräume in der Nähe der Wohnorte der Mitarbeiter). Es erläutert die jeweiligen Charakteristika und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen, unter Berücksichtigung der damit verbundenen Arbeitsbedingungen und organisatorischen Anforderungen.
Organisatorische und personelle Aspekte der Telearbeit: Dieser Abschnitt behandelt die Vor- und Nachteile von Telearbeit aus verschiedenen Perspektiven (Telearbeiter, Unternehmen, Region). Es werden potentielle Probleme wie soziale Isolation, schlechtere Karrieremöglichkeiten und die Schwierigkeit der Trennung von Beruf und Privatleben angesprochen. Zusätzlich werden Fragen der Kommunikation, der Eignung von Mitarbeitern und Vorgesetzten für Telearbeit und die notwendige Befähigung der Beteiligten erörtert. Die Kapitel untersuchen die Kriterien für die Auswahl geeigneter Tätigkeiten und die Gestaltung der Arbeitsteilung.
Umsetzung von Telearbeit in Unternehmen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Einführung von Telearbeit in Unternehmen. Es untersucht die Schritte und Überlegungen, die für eine erfolgreiche Implementierung notwendig sind, einschließlich der Berücksichtigung organisatorischer, technischer und personeller Aspekte. Die wirtschaftlichen Aspekte werden ebenfalls angesprochen, auch wenn eine detaillierte Betrachtung in einem separaten Kapitel erfolgt.
Die Wirtschaftlichkeit von Telearbeit: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftlichen Aspekte der Telearbeit, wobei sowohl Kosten-Nutzen-Analysen aus Unternehmensperspektive als auch aus gesellschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Die wirtschaftliche Effizienz und die langfristigen Auswirkungen auf die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen werden diskutiert. Die möglichen Einsparungen durch reduzierten Platzbedarf und die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit werden ebenso betrachtet wie potentielle Nachteile.
Schlüsselwörter
Telearbeit, Homeoffice, Mobile Arbeit, Organisationsform, Informations- und Kommunikationstechniken, Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, Umsetzung, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Telearbeit"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Telearbeit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und abschließend Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Organisation von Telearbeit, den verschiedenen Aspekten und Formen, sowie deren Vor- und Nachteilen für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Region. Die praktische Umsetzung und die organisatorischen Herausforderungen werden besonders hervorgehoben.
Welche Aspekte der Telearbeit werden behandelt?
Das Dokument behandelt diverse Aspekte der Telearbeit, darunter: die Definition und Abgrenzung von Telearbeit; verschiedene Formen der Telearbeit (Teleheimarbeit, mobile Telearbeit etc.); organisatorische und personelle Aspekte; die Umsetzung von Telearbeit in Unternehmen; und die Wirtschaftlichkeit von Telearbeit. Es werden sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen und potentiellen Probleme beleuchtet.
Welche Formen der Telearbeit werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet verschiedene Formen der Telearbeit: Teleheimarbeit (ausschliesslich zuhause), alternierende Telearbeit (Wechsel zwischen Büro und zuhause), mobile Telearbeit (ortsunabhängig), Telecenter (dezentrale, kollektive Form) und Satellitenbüro (Büroräume in der Nähe der Wohnorte der Mitarbeiter). Die jeweiligen Charakteristika und Unterschiede werden detailliert beschrieben.
Welche organisatorischen und personellen Aspekte werden betrachtet?
Die organisatorischen und personellen Aspekte umfassen die Vor- und Nachteile von Telearbeit aus verschiedenen Perspektiven (Telearbeiter, Unternehmen, Region). Es werden potentielle Probleme wie soziale Isolation, schlechtere Karrieremöglichkeiten und die Schwierigkeit der Trennung von Beruf und Privatleben angesprochen. Zusätzlich werden Fragen der Kommunikation, der Eignung von Mitarbeitern und Vorgesetzten für Telearbeit und die notwendige Befähigung der Beteiligten erörtert. Die Kriterien für die Auswahl geeigneter Tätigkeiten und die Gestaltung der Arbeitsteilung werden untersucht.
Wie wird die Wirtschaftlichkeit von Telearbeit behandelt?
Die Wirtschaftlichkeit der Telearbeit wird aus Unternehmensperspektive und aus gesellschaftlicher Perspektive analysiert. Es werden Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt, die wirtschaftliche Effizienz und die langfristigen Auswirkungen auf die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen diskutiert. Sowohl mögliche Einsparungen (z.B. reduzierter Platzbedarf) als auch potentielle Nachteile werden betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments prägnant beschreiben, sind: Telearbeit, Homeoffice, Mobile Arbeit, Organisationsform, Informations- und Kommunikationstechniken, Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, Umsetzung und Herausforderungen.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Dokument enthält Kapitelzusammenfassungen, die einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels geben. Diese Zusammenfassungen bieten eine gute Grundlage für ein tiefergehendes Verständnis des Themas Telearbeit.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Telearbeit auseinandersetzen, sei es aus akademischer, beruflicher oder persönlicher Perspektive. Dies beinhaltet Studenten, Forscher, Unternehmensleiter, Personalverantwortliche und Telearbeiter selbst.
- Citation du texte
- Claudia Wenke (Auteur), 2002, Organisation von Telearbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7989