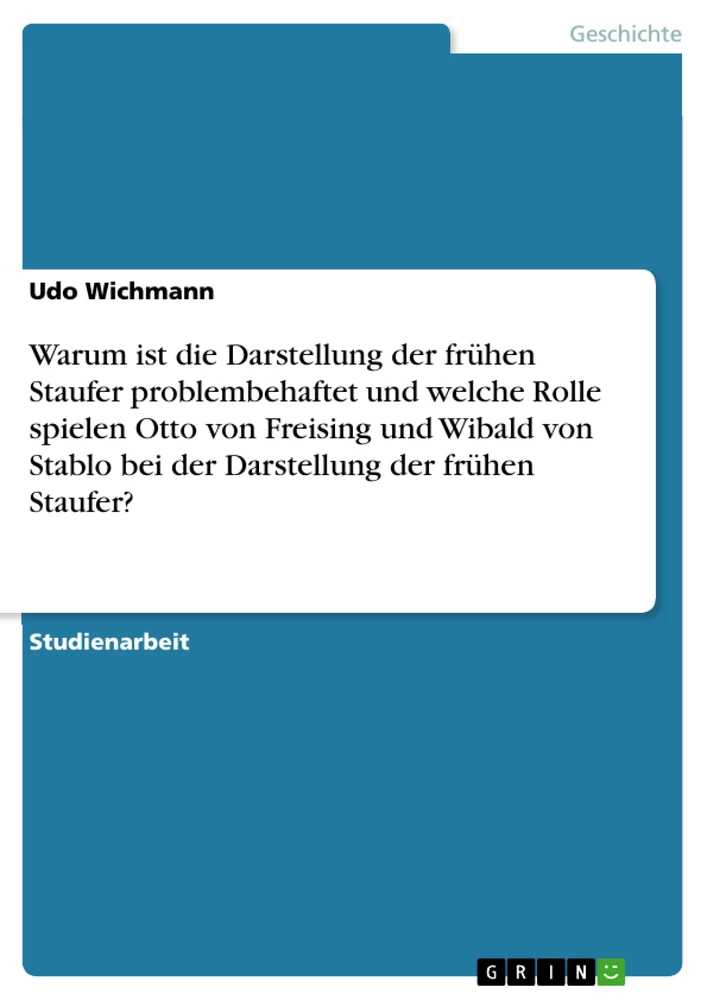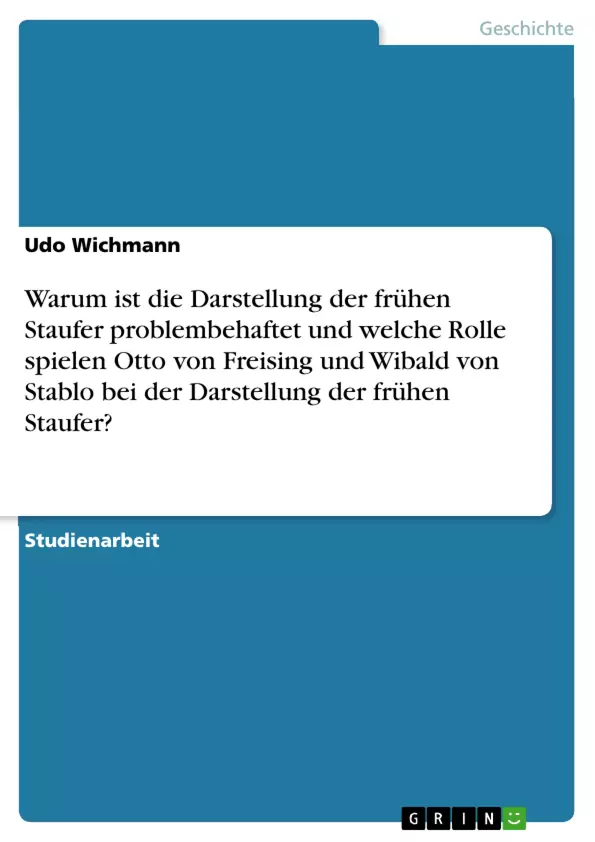In dieser Hausarbeit möchte ich die darstellen, welche Rollen sowohl Otto von Freising als auch Wibald von Stablo bei der Darstellung der frühen Staufer gespielt haben und weshalb die Darstellung der frühen Staufer sich als sehr schwierig und problematisch gestaltet. Bei der folgenden Ausarbeitung wird dargestellt, welches Dilemma sich für einen Historiker ergibt, sofern er nur über eine ungenügende Quellengrundlage verfügt.
Um die Anfänge der frühen Staufer zu beleuchten und um eine historische Einordnung vorzunehmen bedarf es an Quellen, die von dieser Zeit jedoch sehr spärlich vorhanden sind. Die Quellenbasis wird sich daher lediglich auf Otto von Freisings Gesta Friderici und Wibald von Stablos Verwandschaftstafel der Staufer beziehen. Beide sind anerkannt als bedeutende Geschichtsschreiber des Mittelalters.
Zudem beziehe ich einige weitere Werke aus dem Bereich der Sekundärliteratur von anerkannten Historikern mit ein. Von zentraler Bedeutung sind dabei die Werke von Hubertus Seibert/ Jürgen Dendorfer und Odilo Engels, welche sich mit der Herkunft der frühen Staufer beschäftigen und somit unmittelbar auf die beiden Geschichtsschreiber Otto von Freising und Wibald von Stablo eingehen.
Die damalige Forschung beruft sich auf die Quellen Otto von Freisings Gesta Friderici und Wibald von Stablos Verwandschaftstafel, denn Wibald von Stablo erstellte im Auftrag Friedrich Barbarossas eine Tafel, die die Herkunft der Staufer aufzeigt bis zu Friedrich Barbarossa . Zudem stellt die neuere Forschung einen stärkeren Bezug zum Vorgänger Barbarossas, Konrad III., her, um die Erkenntnisse des staufischen Aufstiegs besser verstehen zu können. . Die Forschung ist sich jedoch in einer Sache sicher: Der Aufstieg der Staufer ist durch ihr Konnubium (Heiratspolitik) und ihre Verwandtschaft zu den Saliern zu erklären. Außerdem wird die Symbolik der Burg Staufen überschätzt, denn sowohl das Fehlen eindeutiger Quellen als auch Bezug weniger Friedrich zu Hohenstaufen weisen darauf hin, dass der Ort „keine besondere Funktion als namengebender Herrschaftssitz einnahm“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Quellengrundlage
- Forschungslage
- Darstellung der frühen Staufer
- Otto von Freising und die Gesta Friderici
- Wibald von Stablo und seine Verwandschaftstafel
- Die Geschichte der frühen Staufer
- Problematik der Quellengrundlage
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Quellen
- Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung der frühen Staufer, insbesondere mit der Rolle von Otto von Freising und Wibald von Stablo in diesem Kontext. Sie untersucht, warum die Darstellung der frühen Staufer problematisch ist und welche Herausforderungen sich für Historiker aus einer ungenügenden Quellengrundlage ergeben.
- Die Rolle von Otto von Freising und Wibald von Stablo bei der Darstellung der frühen Staufer
- Die Problematik der Quellengrundlage für die frühe Staufergeschichte
- Die Herausforderungen bei der historischen Einordnung der frühen Staufer
- Die Bedeutung von Primärquellen wie der Gesta Friderici und der Verwandschaftstafel
- Die Entwicklung der Forschung zur frühen Staufergeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Hausarbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der Quellengrundlage sowie die aktuelle Forschungslage. Sie zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der spärlichen Quellenlage ergeben.
Das Kapitel "Darstellung der frühen Staufer" analysiert die Rolle von Otto von Freising und Wibald von Stablo. Otto von Freising, als Chronist des hohen Mittelalters, verfasste die Gesta Friderici, ein Werk, welches die Geschichte seines Neffen Friedrich Barbarossa beschreibt. Wibald von Stablo erstellte auf Wunsch Friedrich Barbarossas eine Verwandschaftstafel, die die Herkunft der Staufer bis zu Friedrich Barbarossa aufzeigt.
Das Kapitel "Problematik der Quellengrundlage" stellt die Schwierigkeiten dar, die sich aus der begrenzten Anzahl von Primärquellen ergeben. Es beleuchtet die Bedeutung der Gesta Friderici und der Verwandschaftstafel, die jedoch kritisch zu betrachten sind. Die Arbeit untersucht die Rolle des Konnubiums (Heiratspolitik) und der Verwandtschaft zu den Saliern im staufischen Aufstieg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der frühen Staufer, die Rolle von Otto von Freising und Wibald von Stablo, die Problematik der Quellengrundlage, die Gesta Friderici, die Verwandschaftstafel, Konnubium, Staufer, Welfen, Salier, mittelalterliche Geschichtsschreibung, Herrschaftsaufbau, Territorialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Erforschung der frühen Staufer so schwierig?
Die Quellenlage für die Anfänge der Staufer ist sehr spärlich, was es Historikern erschwert, eine lückenlose und objektive historische Einordnung vorzunehmen.
Welche Rolle spielte Otto von Freising bei der Darstellung der Staufer?
Otto von Freising verfasste die "Gesta Friderici", eine Chronik über seinen Neffen Friedrich Barbarossa, die eine zentrale, wenn auch subjektive Primärquelle darstellt.
Was ist die Verwandtschaftstafel des Wibald von Stablo?
Wibald von Stablo erstellte im Auftrag Friedrich Barbarossas eine Tafel, die die Herkunft der Staufer bis zum Kaiser zurückverfolgt, um deren Herrschaftsanspruch zu legitimieren.
Wie lässt sich der Aufstieg der Staufer erklären?
Die Forschung sieht den Aufstieg primär in ihrer geschickten Heiratspolitik (Konnubium) und ihrer engen Verwandtschaft zum Geschlecht der Salier begründet.
Welche Bedeutung hat die Burg Staufen für das Geschlecht?
Die neuere Forschung geht davon aus, dass die Symbolik der Burg Staufen oft überschätzt wird, da sie keine zentrale Funktion als namengebender Herrschaftssitz innehatte.
Warum ist die Quellenbasis der frühen Staufergeschichte problematisch?
Es gibt nur wenige zeitgenössische Dokumente, und die vorhandenen (wie die von Otto von Freising) sind oft von dynastischen Interessen geprägt und daher kritisch zu hinterfragen.
- Citation du texte
- Udo Wichmann (Auteur), 2006, Warum ist die Darstellung der frühen Staufer problembehaftet und welche Rolle spielen Otto von Freising und Wibald von Stablo bei der Darstellung der frühen Staufer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80076