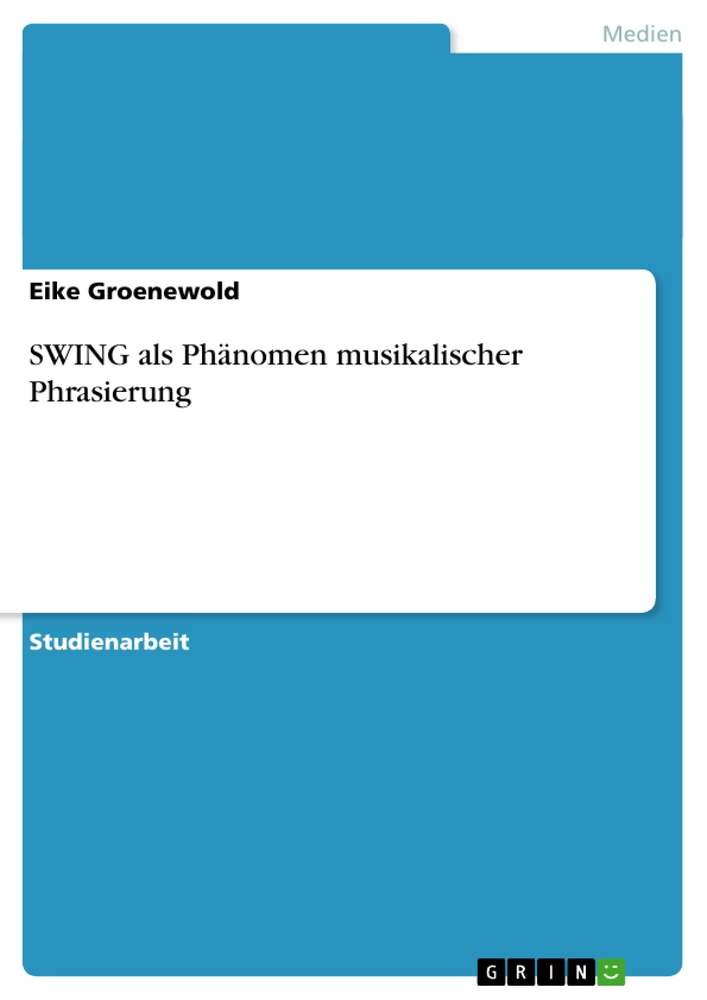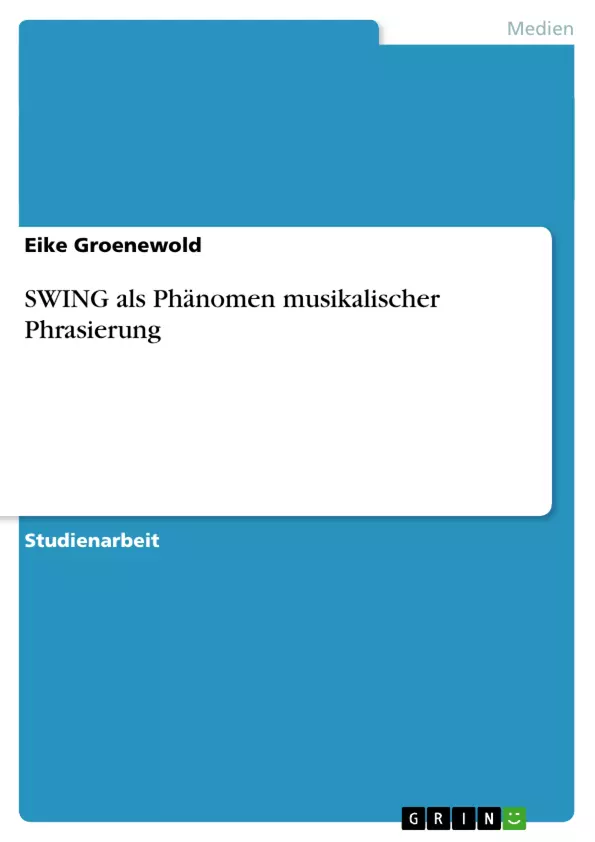Die am häufigsten mit der Musikrichtung Jazz in Verbindung gebrachte Art zu musizieren ist die charakteristische Phrasierung des swing . Scheinbar bietet kaum eine andere Musikform dem Musiker eine so fluid- rhythmische Grundlage. Zwischen den rhythmischen Polen binär und ternär liegt hier gleichsam die Welt der Phrasierung. Musiker nutzen diese Sphäre als mikrorhythmischen Gestaltungsspielraum (Pfleiderer 2002; S.102). Der treibende und bewegende Charakter des swing wird von Musikern auch häufig mit Ausdrücken wie „groove“ oder „drive“ bezeichnet (Prögler 1995, S.30). Seit den 80er Jahren widmet sich die Forschung der Frage, wodurch swing entsteht, konnte jedoch bis heute keine ausreichenden Antworten liefern.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die elementaren Ergebnisse bisheriger Studien, die sich mit swing auseinandergesetzt haben, zusammenzustellen, um im Nachhinein das Forschungsdesign kritisch hinterfragen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. MUSIKALISCHE PHRASIERUNG IM JAZZ
- 2.1 PHRASIERUNG
- 2.2 MIKRORHYTHMISCHE ABWEICHUNGEN IM MUSIKALISCHEN GESTALTUNGSPROZESS
- 2.3 AUSWIRKUNGEN VON SYNTAX UND PROZESS AUF DAS MUSIKALISCHE ZUSAMMENSPIEL
- 3. PROBLEMATIK INNERHALB DER FORSCHUNG
- 3.1 ANALYSE MEHRSPURIGER DIGITALAUFNAHMEN
- 3.2 MIDI- PROGRAMMIERUNG ALS FORSCHUNGSANSATZ
- 3.3 KONZEPTUALISIERUNG DES SWING
- 4. FAZIT
- 5. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die wesentlichen Ergebnisse bisheriger Studien zum Thema swing zusammenzufassen und das Forschungsdesign kritisch zu hinterfragen. Sie strebt außerdem danach, den Leser für die Problematik der Messbarkeit des Phänomens swing zu sensibilisieren. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Phrasierung innerhalb der Rhythmusgruppe, insbesondere des Jazzschlagzeugspiels.
- Zusammenstellung und kritische Analyse bestehender Forschungsarbeiten zu swing.
- Sensibilisierung des Lesers für die Messbarkeit des Phänomens swing.
- Untersuchung der Phrasierung innerhalb der Rhythmusgruppe im Jazz.
- Besondere Betrachtung des Jazzschlagzeugspiels.
- Zusammenführung der gewonnenen Ergebnisse für eine Schlussbetrachtung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Thema swing ein und erläutert seine Bedeutung für die Musikrichtung Jazz. Es stellt dar, dass swing als jazztypische Phrasierungsweise ein komplexes Phänomen ist, dessen Entstehung trotz intensiver Forschung noch nicht vollständig geklärt ist.
- Kapitel 2 beleuchtet den Begriff Phrasierung im Jazz und differenziert zwischen der Interpretation von Achtelnoten mit unterschiedlichen swing-Faktoren und dem Bezug einer musikalischen Darbietung zu einem festen Metrum. Es zeigt, dass sich swing in einem Bereich zwischen binärer und ternärer Aufteilung der Achtelnoten befindet und eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung der Phrasierung bietet.
- Kapitel 3 diskutiert die Problematik der Forschung zum Thema swing. Es behandelt die Analyse von Mehrspur-Digitalaufnahmen, die MIDI-Programmierung als Forschungsansatz und die Konzeptualisierung von swing. Es zeigt, dass die Forschung im Bereich des Mikrotimings angesiedelt ist und die wichtigsten Ergebnisse bisheriger Experimente zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Swing, Jazzphrasierung, Mikrotiming, Rhythmusgruppe, Jazzschlagzeugspiel, swing-Faktor, Forschungsdesign, Messbarkeit, mikrorhythmische Abweichungen.
- Quote paper
- Eike Groenewold (Author), 2007, SWING als Phänomen musikalischer Phrasierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80145