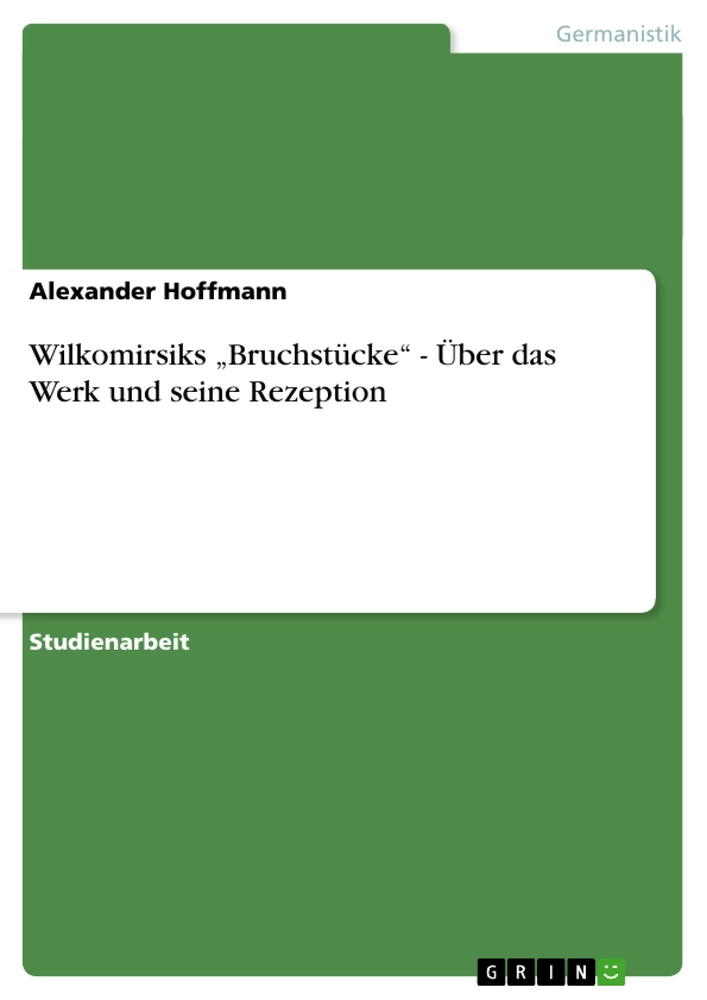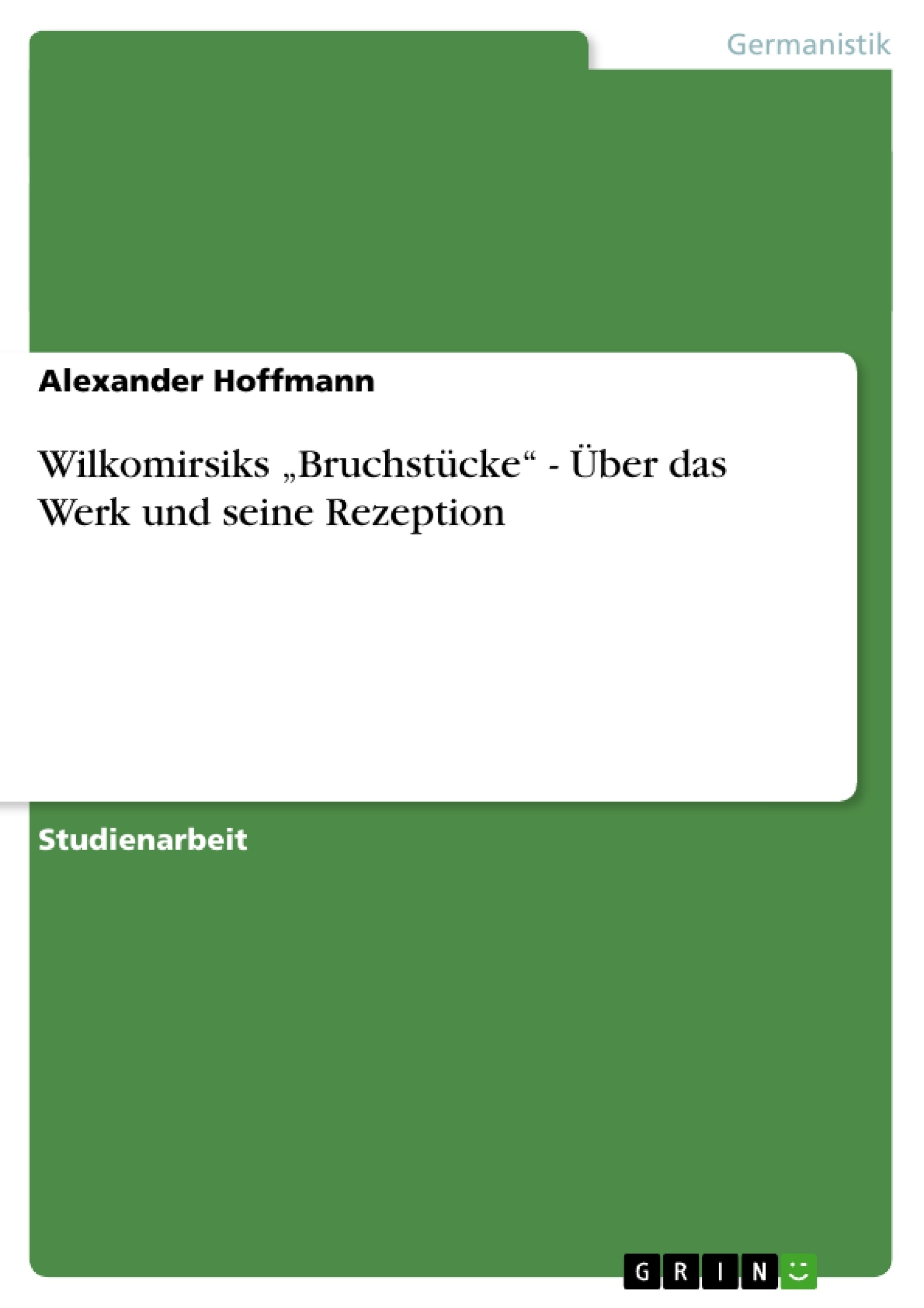„Bruchstücke" von Binjamin Wilkomirski war bei seinem Erscheinen ein Aufsehen erregendes Buch. Nicht etwa weil man ihm von Beginn an die nachträglich festgestellte Täuschung angesehen hatte, sondern wegen der literarischen Qualität für die das Werk großes Ansehen genoss. Die Rezeption änderte sich jedoch mit dem Auftreten von Fälschungsvorwürfen – allen voran durch Ganzfried1 – die zu einer Skepsis gegenüber dem Autor Binjamin Wilkomirski führte. Die Vorwürfe wurden wissenschaftlich von dem Wiener Historiker Stefan Mächler untermauert, der den „Fall Wilkomirski“ eindrucksvoll aufklärte.2 In dieser Arbeit soll allerdings nicht der Fall um den Betrug oder die Selbsttäuschung durch Binjamin Wilkomirski nachgegangen werden, da Mächler hierzu ein umfangreiches und nicht durch eine Hauptseminararbeit zu bereicherndes Werk abgeliefert hat. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den weitaus vernachlässigteren Aspekt der Werkinterpretation anzugehen, da nach der Aufdeckung der 'Rezipiententäuschung' das Werk von vielen namhaften Personen diffamiert wurde, ohne auf inhaltliche Aspekte einzugehen.
Hier stellt sich nun die zentrale Frage, mit der sich diese Arbeit beschäftige will: Was machte „Bruchstücke" zu einem literarisch anerkannten Werk und kann diesem auch noch nach dem Skandal in einer vom Autoren getrennten Interpretation ein Wert innerhalb der (Shoa-)Literatur zugesprochen werden?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gattungsspezifische Einordnung des Werkes
- 1. Was ist ein autobiographischer Text?
- 2. Die „imaginierte Shoa-Kinderautobiographie“
- III. Narrative Besonderheiten bei Wilkomirski
- 1. Erinnerung über Assoziation
- 2. Das Erinnern in „Bruchstücke“ und die Gedächtnistheorie
- IV. Wodurch unterscheidet sich "Bruchstücke" von anderen Kinderautobiographien der Shoa-Literatur?
- 1. Die Kinderperspektive bei Wilkomirski und ihre Funktionalisierung
- 2. Vergleich der Kinderperspektive bei verschiedenen Autoren
- V. Die Diskussion um Wilkomirski – Theorie oder Moral?
- VI. Abschließende Auswertung
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der literarischen Analyse von Binjamin Wilkomirskis „Bruchstücke“, einer vermeintlichen Kinderautobiographie über die Shoa. Ziel ist es, die literarische Qualität des Werkes zu beleuchten und dessen Wert innerhalb der (Shoa-)Literatur zu bewerten, unabhängig von der später aufgedeckten Fälschung.
- Gattungsspezifische Einordnung des Werkes
- Narrative Besonderheiten von Wilkomirskis Text
- Unterschiede zu anderen Kinderautobiographien der Shoa-Literatur
- Rezeption und Diskussion um „Bruchstücke“
- Anwendbarkeit der „Autor-Theorie“ von Foucault
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Werkes und die Problematik der Rezeption im Kontext der aufgedeckten Fälschung ein. Im zweiten Kapitel erfolgt eine gattungsspezifische Einordnung von „Bruchstücke“, wobei die Definitionen von Pascal und Starobinski zur Autobiographie herangezogen werden. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der „fiktionalen Autobiographie“ und der Frage, warum das Werk vor der Enthüllung als authentisch wahrgenommen wurde.
Kapitel drei befasst sich mit den narrativen Besonderheiten von Wilkomirskis Text. Die Analyse der Erinnerung über Assoziationen und der Bedeutung von Gedächtnistheorie im Kontext der Shoa-Literatur werden dabei beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht, inwiefern sich „Bruchstücke“ von anderen Kinderautobiographien der Shoa-Literatur unterscheidet. Hierzu werden die Kinderperspektive bei Wilkomirski und ihre Funktionalisierung im Vergleich zu anderen Autoren, wie Kertész und Klüger, betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Shoa-Literatur, Kinderautobiographie, „Bruchstücke“, Binjamin Wilkomirski, Fälschung, literarische Qualität, narrative Besonderheiten, Rezeption, Gedächtnistheorie, „Autor-Theorie“, Autobiographie, fiktionale Autobiographie, Kinderperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Buch „Bruchstücke“ von Binjamin Wilkomirski?
Das Werk wurde ursprünglich als authentische Kinderautobiographie über die Shoa veröffentlicht, stellte sich jedoch später als Fälschung heraus.
Was ist das Ziel dieser literaturwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die literarische Qualität des Werkes unabhängig vom Skandal und fragt, was es vor der Aufdeckung so erfolgreich und anerkannt machte.
Wie wird das Werk gattungsspezifisch eingeordnet?
Es wird als „imaginierte Shoa-Kinderautobiographie“ bzw. als fiktionale Autobiographie analysiert, die den Leser durch Authentizitätssignale täuschte.
Welche narrativen Besonderheiten weist der Text auf?
Besonders auffällig ist die Erinnerung über Assoziationen und die konsequente Nutzung einer funktionalisierten Kinderperspektive.
Wer deckte die Fälschung wissenschaftlich auf?
Der Wiener Historiker Stefan Mächler klärte den „Fall Wilkomirski“ umfassend auf, nachdem bereits zuvor Vorwürfe (u.a. von Ganzfried) laut geworden waren.
- Citar trabajo
- Alexander Hoffmann (Autor), 2006, Wilkomirsiks „Bruchstücke“ - Über das Werk und seine Rezeption, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80218