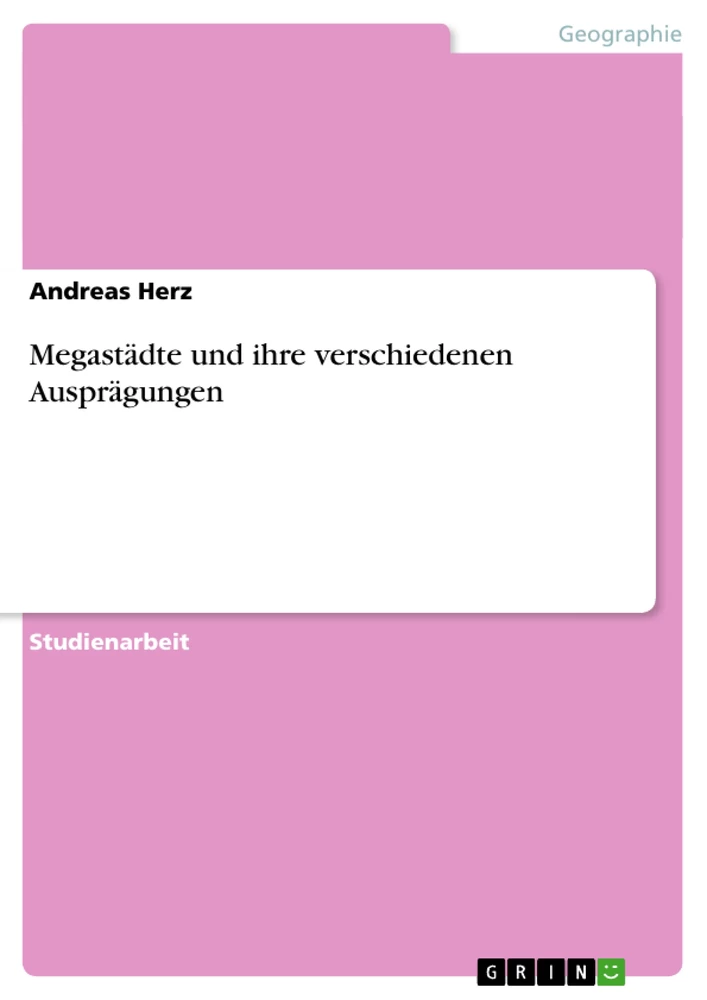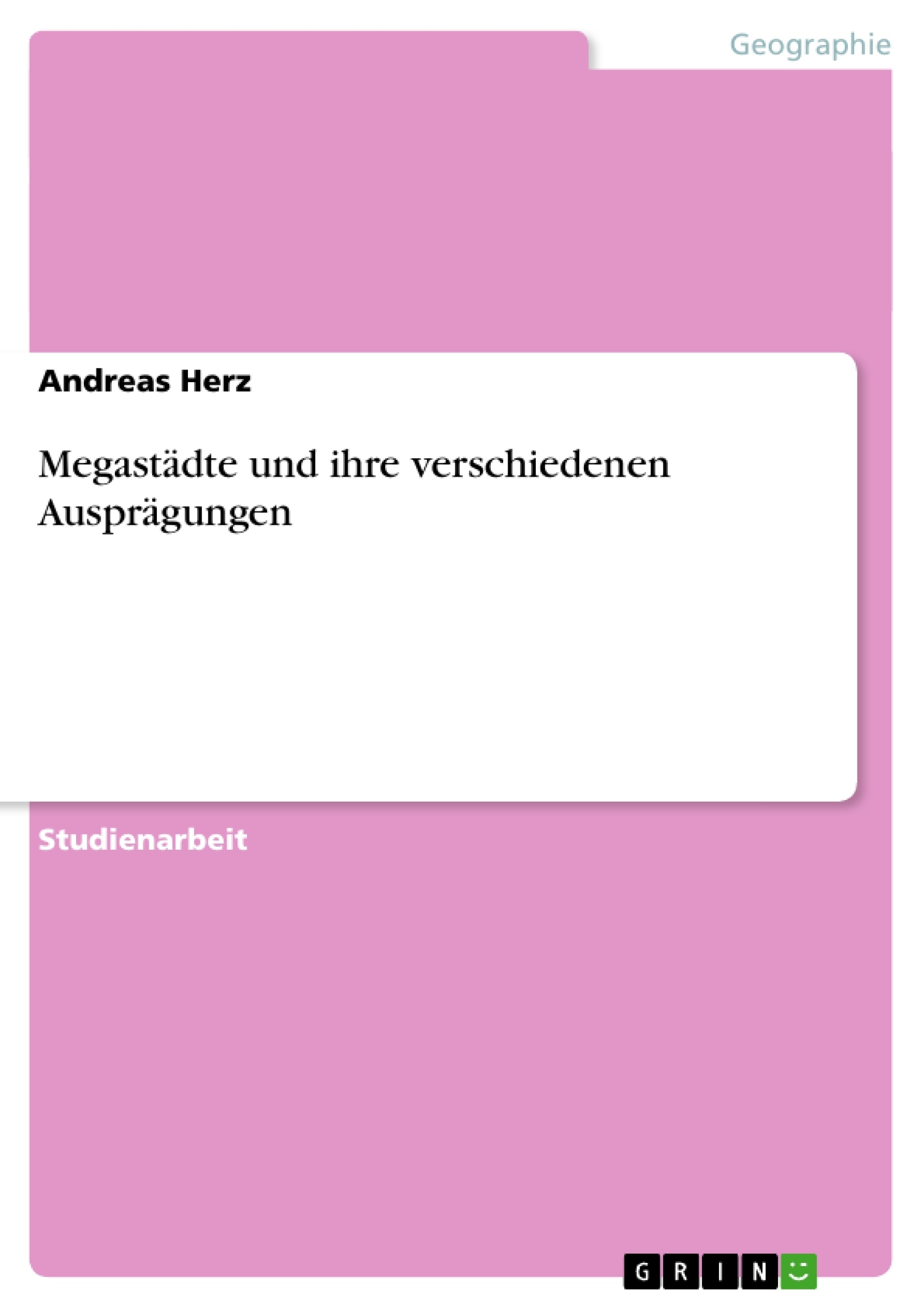Gegenstand von Interesse sollen in dieser Arbeit Megastädte sind. 1950 gab es erst zwei – London und New York. 2015 werden es bereits 22 sein, 17 davon außerhalb der hoch entwickelten Industriestaaten . Wir haben es also mit einem globalen, sich verstärkenden Phänomen zu tun. Oder wie Fuchs sagt: „Mankind’s future will unfold largely in urban settings.“ (FUCHS 1994, S.1). Doch schon hier beginnt das Problem: „Urban settings“. Was ist das? Ist „Urban“ gleichzusetzen mit megastädtischer Entwicklung, oder findet man in den Hamptons oder in Starnberg nicht ebenso urbanes Leben wie in London oder Chicago? Was also ist eine Megastadt? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Eine thematische Einführung
- Megastädte – der Versuch einer Definition
- Die Megastädte der Industrie- und Entwicklungsländer im Vergleich
- Megastädte zwischen Globalisierung und Disparitäten
- Wohnraum und Segregation
- Beschäftigung und Armut
- Megastädte im Vergleich - New York und Kairo
- Die Primacy-Funktion
- Bevölkerung und Wohnraum in New York und Kairo
- Ungleichheit und Armut
- Megastädte – Eine Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Megastädte und ihre unterschiedlichen Ausprägungen in Industrie- und Entwicklungsländern. Ziel ist es, den geographisch-soziologischen Aspekt von Megastädten zu beleuchten, ihre Definition zu diskutieren und verschiedene Aspekte wie Wohnraum und Armut zu analysieren. Abschließend werden New York und Kairo als Fallbeispiele im Vergleich betrachtet.
- Definition und Charakteristika von Megastädten
- Vergleich von Megastädten in Industrie- und Entwicklungsländern
- Die Rolle von Globalisierung und Disparitäten in Megastädten
- Analyse von Wohnraum, Beschäftigung und Armut in Megastädten
- Fallstudienvergleich: New York und Kairo
Zusammenfassung der Kapitel
Eine thematische Einführung: Diese Einführung beschreibt den Fokus der Arbeit auf Megastädte und ihre vielfältigen Ausprägungen im Kontext wachsender Verstädterung. Sie hebt die interdisziplinäre Relevanz des Themas hervor und betont den geographisch-soziologischen Ansatz der Arbeit. Die Einleitung unterstreicht den Anspruch, Megastädte zu definieren, ihre Unterschiede in Industrie- und Entwicklungsländern zu beleuchten und schließlich zwei Megastädten – New York und Kairo – gegenüberzustellen. Die Arbeit verspricht eine Einführung in das Thema, ohne Anspruch auf Ex-haustive Behandlung der einzelnen Aspekte.
Megastädte – der Versuch einer Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Megastadt“. Es wird die Schwierigkeit hervorgehoben, eine weltweit gültige Definition zu finden, da verschiedene Begriffe wie Metropole, Großagglomeration oder Global City verwendet werden. Die Arbeit zeigt, dass reine Einwohnerzahlen (5-10 Millionen) als Definitionskriterium zwar verbreitet, aber problematisch sind, da sie die funktionale und strukturelle Komplexität von Megastädten nicht erfassen. Die Diskussion um die Einwohnerdichte und die Einbeziehung von ländlichen Gebieten in die Definition wird kritisch beleuchtet. Schließlich wird die „monozentrische Struktur“ mit ihren Primacy-Funktionen (demografisch und funktional) als wichtiges zusätzliches Kriterium vorgestellt, welches in seinem Ausmaß je nach Entwicklungsstand der Megastadt variiert.
Schlüsselwörter
Megastädte, Globalisierung, Disparitäten, Industrie- und Entwicklungsländer, Wohnraum, Armut, Segregation, Primacy-Funktion, New York, Kairo, Urbanisierung, Verstädterung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Megastädte im Vergleich: New York und Kairo"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Megastädte und ihre unterschiedlichen Ausprägungen in Industrie- und Entwicklungsländern. Der Fokus liegt auf dem geographisch-soziologischen Aspekt, der Definition von Megastädten und der Analyse verschiedener Aspekte wie Wohnraum und Armut. New York und Kairo dienen als Fallbeispiele im Vergleich.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von Megastädten, vergleicht Megastädte in Industrie- und Entwicklungsländern, untersucht die Rolle der Globalisierung und Disparitäten, analysiert Wohnraum, Beschäftigung und Armut und vergleicht abschließend New York und Kairo als Fallstudien. Die Primacy-Funktion von Megastädten wird ebenfalls betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine thematische Einführung, eine Auseinandersetzung mit der Definition von Megastädten, ein Vergleich von Megastädten in Industrie- und Entwicklungsländern, eine Betrachtung der Globalisierung und Disparitäten in Megastädten (inkl. Wohnraum, Beschäftigung und Armut), einen detaillierten Vergleich von New York und Kairo und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Megastadtforschung.
Welche Schwierigkeiten bei der Definition von Megastädten werden angesprochen?
Die Arbeit hebt die Schwierigkeit hervor, eine weltweit gültige Definition für Megastädte zu finden. Sie kritisiert die alleinige Verwendung von Einwohnerzahlen als Kriterium (5-10 Millionen), da dies die funktionale und strukturelle Komplexität nicht erfasst. Die Einwohnerdichte und die Einbeziehung ländlicher Gebiete in die Definition werden ebenfalls kritisch beleuchtet. Die „monozentrische Struktur“ mit ihren Primacy-Funktionen wird als wichtiges zusätzliches Kriterium vorgestellt.
Welche Städte werden im Detail verglichen?
Die Arbeit vergleicht im Detail New York und Kairo als Fallbeispiele. Der Vergleich konzentriert sich auf Aspekte wie die Primacy-Funktion, Bevölkerung und Wohnraum, sowie Ungleichheit und Armut.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Megastädte, Globalisierung, Disparitäten, Industrie- und Entwicklungsländer, Wohnraum, Armut, Segregation, Primacy-Funktion, New York, Kairo, Urbanisierung, Verstädterung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den geographisch-soziologischen Aspekt von Megastädten zu beleuchten, ihre Definition zu diskutieren und verschiedene Aspekte wie Wohnraum und Armut zu analysieren. Der Vergleich von New York und Kairo dient als exemplarische Fallstudie.
- Citation du texte
- Andreas Herz (Auteur), 2007, Megastädte und ihre verschiedenen Ausprägungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80219