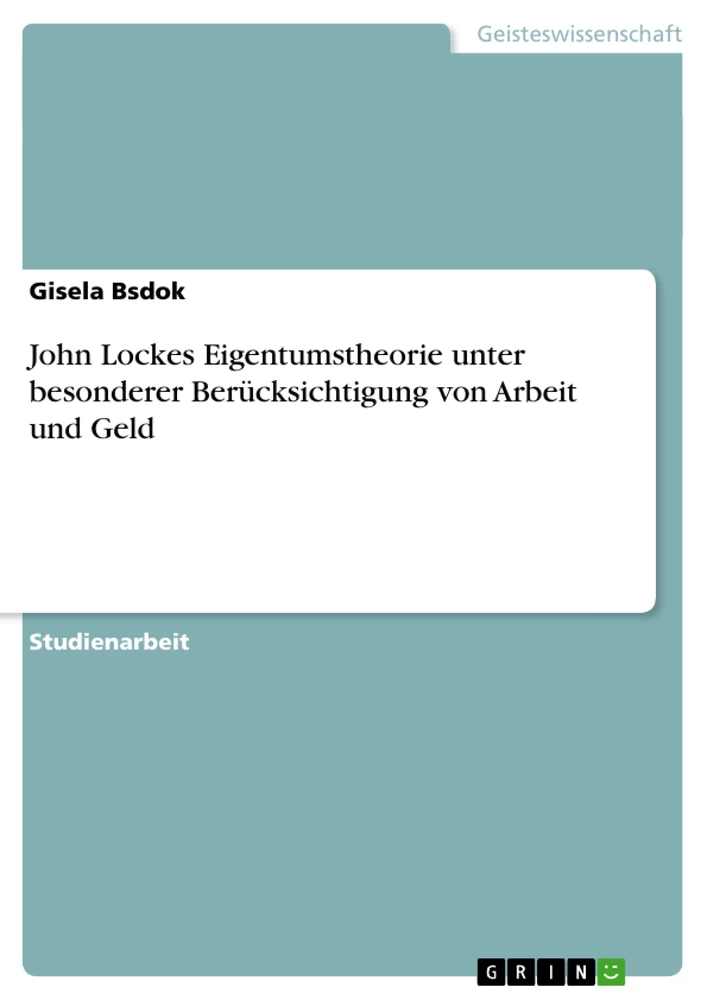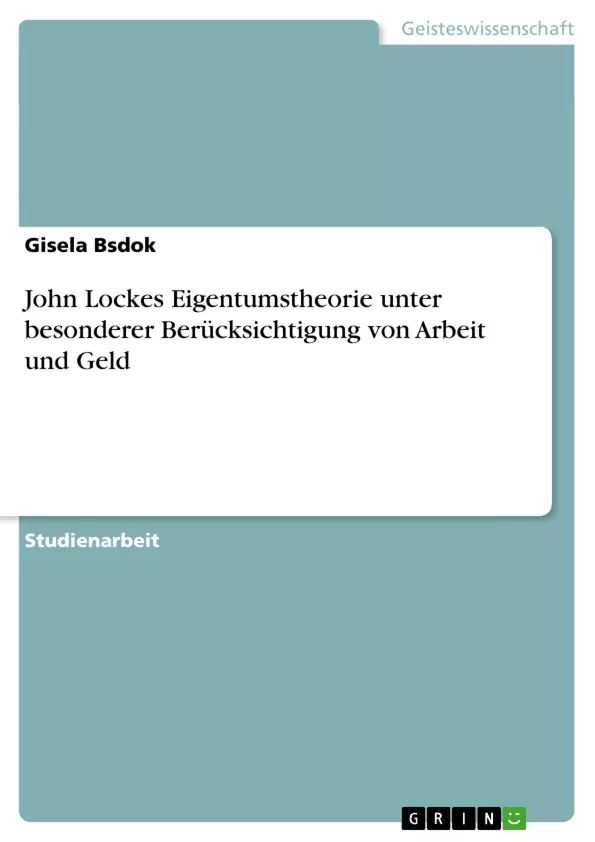Die vorliegende Arbeit widmet sich der Eigentumstheorie von John Locke, wie sie in seinem 1690 erschienenen Werk „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ im Kapitel 5 der Zweiten Abhandlung dargestellt wird. Nicht nur zu seiner Zeit (*1632, +1704) galt der englische Philosoph auch weit über die Landesgrenzen hinaus als ein hervorragender Denker. Sein Einfluss auf das 18. Jahrhundert wird bis zum heutigen Tage als unumstritten angesehen. Seine politisch-ökonomischen Ideen, die u.a. durch das o.g. Werk bekannt wurden, haben zunächst in den intellektuellen Kreisen Europas und Amerikas eine überwiegend positive Aufnahme gefunden. Doch bereits im Laufe des 18. Jahrhunderts büßte Locke seine Stellung als politisch aktueller Denker immer mehr ein.
Nichtsdestotrotz ist die Ökonomie von John Locke seit jeher ein viel diskutiertes, und zugleich kontroverses Thema, wie dies die seitdem zahlreich erschienenen Sekundärschriften belegen. Da es jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, Lockes Theorie unter all den Aspekten zu beleuchten, die sein politisch-theoretisches Werk aufwirft, wird sich der Schwerpunkt auf die Begründung des Eigentums richten. Dabei werden die sie stützenden Argumentationssäulen – Arbeit sowie Gebrauch des Geldes im besonderen Maße berücksichtigt.
Die Arbeit zielt auf die Beantwortung der Frage ab, ob es Locke gelingt, den Übergang von Gemeinbesitztum zu Privateigentum zu rechtfertigen. Hierzu wird zunächst Lockes Weltbild dargelegt, das auf der Annahme eines Schöpfergottes basiert, der dem Menschen die Erde samt ihrer Früchte geschenkt und ihm somit gleichzeitig eine Aufgabe auf den Weg gegeben habe. Von dieser Ausgangssituation eines Naturzustandes ausgehend wird im zweiten Schritt erläutert, wie Locke es zu rechtfertigen vermag, dass durch den Einsatz der eigenen Arbeit aus dem einstigen Gemeingut das Eigentum eines Individuums entstehen kann und darf. Im nächsten Schritt werden die Einschränkungen untersucht, die eine hemmungslose Aneignung verhindern. Es handelt sich einmal um die Verderblichkeitsklausel und zum anderen um die Quantität des appropriierten Gegenstandes, die sich danach bestimmt, dass von dem jeweiligen Gut noch genügend für die Mitmenschen übrigbleibt. An dieser Stelle kommt die Einführung des Geldes ins Spiel, wodurch die von Locke auferlegten Eigentumsschranken wieder aufgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation: Naturzustand / Eigentumsverhältnisse
- Übergang von Gemeingut zu Privateigentum
- Einschränkungen (Verderblichkeit/Rücksicht auf die Mitmenschen)
- Aufhebung der Schranken durch die Einführung des Geldes
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Eigentumstheorie von John Locke, die in seinem Werk "Zwei Abhandlungen über die Regierung" beschrieben wird. Der Fokus liegt auf der Rechtfertigung des Übergangs von Gemeingut zu Privateigentum unter besonderer Berücksichtigung von Lockes Argumentationssäulen: Arbeit und Gebrauch des Geldes.
- Lockes Weltbild und die Rolle des Naturzustandes
- Die Bedeutung von Arbeit als Grundlage des Privateigentums
- Einschränkungen des Eigentumsrechts durch die Verderblichkeitsklausel und die Rücksicht auf die Mitmenschen
- Die Rolle des Geldes bei der Aufhebung von Eigentumsbeschränkungen
- Die Frage, ob Locke den Übergang von Gemeinbesitz zu Privateigentum rechtfertigen kann
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Lockes Werk "Zwei Abhandlungen über die Regierung" vor und erläutert, warum seine Eigentumstheorie bis heute relevant ist. Sie skizziert den Schwerpunkt der Arbeit, nämlich die Rechtfertigung des Übergangs von Gemeinbesitz zu Privateigentum durch Arbeit und den Einsatz von Geld.
Ausgangssituation: Naturzustand / Eigentumsverhältnisse
Dieses Kapitel beschreibt Lockes Weltbild, das auf der Annahme eines Schöpfergottes basiert, der die Erde und ihre Früchte dem Menschen schenkt. Es wird der Naturzustand als Ausgangspunkt für die Eigentumsbegründung dargestellt, in dem die Menschen nach dem Naturgesetz leben und ein Recht auf Freiheit und Gleichheit besitzen.
Übergang von Gemeingut zu Privateigentum
In diesem Kapitel wird erläutert, wie Locke den Übergang von Gemeingut zu Privateigentum rechtfertigt. Er argumentiert, dass die eigene Arbeit den Menschen ein Recht auf Eigentum verschafft. Durch den Einsatz von Arbeit wird das ursprünglich gemeinschaftliche Eigentum zu individuellem Eigentum.
Einschränkungen (Verderblichkeit/Rücksicht auf die Mitmenschen)
Dieses Kapitel befasst sich mit den Einschränkungen des Eigentumsrechts. Locke argumentiert, dass die Aneignung von Eigentum begrenzt sein muss, um die Bedürfnisse der Mitmenschen zu gewährleisten. Er führt die Verderblichkeitsklausel und die Beschränkung der Quantität des angeeigneten Gutes ein.
Schlüsselwörter
John Locke, Eigentumstheorie, Naturzustand, Arbeit, Geld, Gemeinbesitz, Privateigentum, Rechtfertigung, Naturrecht, Gleichheit, Freiheit, Verderblichkeitsklausel, Eigentumsbeschränkungen
Häufig gestellte Fragen
Wie rechtfertigt John Locke den Übergang von Gemeingut zu Privateigentum?
Locke argumentiert, dass der Mensch durch den Einsatz seiner eigenen Arbeit ein Recht darauf erwirbt, Dinge aus dem ursprünglichen Naturzustand in sein Privateigentum zu überführen.
Was besagt die „Verderblichkeitsklausel“ in Lockes Theorie?
Sie besagt, dass man sich nur so viel aneignen darf, wie man verbrauchen kann, bevor es verdirbt. Eine „hemmungslose Aneignung“ zum Zweck der Verschwendung ist nicht gestattet.
Welche Rolle spielt das Geld bei der Aufhebung von Eigentumsschranken?
Da Geld nicht verdirbt, ermöglicht seine Einführung die Akkumulation von Besitz über den unmittelbaren Bedarf hinaus, wodurch die ursprünglichen Schranken (Verderblichkeit) faktisch aufgehoben werden.
Was ist der „Naturzustand“ bei John Locke?
Der Naturzustand ist die Ausgangssituation, in der die Erde allen Menschen gemeinsam gehört und sie nach Naturgesetzen in Freiheit und Gleichheit leben.
Muss man laut Locke Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen?
Ja, ein Kriterium für die rechtmäßige Aneignung ist, dass „genügend und ebenso gutes“ Gut für die anderen Mitmenschen übrigbleiben muss.
In welchem Werk legte Locke seine Eigentumstheorie dar?
Seine Theorie findet sich im 5. Kapitel der „Zweiten Abhandlung über die Regierung“, die im Jahr 1690 veröffentlicht wurde.
- Citation du texte
- Gisela Bsdok (Auteur), 2006, John Lockes Eigentumstheorie unter besonderer Berücksichtigung von Arbeit und Geld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80223