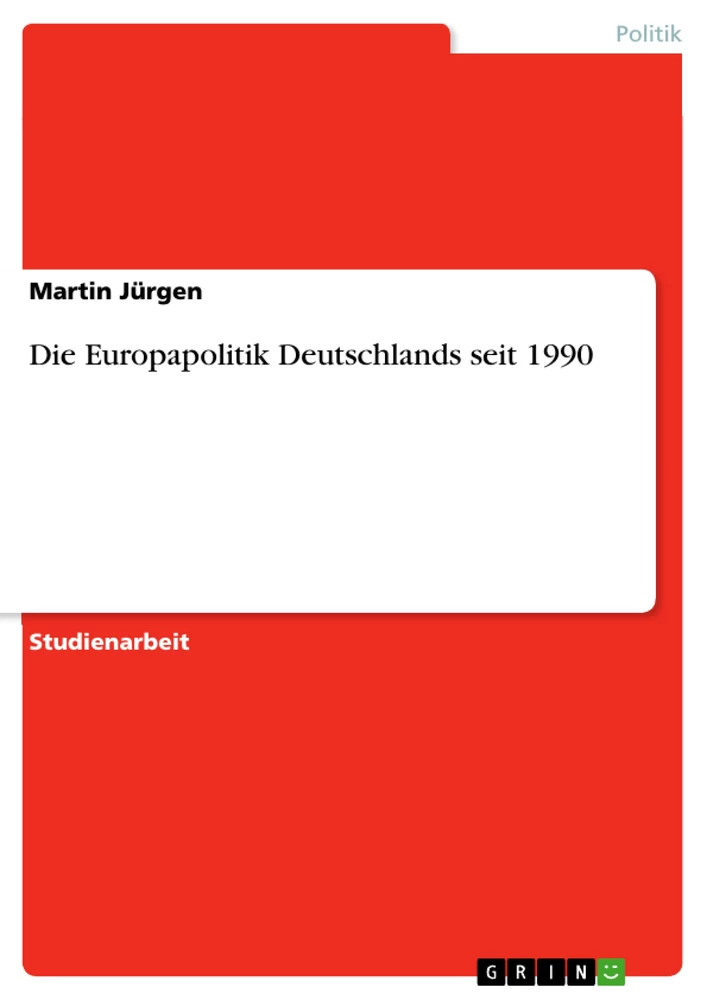Mit den Römischen Verträgen von 1957 zur Gründung der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und der EURATOM, der Europäischen Atomgemeinschaft, begann in Europa ein langer politischer und auch gesellschaftlicher Prozess. Das Ende dieses gesamteuropäischen Prozesses ist noch nicht absehbar, nicht einmal das Ziel ist genau definiert.
Deutschland nimmt in der Europäischen Union eine Führungsrolle ein und bestimmt die europäische Politik maßgeblich mit. Zurzeit hat die Bundesrepublik Deutschland die Ratspräsidentschaft inne und versucht auf diesem Wege verschiedene politische Ziele, wie das Vorantreiben der Integration und der Konstitutionalisierung, sowie die Festlegung auf das endgültige „Format“ der EU, durch zu setzen.
Diese Arbeit wird sich in 2 Teilen mit der deutschen Europapolitik befassen. Der erste Teil zeigt den Weg der europapolitischen Willensbildung und die beteiligten Institutionen und Strukturen, besondere Beachtung findet hier auch der Anfang der 1990er Jahre eingeführte Artikel 23 des Grundgesetzes. Der zweite Teil befasst sich mit der Frage nach Kontinuität und Wandel der deutschen Europapolitik in jüngster Zeit und zeigt anhand der Integration einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als Säule des Maastrichter Vertrages den Einfluss und die Tragweite deutscher Europapolitik
Im Schluss erfolgt ein Ausblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten und Probleme der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Die Anzahl der Publikationen zum Thema deutsche Europapolitik scheint schier grenzenlos. Besonders wichtig erscheinen mir der Band 77 der Europäischen Schriften des Instituts für Europäische Politik: „Eine neue deutsche Europapolitik? Rahmenbedingungen – Problemfelder – Optionen“, herausgegeben von Heinrich Schneider, Matthias Joop und Uwe Schmalz, und Axel Lüdekes „Europäisierung“ der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Nicht zu vergessen ist das vierteljährlich erscheinende Heft „integration“ des Instituts für Europäische Politik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Akteure und Institutionen europapolitischer Willensbildung
- Prinzipien und Akteure
- Der Bundestag
- Der Bundesrat
- Die Bundesregierung
- Artikel 23 Grundgesetz
- Ausgewählte Felder deutscher Europapolitik
- Allgemeine Aspekte und aktuelle Entwicklungen – Wandel und Kontinuität deutscher Europapolitik
- Deutsche Initiativen zur Errichtung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Akteure und Institutionen europapolitischer Willensbildung
- Möglichkeiten und Optionen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die deutsche Europapolitik seit 1990 und beleuchtet die Prozesse der europapolitischen Willensbildung in Deutschland. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Rolle des Bundestages und der Bundesregierung sowie die Integration einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gelegt. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten und Optionen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft untersucht.
- Prozesse der europapolitischen Willensbildung in Deutschland
- Rolle des Bundestages und der Bundesregierung in der EU-Politik
- Integration einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
- Möglichkeiten und Optionen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
- Kontinuität und Wandel der deutschen Europapolitik in jüngster Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die deutsche Europapolitik in den Kontext der europäischen Integration und erläutert die Relevanz des Themas. Sie beleuchtet die Führungsrolle Deutschlands in der EU und skizziert die Ziele der Arbeit.
Der Hauptteil beginnt mit einer Analyse der Akteure und Institutionen europapolitischer Willensbildung in Deutschland. Er beschreibt das Kanzler-, Ressort- und Kabinettsprinzip sowie die Rolle des Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung und des Artikels 23 des Grundgesetzes.
Anschließend werden ausgewählte Felder deutscher Europapolitik untersucht, wobei der Fokus auf Kontinuität und Wandel der deutschen Europapolitik in jüngster Zeit liegt. Die Integration einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als Säule des Maastrichter Vertrages wird als Beispiel für den Einfluss und die Tragweite deutscher Europapolitik vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schwerpunkten deutsche Europapolitik, europapolitische Willensbildung, EU-Institutionen, Bundestag, Bundesregierung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), EU-Ratspräsidentschaft, Integration, Kontinuität und Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Artikel 23 des Grundgesetzes für die Europapolitik?
Der sogenannte „Europa-Artikel“ regelt die Mitwirkung des Bundestages und der Bundesländer (über den Bundesrat) in Angelegenheiten der Europäischen Union.
Wie wird die deutsche europapolitische Willensbildung gesteuert?
Sie erfolgt durch ein Zusammenspiel von Kanzler-, Ressort- und Kabinettsprinzip, wobei das Bundeskanzleramt oft eine koordinierende Führungsrolle einnimmt.
Was ist die GASP?
GASP steht für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, deren Aufbau maßgeblich durch deutsche Initiativen im Rahmen des Maastrichter Vertrages vorangetrieben wurde.
Hat sich die deutsche Europapolitik seit 1990 grundlegend gewandelt?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Kontinuität (Integration als Staatsziel) und Wandel (stärkeres nationales Interesse in Detailfragen) in der jüngeren Zeit.
Was sind die Aufgaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft?
Deutschland nutzt die Ratspräsidentschaft, um Themen wie die Konstitutionalisierung der EU, die Integration neuer Mitglieder und die Festlegung strategischer Formate voranzutreiben.
- Citar trabajo
- Martin Jürgen (Autor), 2007, Die Europapolitik Deutschlands seit 1990, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80277