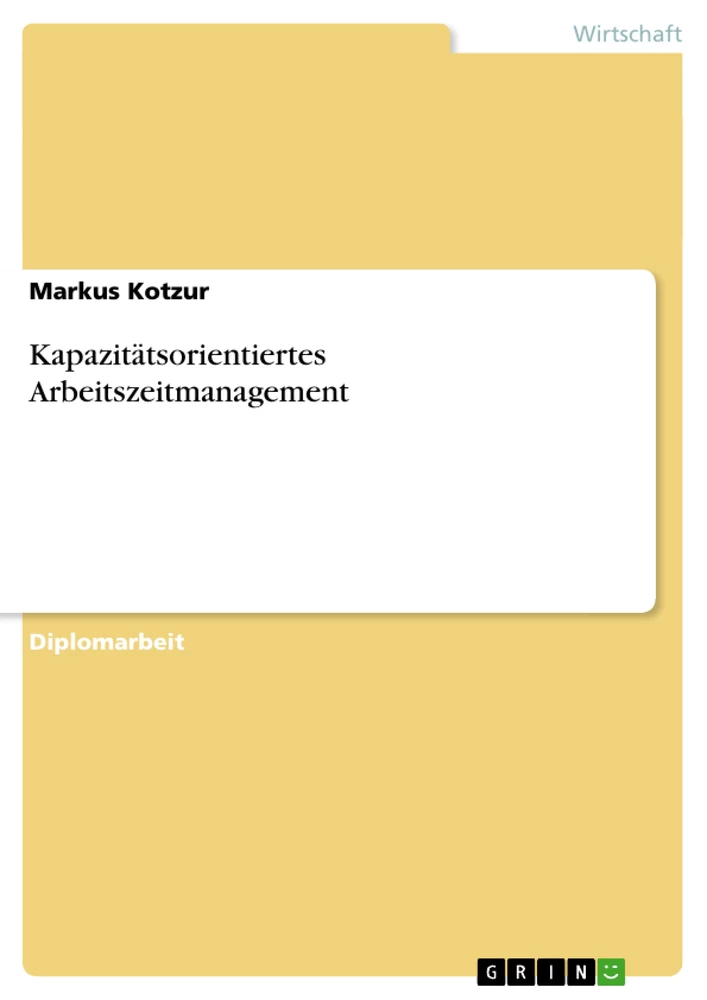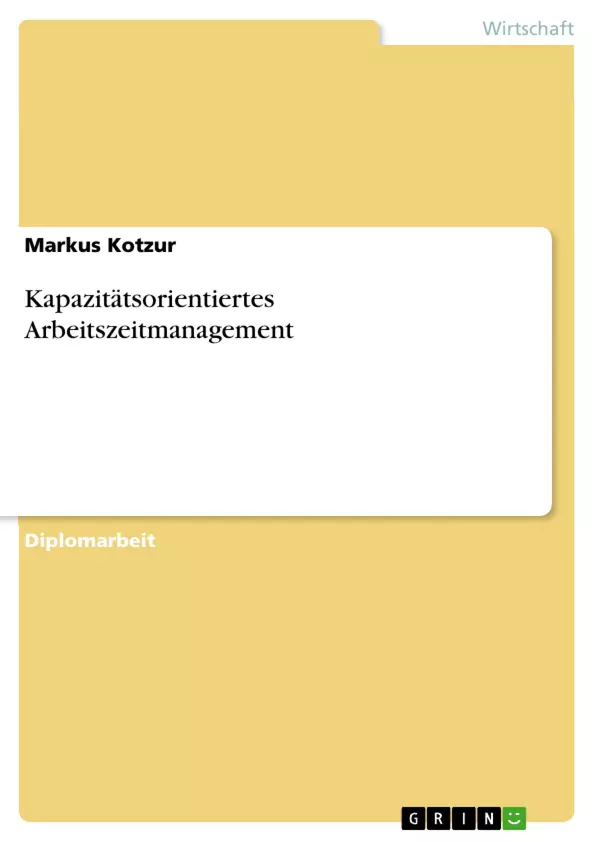Tenor dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Untersuchung verschiedenster Arbeitszeitmodelle auf deren Eignung als Instrumente des kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagements. Neben dem historischen Hintergrund sowie den Grundlagen des Arbeitszeitmanagements werden auch die Zusammenhänge zwischen Personalwirtschaft und Produktionswirtschaft beschrieben, die den Ansatz für eine Kapazitätsorientierung bilden. Dem folgt eine genaue Betrachtung der einzelnen Arbeitszeitmodelle und etwaigen Probleme, die eine Flexibilisierung der Arbeitszeit mit sich bringen kann. Es werden sowohl Ansätze der ersten Stunde als auch neue innovative Formen der flexiblen Arbeitszeit, wie z. B. Altersteilzeit und Vertrauensarbeitszeit erörtert. Abschließend erfolgt eine Bewertung der möglichen psychologischen und sozialen Auswirkungen, die sich als Folge einer Flexibilisierung der Arbeitszeit ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsbestimmung
- 1.2 Historischer Hintergrund
- 2. Grundlagen des Arbeitszeitmanagements
- 2.1 Zeiterfassung
- 2.2 Zeitbewertung
- 2.3 Zeitauswertung
- 2.3.1 Arbeitszeitkonten
- 2.3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen von Arbeitszeitkonten
- 2.3.3 Kurzzeit- und Langzeitkonten
- 2.4 Personaleinsatzplanung
- 3. Zusammenhänge zwischen Personal- und Produktionswirtschaft
- 3.1 Kurzfristige Störungen im Produktionsbereich
- 3.2 Vermeidung und Beseitigung von kurzfristigen Störungen
- 4. Instrumente des kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagements
- 4.1 Chronometrische Arbeitszeitmodelle
- 4.1.1 Teilzeitarbeit
- 4.1.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen der Teilzeitarbeit
- 4.1.1.2 Anwendungsgebiete der Teilzeitarbeit
- 4.1.1.3 Vor- und Nachteile der Teilzeitarbeit
- 4.1.2 Altersteilzeit
- 4.1.2.1 Rechtliche Grundlage der Altersteilzeit
- 4.1.2.2 Altersteilzeit am Beispiel der HEW AG
- 4.1.2.3 Altersteilzeit am Beispiel der Aesculap AG & Co. KG
- 4.1.2.4 Vor- und Nachteile der Altersteilzeit
- 4.1.1 Teilzeitarbeit
- 4.2 Chronologische Arbeitszeitmodelle
- 4.2.1 Gleitende Arbeitszeit
- 4.2.1.1 Anwendungsgebiete der gleitenden Arbeitszeit
- 4.2.1.2 Vor- und Nachteile der gleitenden Arbeitszeit
- 4.2.2 Schichtarbeit
- 4.2.2.1 Anwendungsgebiete der Schichtarbeit
- 4.2.2.2 Vor- und Nachteile der Schichtarbeit
- 4.2.1 Gleitende Arbeitszeit
- 4.3 Kombinierte Arbeitszeitmodelle
- 4.3.1 Job-Sharing
- 4.3.1.1 Anwendungsgebiete des Job-Sharings
- 4.3.1.2 Vor- und Nachteile des Job-Sharings
- 4.3.2 Zeitautonome Arbeitsgruppen
- 4.3.2.1 Anwendungsgebiete zeitautonomer Arbeitsgruppen
- 4.3.2.2 Vor- und Nachteile zeitautonomer Arbeitsgruppen
- 4.3.3 Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ)
- 4.3.3.1 Anwendungsgebiete der KAPOVAZ
- 4.3.3.2 Vor- und Nachteile der KAPOVAZ
- 4.3.4 Das Baukastenmodell
- 4.3.5 Das Modell der Jahresarbeitszeit
- 4.3.6 Das Modell der Lebensarbeitszeit
- 4.3.6.1 Anwendungsgebiete des Lebensarbeitszeitmodells
- 4.3.6.2 Vor- und Nachteile des Lebensarbeitszeitmodells
- 4.3.7 Vertrauensarbeitszeit
- 4.3.7.1 Anwendungsgebiete der Vertrauensarbeitszeit
- 4.3.7.2 Vor- und Nachteile der Vertrauensarbeitszeit
- 4.3.1 Job-Sharing
- 4.1 Chronometrische Arbeitszeitmodelle
- 5. Psychologische und soziale Dimensionen des Arbeitszeitmanagements
- 5.1 Psychologische Aspekte
- 5.2 Soziale Aspekte
- 6. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Arbeitszeitmodelle hinsichtlich ihrer Eignung für ein kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Personal- und Produktionswirtschaft im Kontext flexibler Arbeitszeitgestaltung zu beleuchten und verschiedene Modelle, einschließlich innovativer Ansätze, zu analysieren. Die potentiellen psychologischen und sozialen Auswirkungen flexibler Arbeitszeitmodelle werden ebenfalls betrachtet.
- Kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement
- Zusammenhang zwischen Personal- und Produktionswirtschaft
- Analyse verschiedener Arbeitszeitmodelle (chronometrisch und chronologisch)
- Flexibilisierung der Arbeitszeit
- Psychologische und soziale Implikationen flexibler Arbeitszeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema des kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagements ein. Sie definiert den Begriff des Arbeitszeitmanagements anhand verschiedener Autoren und erläutert den historischen Kontext, beginnend mit der Einführung der Gleitzeit in den 60er und 70er Jahren und den späteren Bestrebungen zur Arbeitszeitverkürzung. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, Arbeitszeitbedarf und -angebot unter Berücksichtigung rechtlicher und betrieblicher Rahmenbedingungen zu harmonisieren.
2. Grundlagen des Arbeitszeitmanagements: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis des Arbeitszeitmanagements. Es behandelt die wesentlichen Aspekte der Zeiterfassung, Zeitbewertung und Zeitauswertung, inklusive Arbeitszeitkonten und deren rechtliche Rahmenbedingungen. Besonders wichtig ist hier die Betrachtung von Kurzzeit- und Langzeitkonten. Die Personaleinsatzplanung wird als integraler Bestandteil des Arbeitszeitmanagements dargestellt, um die Effizienz zu gewährleisten.
3. Zusammenhänge zwischen Personal- und Produktionswirtschaft: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigen Interdependenzen zwischen Personal- und Produktionswirtschaft. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse kurzfristiger Störungen im Produktionsbereich und deren Vermeidung bzw. Beseitigung durch ein effektives Arbeitszeitmanagement. Die Optimierung der Arbeitszeitgestaltung wird als entscheidend für die reibungslose Produktion dargestellt.
4. Instrumente des kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagements: Dieses Kapitel analysiert diverse Instrumente für ein kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement. Es unterscheidet zwischen chronometrischen und chronologischen Modellen und beleuchtet detailliert die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze wie Teilzeitarbeit, Altersteilzeit, gleitende Arbeitszeit, Schichtarbeit, Job-Sharing, zeitautonome Arbeitsgruppen, KAPOVAZ, das Baukastenmodell, die Jahresarbeitszeit, das Lebensarbeitszeitmodell und die Vertrauensarbeitszeit. Jedes Modell wird im Kontext seiner Anwendung und Auswirkungen eingehend besprochen.
5. Psychologische und soziale Dimensionen des Arbeitszeitmanagements: Das Kapitel befasst sich mit den psychologischen und sozialen Aspekten des Arbeitszeitmanagements. Es analysiert die Auswirkungen verschiedener Arbeitszeitmodelle auf die psychische und soziale Befindlichkeit der Mitarbeiter. Die Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit und des Arbeitsklimas im Kontext von flexiblen Arbeitszeitmodellen wird herausgestellt.
Schlüsselwörter
Kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement, Arbeitszeitmodelle, Personalwirtschaft, Produktionswirtschaft, Flexibilisierung, Teilzeitarbeit, Altersteilzeit, Gleitzeit, Schichtarbeit, Job-Sharing, Zeitautonome Arbeitsgruppen, KAPOVAZ, Jahresarbeitszeit, Lebensarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, ökonomische Effizienz, soziale Effizienz, psychologische Aspekte, soziale Aspekte.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das kapazitätsorientierte Arbeitszeitmanagement. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Arbeitszeitmodelle und ihren Auswirkungen auf Personal-, Produktionswirtschaft sowie die psychologischen und sozialen Aspekte.
Welche Arbeitszeitmodelle werden behandelt?
Das Dokument behandelt eine Vielzahl von Arbeitszeitmodellen, sowohl chronometrische (z.B. Teilzeitarbeit, Altersteilzeit) als auch chronologische (z.B. Gleitzeit, Schichtarbeit) Modelle. Zudem werden kombinierte Modelle wie Job-Sharing, zeitautonome Arbeitsgruppen, KAPOVAZ, das Baukastenmodell, die Jahresarbeitszeit, das Lebensarbeitszeitmodell und die Vertrauensarbeitszeit detailliert analysiert. Für jedes Modell werden Anwendungsgebiete, Vor- und Nachteile erläutert.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Arbeitszeitmodelle hinsichtlich ihrer Eignung für ein kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement zu untersuchen. Es soll der Zusammenhang zwischen Personal- und Produktionswirtschaft im Kontext flexibler Arbeitszeitgestaltung beleuchtet und eine Analyse verschiedener Modelle, inklusive innovativer Ansätze, durchgeführt werden. Die potentiellen psychologischen und sozialen Auswirkungen werden ebenfalls betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf dem kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagement, dem Zusammenhang zwischen Personal- und Produktionswirtschaft, der Analyse verschiedener Arbeitszeitmodelle (chronometrisch und chronologisch), der Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie den psychologischen und sozialen Implikationen flexibler Arbeitszeit.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Das Dokument gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (Begriffsbestimmung und historischer Hintergrund), Grundlagen des Arbeitszeitmanagements (Zeiterfassung, Zeitbewertung, Zeitauswertung, Personaleinsatzplanung), Zusammenhänge zwischen Personal- und Produktionswirtschaft (kurzfristig Störungen und deren Vermeidung), Instrumente des kapazitätsorientierten Arbeitszeitmanagements (detaillierte Analyse verschiedener Modelle), Psychologische und soziale Dimensionen des Arbeitszeitmanagements und abschließende Bemerkungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter umfassen: Kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement, Arbeitszeitmodelle, Personalwirtschaft, Produktionswirtschaft, Flexibilisierung, Teilzeitarbeit, Altersteilzeit, Gleitzeit, Schichtarbeit, Job-Sharing, Zeitautonome Arbeitsgruppen, KAPOVAZ, Jahresarbeitszeit, Lebensarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, ökonomische Effizienz, soziale Effizienz, psychologische Aspekte, soziale Aspekte.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Das Dokument berührt verschiedene rechtliche Aspekte, insbesondere im Kontext von Arbeitszeitkonten, Teilzeitarbeit und Altersteilzeit. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen werden jedoch nicht im Detail erläutert, sondern eher als Kontext für die jeweiligen Arbeitszeitmodelle dargestellt.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Arbeitszeitmanagement, Personalwirtschaft und Produktionswirtschaft beschäftigen. Es eignet sich auch für alle, die ein tiefergehendes Verständnis von verschiedenen Arbeitszeitmodellen und deren Auswirkungen gewinnen möchten.
- Quote paper
- Markus Kotzur (Author), 2002, Kapazitätsorientiertes Arbeitszeitmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8029