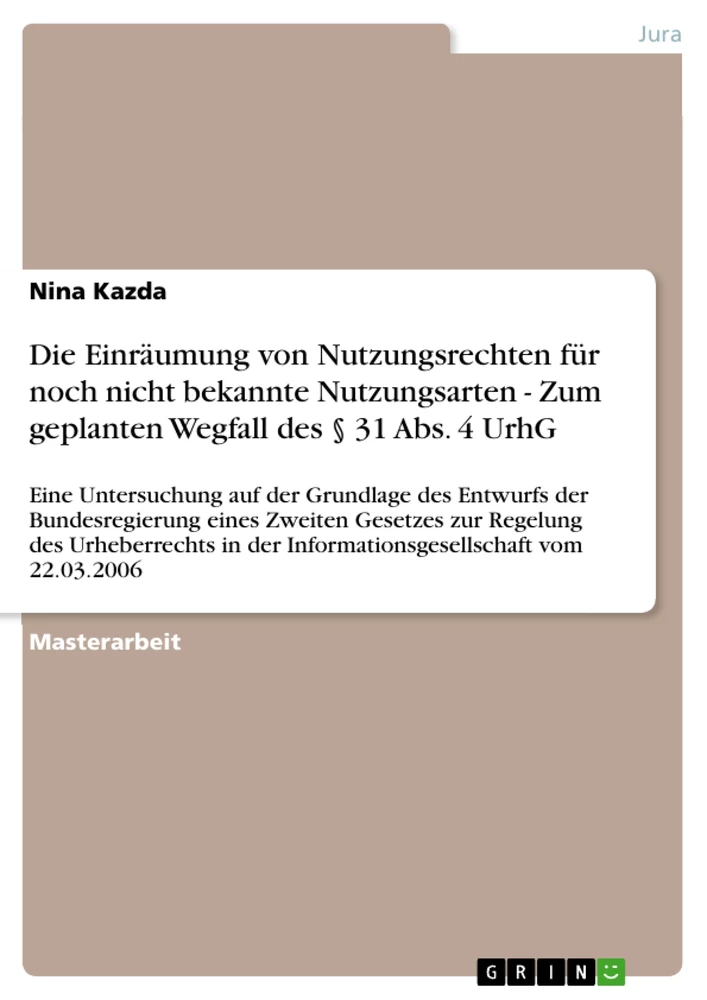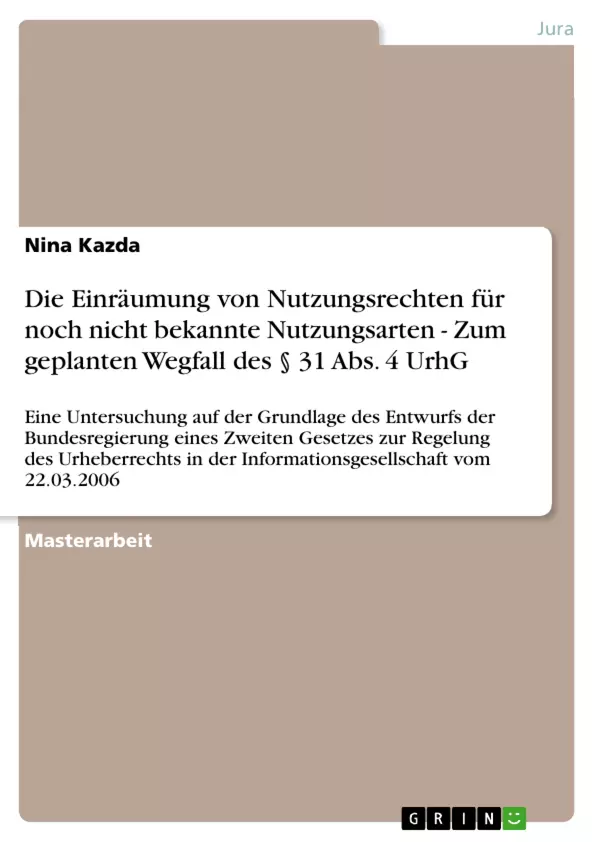Unsere Gesellschaft lebt von Informationen und anderen Geistesgütern. Neue Technologien verändern die Grundlagen ihrer Schöpfung, ihrer Verkehrsfähigkeit und ihrer Rezeption zunehmend. Das zeigt sich am Beispiel der Digitaltechnik besonders deutlich. Geradezu revolutionierend sind ihre Auswirkungen auf die Vermittlung von Inhalten gewesen. Sie hat Kommunikationsprozesse, Wissensverwaltung und das Konsumverhalten im Hinblick auf Informationen grundlegend verändert.
Die Europäische Union hatte den hieraus folgenden Regelungsbedarf erkannt und eine Harmonisierungsrichtlinie erlassen, die als Informationsrichtlinie bekannt ist.
Nachdem der deutsche Gesetzgeber 2003 seinerseits mit dem sogenannten „Korb I“ den ersten Schritt zur Anpassung des Urheberrechts an das digitale Zeitalter vollzogen hat, steht nun der nächste bevor: Das Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ist im Entstehen.
Hierbei zog die Bundesregierung die Konsequenz daraus, dass die fortschreitende technische Entwicklung immer schneller neue Nutzungsarten hervorbringt. Im Zuge der geplanten Neuregelung lockerte sie das derzeit in § 31 Abs. 4 UrhG geregelte und für Urheber geltende Verbot, über Rechte an unbekannten Nutzungsarten zu verfügen. Die Norm begrenzt das Recht des Urhebers, einem anderen das Recht einzuräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen.
Vorgesehen ist, die Vorschrift an dieser Stelle ersatzlos zu streichen und eine auf mehrere Normen verteilte Neuregelung einzufügen. Diese kehrt sich vom Verbot ab und erlaubt statt dessen, grundsätzlich über Rechte an unbekannten Nutzungsarten zu verfügen. Flankiert wird die Regelung vom Anspruch des Urhebers auf angemessene Vergütung.
Die vorliegende Arbeit beleuchtet den Willensbildungsprozess zur vorgeschlagenen Novellierung sowie die Argumente für und gegen deren Inkrafttreten. Den Stellungnahmen der Interessenverbände kommt dabei erhöhte Aufmerksamkeit zu.
Es werden zunächst die rechtlichen und faktischen Umstände der Ausgangssituation untersucht (Teil 1 und Teil 2). Sodann folgt eine Darstellung des Zustandekommens des Gesetzesentwurfs (Teil 3). Die konkreten Einzelelemente der geplanten Regelung werden erörtert, bevor abschließend im Wege einer Gesamtschau der Frage nachgegangen wird, ob die Abschaffung des Verbots tatsächlich geeignet ist, der von der Bundesregierung angestrebten weitläufigen Verfügung über unbekannte Nutzungsarten den Weg zu ebnen (Teil 4).
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. TEIL: GELTENDE RECHTSLAGE
- I. Allgemeine Grundlagen
- 1. Geistiges Eigentum und Urheberrecht
- 2. Nationale Grundlagen
- 2.1. Vorgaben des Grundgesetzes
- 2.2. Einfachgesetzliche Ausgestaltung
- II. Die Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG
- 1. Grundlagen
- 1.1. Entstehungsgeschichte
- 1.2. Sinn und Zweck
- 1.3. Systematische Einordnung
- 2. § 31 Abs. 4 UrhG in der Anwendungspraxis
- 2.1. Zeitlicher und räumlicher Anwendungsbereich
- 2.2. Arbeitsverhältnisse und Verwertungsgesellschaften
- 2.3. Begriff der unbekannten Nutzungsart
- 2.4. Risikogeschäfte
- 2.5. Rechtsfolge
- III. Vergleich mit anderen Rechtsordnungen
- 1. Europa
- 2. USA
- 2. TEIL: DER RUF NACH VERÄNDERUNG
- I. Vorbemerkung
- II. Die einzelnen Kritikpunkte
- 3. TEIL: DER GESETZESENTWURF DER BUNDESREGIERUNG
- I. Die Neuregelung als Teil von Korb II
- 1. Grundlagen von Korb II - Die Informationsrichtlinie der Europäischen Union
- 2. Keine ausdrückliche Pflicht zur Abschaffung von § 31 Abs. 4 UrhG
- 3. Sonstige Änderungen durch Korb II
- II. Vom Referentenentwurf zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung
- 1. Überblick über das Zustandekommen des Regierungsentwurfs
- 2. Der erste Referentenentwurf vom 27. September 2004
- 3. Der überarbeitete Entwurf vom 3. Januar 2006
- 4. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 22. März 2006
- 4. TEIL: UNTERSUCHUNG DES ENTWURFS UND KRITISCHE WÜRDIGUNG
- I. Die einzelnen Elemente der vorgeschlagenen Neuregelung für künftige Verträge
- 1. Schriftformerfordernis
- 2. Widerrufsrecht
- 2.1. Keine besondere Rechtfertigung
- 2.2. Kein Widerrufsrecht nach Aufnahme der neuen Nutzung
- 2.3. Entfallen des Widerrufsrechts
- 2.4. Keine Hinweispflicht über beabsichtigte Verwertung in der neuen Nutzungsart
- 2.5. Mehrere Mitwirkende
- 3. Verzichtsverbot
- 4. Angemessene Vergütung
- 4.1. Übermachstellung der Verwerter
- 4.2. Der Anspruch in seiner konkreten Ausgestaltung
- 5. Hinweispflicht
- 6. Haftung bei Weiterlizenzierung
- II. Die Übergangsregelung für neue Nutzungsarten
- 1. Hintergrund der Vorschrift
- 2. Altverträge
- 3. Übertragungsfiktion
- 4. Der ursprüngliche Rechtserwerb
- 4.1. Erforderliche Einzelfeststellung
- 4.2. Art und Umfang des Rechtserwerbs
- 5. Erlangte Rechtsstellung bei Anwendbarkeit des § 1371 UrhG-E
- 6. Widerspruch
- 6.1. Wegfall der Widerspruchberechtigung
- 6.2. Keine Unterrichtungspflicht
- 6.3. Wirkung des Widerspruchs
- 6.4. Sonderfall der Weiterübertragung eingeräumter Rechte
- 7. Mehrere Mitwirkende
- 8. Vergütung
- 9. Kritik an der Norm in ihrer Gesamtheit
- 10. Alternative Lösungsansätze
- III. Filmspezifisches
- IV. Die vorgeschlagenen Änderungen als Gesamtkonzept
- 1. Ausgestaltung der Regelungen und praktische Auswirkungen
- 2. Unterscheidung zwischen bekannter und unbekannter Nutzungsart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den geplanten Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG auf Grundlage des Regierungsentwurfs vom 22.03.2006. Ziel ist die kritische Würdigung der vorgeschlagenen Neuregelung. Die Arbeit analysiert die bestehende Rechtslage, die Kritikpunkte an § 31 Abs. 4 UrhG und die Auswirkungen des Gesetzesentwurfs.
- Analyse der geltenden Rechtslage bezüglich der Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten.
- Bewertung der Kritikpunkte am § 31 Abs. 4 UrhG und deren Begründung.
- Untersuchung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung und dessen Auswirkungen auf zukünftige Verträge.
- Auswertung der vorgeschlagenen Übergangsregelungen.
- Bewertung des Gesamtkonzepts der vorgeschlagenen Änderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG: Die Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und beschreibt den Gegenstand der Untersuchung: den geplanten Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG und die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik der Analyse.
1. TEIL: GELTENDE RECHTSLAGE: Dieser Teil beschreibt die geltende Rechtslage zum Thema Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten. Er erläutert die allgemeinen Grundlagen des geistigen Eigentums und des Urheberrechts, bevor er detailliert auf die Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG eingeht. Die Entstehungsgeschichte, der Sinn und Zweck sowie die systematische Einordnung der Norm werden analysiert. Des Weiteren wird die Anwendungspraxis beleuchtet, inklusive der Problematik des Begriffs "unbekannte Nutzungsart" und der damit verbundenen Rechtsunsicherheiten. Abschließend findet ein Vergleich mit anderen Rechtsordnungen (Europa und USA) statt.
2. TEIL: DER RUF NACH VERÄNDERUNG: Dieser Teil beleuchtet die Kritikpunkte am bestehenden § 31 Abs. 4 UrhG. Es werden verschiedene Argumente gegen die Norm dargelegt, wie beispielsweise die unverhältnismäßig hohen Kosten des Nacherwerbs von Nutzungsrechten für neue Technologien, die Investitionshemmende Wirkung und die Rechtsunsicherheit. Die Kritikpunkte werden systematisch dargestellt und analysiert, um die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung zu belegen.
3. TEIL: DER GESETZESENTWURF DER BUNDESREGIERUNG: Dieser Teil präsentiert und analysiert den Gesetzesentwurf der Bundesregierung als Reaktion auf die Kritik am § 31 Abs. 4 UrhG. Der Entwurf wird im Kontext der europäischen Informationsrichtlinie und des "Korb II" eingeordnet. Der Entstehungsprozess des Entwurfs wird nachvollzogen, von den ersten Referentenentwürfen bis zur finalen Regierungsfassung. Die einzelnen Änderungen und Neuerungen werden im Detail beschrieben und erste Einschätzungen zu den möglichen Auswirkungen gegeben.
4. TEIL: UNTERSUCHUNG DES ENTWURFS UND KRITISCHE WÜRDIGUNG: Dieser Teil bietet eine detaillierte Untersuchung und kritische Würdigung des Regierungsentwurfs. Die einzelnen Elemente der vorgeschlagenen Neuregelung für künftige Verträge werden analysiert, darunter das Schriftformerfordernis, das Widerrufsrecht und die Regelung zur angemessenen Vergütung. Die Übergangsregelung für neue Nutzungsarten wird ebenfalls eingehend betrachtet, einschließlich der Problematik von Altverträgen und der Übertragungsfiktion. Der Teil schließt mit einer umfassenden Beurteilung des Gesamtkonzepts und möglicher Alternativen. Der filmspezifische Aspekt der Neuregelung wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Urheberrecht, Nutzungsrechte, unbekannte Nutzungsarten, § 31 Abs. 4 UrhG, Gesetzesentwurf, Informationsgesellschaft, Rechtsunsicherheit, Vergütung, Verträge, Kritik, Reform, europäische Informationsrichtlinie, Investitionen, Technologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Geplanter Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den geplanten Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG auf Grundlage des Regierungsentwurfs vom 22.03.2006. Der Fokus liegt auf der kritischen Würdigung der vorgeschlagenen Neuregelung und den damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die bestehende Rechtslage zum Thema Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten, bewertet die Kritikpunkte am § 31 Abs. 4 UrhG, untersucht den Gesetzesentwurf der Bundesregierung und dessen Auswirkungen auf zukünftige Verträge, bewertet die vorgeschlagenen Übergangsregelungen und schließlich das Gesamtkonzept der vorgeschlagenen Änderungen.
Welche Rechtslage wird untersucht?
Die Arbeit untersucht zunächst die allgemeine Rechtslage zum geistigen Eigentum und Urheberrecht, insbesondere die nationale Rechtslage (Grundgesetz und einfachgesetzliche Ausgestaltung) und die Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG. Die Entstehungsgeschichte, der Sinn und Zweck, die systematische Einordnung und die Anwendungspraxis dieser Norm werden detailliert analysiert. Ein Vergleich mit anderen Rechtsordnungen (Europa und USA) wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Kritikpunkte am § 31 Abs. 4 UrhG werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Kritikpunkte am § 31 Abs. 4 UrhG, beispielsweise die unverhältnismäßig hohen Kosten des Nacherwerbs von Nutzungsrechten für neue Technologien, die investitionshemmende Wirkung und die Rechtsunsicherheit. Diese Kritikpunkte werden systematisch dargestellt und analysiert, um die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung zu belegen.
Wie wird der Gesetzesentwurf der Bundesregierung behandelt?
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung wird im Kontext der europäischen Informationsrichtlinie und des "Korb II" eingeordnet. Der Entstehungsprozess des Entwurfs wird nachvollzogen, von den ersten Referentenentwürfen bis zur finalen Regierungsfassung. Die einzelnen Änderungen und Neuerungen werden detailliert beschrieben, und es werden erste Einschätzungen zu den möglichen Auswirkungen gegeben.
Was wird im Detail im Regierungsentwurf analysiert?
Der vierte Teil der Arbeit bietet eine detaillierte Untersuchung und kritische Würdigung des Regierungsentwurfs. Analysiert werden einzelne Elemente wie das Schriftformerfordernis, das Widerrufsrecht, die angemessene Vergütung, die Übergangsregelung für neue Nutzungsarten (einschließlich Altverträge und Übertragungsfiktion). Der filmspezifische Aspekt wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Arbeit behandelt folgende Schlüsselwörter: Urheberrecht, Nutzungsrechte, unbekannte Nutzungsarten, § 31 Abs. 4 UrhG, Gesetzesentwurf, Informationsgesellschaft, Rechtsunsicherheit, Vergütung, Verträge, Kritik, Reform, europäische Informationsrichtlinie, Investitionen, Technologie.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Einleitung der Arbeit skizziert die Methodik der Analyse, die eine umfassende Untersuchung der bestehenden Rechtslage, eine systematische Darstellung der Kritikpunkte und eine detaillierte Analyse des Gesetzesentwurfs umfasst. Die Arbeit kombiniert deskriptive und analytische Methoden, um eine kritische Würdigung der vorgeschlagenen Neuregelung zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- LL.M. Nina Kazda (Autor:in), 2006, Die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten - Zum geplanten Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80341