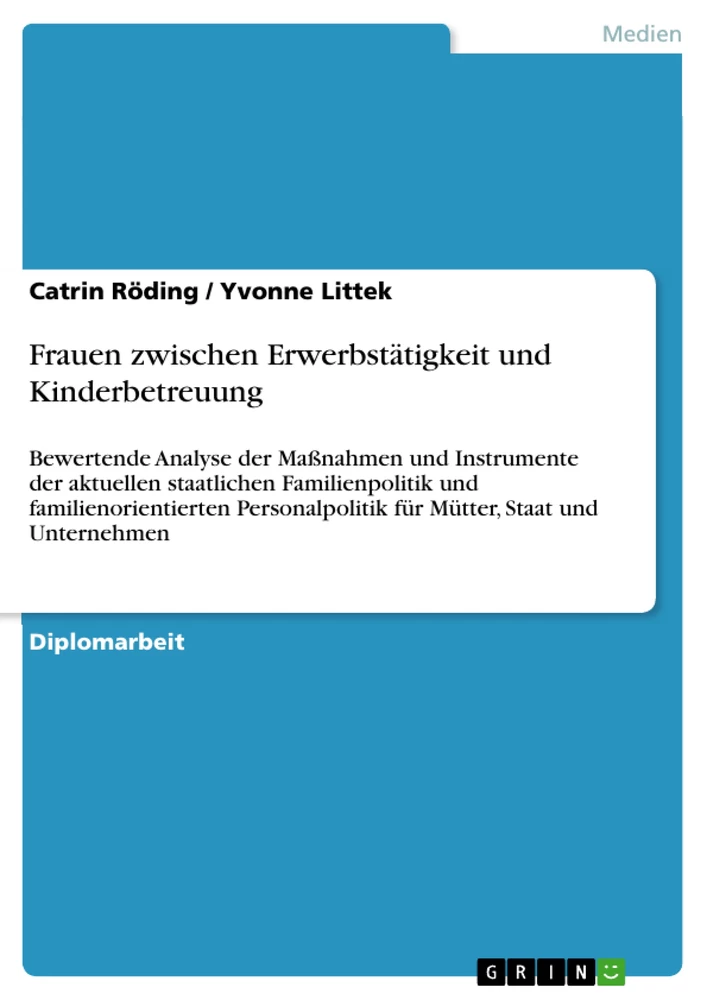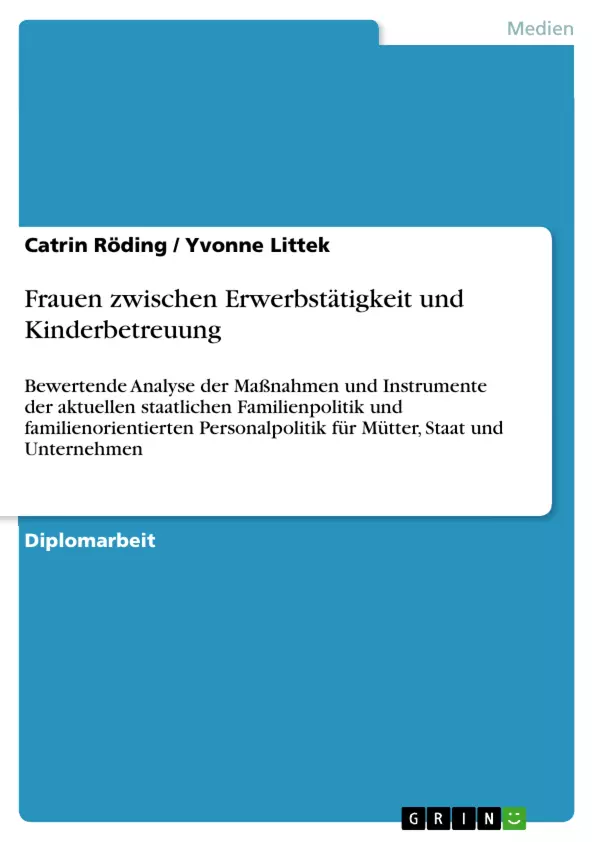Die Arbeit beschäftigt sich mit der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung von Frauen in Deutschland. Die Autorinnen gehen dabei von der empirisch fundierten Feststellung aus, dass Frauen bzw. Mütter sich zwar eine Erwerbstätigkeit parallel zur Kinderbetreuung wünschen, aber ein hoher Prozentsatz der davon betroffenen Mütter dies nicht realisiert bzw. nur unter Schwierigkeiten realisieren kann. Um die Hintergründe für diese Problematik zu analysieren und Handlungsempfehlungen zur Überwindung dieses Zustandes zu entwickeln, werden aus unterschiedlichsten Perspektiven sowohl Ursachen als auch Lösungsalternativen für diese Diskrepanz vorgestellt, diskutiert und bewertet.
Hierzu dienten die folgenden Fragestellungen:
- Welche Beweggründe und Rahmenbedingungen lassen den Wunsch in den Müttern entstehen, Beruf und Familie vereinen zu wollen?
- Welche Effekte und Vorteile entstehen dem Staat und der Volkswirtschaft durch eine verbesserte Balance von Beruf und Familie?
- Wie sind die derzeitigen familienpolitischen Instrumente in Deutschland gestaltet und welche Auswirkungen haben sie auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
- Welche Vorteile haben Unternehmen, wenn sie sich familienpolitisch einsetzen?
- Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, den Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, und wie sind diese Instrumente hinsichtlich der Balance zu bewerten?
- Welche bundesweiten Initiativen werden derzeit angeboten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu realisieren?
- Wie ist die Familienpolitik in den europäischen Best-practise Ländern Frankreich und Dänemark gestaltet und welche Maßnahmen lassen diese Länder erfolgreich werden?
- Welche expliziten Handlungsempfehlungen können für Deutschland abgeleitet werden?
Das Ziel der Arbeit besteht darin, allen Beteiligten ein besseres Verständnis für die Lage der Mütter zu vermitteln und die Wichtigkeit einer leichteren Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung nicht nur für die Mütter und Familien selbst, sondern auch für den Staat und die Gesellschaft und für die Unternehmen zu betonen sowie mögliche Handlungsalternativen für eine bessere Vereinbarkeit darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen der Mütter (L)
- Sozialpolitische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen (L)
- Betreuungsangebote (L)
- Zusammenhang Betreuungsangebot und Erwerbstätigkeit (L)
- Mütter sind (nicht nur) das Beste für ihre Kinder (L)
- Historische gewachsene Erwartung an die Mutterrolle (L)
- Gesellschaftlicher Wert der Erziehungs- und Hausarbeit (L)
- Soziale Absicherung (L)
- Gesetzliche Rentenversicherung (L)
- Gesetzliche Arbeitslosenversicherung (L)
- Gesetzliche Unfallversicherung (L)
- Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (L)
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen/Einflussfaktoren (R)
- Historische Entwicklung
- Aktuelle Situation
- Individuelle Sicht (L)
- Bildung der Frau (L)
- Finanzielle Unabhängigkeit (L)
- Folgen der Erwerbsunterbrechung auf das Humankapital (L)
- Wohlbefinden berufstätiger Mütter (L)
- Persönliches Wohlbefinden der Mutter (L)
- Auswirkungen auf die Partnerschaft (L)
- Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung (L)
- Beweggründe aus Sicht des Staates und der Volkswirtschaft (L)
- Steigerung der (potentiellen) Erwerbsbeteiligung (L)
- Geburtenrate (L)
- Aktuelle und potentielle Geburtenrate (L)
- Zusammenhang Vereinbarkeit/Geburtenrate (L)
- Steigende Frauenerwerbsquote (L)
- Arbeitskräfte für zusätzliche Betreuungsplätze (L)
- Effekte aus Sicht des Staates und der Volkswirtschaft (L)
- Einnahme-/Einspareffekte (L)
- Soziale Sicherungssysteme (L)
- Steuereinnahmen (L)
- Einsparungen (L)
- Exkurs: Fiskalische Bilanz eines Kindes (L)
- Gesellschaftspolitischer Effekt (L)
- Volkswirtschaftliche Effekte (L)
- Innovation (L)
- Humankapital (L)
- Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, gesellschaftlicher Wohlstand (L)
- Familienpolitische Maßnahmen des Staates (R)
- Aufgaben und Ziele der deutschen Familienpolitik (R)
- Träger der deutschen Familienpolitik (R)
- Öffentliche Träger (R)
- Kommunale Ebene (R)
- Bundesländerebene (R)
- Bundesebene (R)
- EU-Ebene (R)
- Nicht-öffentliche Träger (R)
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege (R)
- Tarifpartner (R)
- Unternehmen (R)
- Familienpolitische Maßnahmen in Deutschland (R)
- Zeitpolitik als Teil der deutschen Familienpolitik (R)
- Mutterschutzregelungen (R)
- Anspruchsberechtigte (R)
- Leistungen und Schutzvorschriften (R)
- Finanzielle Leistungen (R)
- Schutzvorschriften (R)
- Erziehungsurlaub/Elternzeit (R)
- Anspruchsberechtigte (R)
- Umfang/Regelungen der Elternzeit (R)
- (Aus-)Wirkungen der Elternzeit (R)
- Monetäre Leistungen in der deutschen Familienpolitik (R)
- Kindergeld (R)
- Erziehungsgeld (R)
- Bezugsberechtigte (R)
- Höhe des Erziehungsgeldes (R)
- Elterngeld (R)
- Bezugsberechtigte (R)
- Höhe des Elterngeldes (R)
- Kritik am Elterngeld (R)
- (Aus-) Wirkungen des Elterngeldes (R)
- Unterhaltsvorschuss (R)
- Kinderzuschlag (R)
- Kranken-/Renten-/Arbeitslosenversicherung (R)
- Steuerliche Regelungen (R)
- Kinderfreibetrag (R)
- Kinderbetreuungskosten (R)
- Ausbildungsfreibetrag (R)
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (R)
- Exkurs: Das Ehegattensplitting - ein Hemmnis für die Frauenerwerbstätigkeit? (R)
- Infrastrukturleistungen in der deutschen Familienpolitik (R)
- Derzeitige Versorgung mit institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen und tatsächlicher Bedarf (R)
- Bedeutung der institutionellen Kinderbetreuung für die Erwerbstätigkeit von Müttern (R)
- Gründe für eine betriebliche Familienpolitik (R)
- Einsparpotentiale durch familienfreundliche Maßnahmen (R)
- Wiederbeschaffungs- bzw. Fluktuationskosten (R)
- Wiedereingliederungskosten (R)
- Überbrückungskosten (R)
- Kosten für Fehlzeiten (R)
- Weitere Vorteile einer familienorientierten Personalpolitik (R)
- Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung in Unternehmen (R)
- Notwendigkeit/Bedeutung der Arbeitszeitflexibilisierung (R)
- Definition der Arbeitszeit (-flexibilisierung) (R)
- Rechtliche Rahmenbedingungen (R)
- Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) (R)
- Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) (R)
- Flexible Arbeitszeitmodelle (R)
- Flexible Teilzeitmodelle (R)
- Teilzeit während der Elternzeit (R)
- Arbeit auf Abruf (KAPOVAZ) (R)
- Jobsharing (R)
- Geringfügige Beschäftigung: Mini- und Midijobs (R)
- Flexible Arbeitszeitkontenmodelle (R)
- Gleitzeit (R)
- Überstundenkonten (R)
- Ampelkonten/Arbeitszeitkorridore (R)
- Jahresarbeitsverträge (R)
- Sabbaticals und Lebensarbeitszeitkonten
- Vertrauensarbeitszeit (L)
- Begriffserklärung (L)
- Chancen und Hemmnisse (L)
- Spezielle rechtliche Aspekte (L)
- Herausforderungen und Rahmenbedingungen für berufstätige Mütter
- Analysen der aktuellen Familienpolitik in Deutschland
- Bewertung von Maßnahmen und Instrumenten der Familienpolitik
- Bedeutung von familienorientierter Personalpolitik für Unternehmen
- Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung in Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rahmenbedingungen, die Familienpolitik und die Personalpolitik im Kontext der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung für Mütter. Sie analysiert sowohl die Situation aus der Perspektive der Mütter als auch aus der Perspektive des Staates und der Unternehmen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Rahmenbedingungen für Mütter, die sich in zwei Teile gliedert. Der erste Teil behandelt die sozialpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wobei die Themen Kinderbetreuung, die historische Erwartung an die Mutterrolle und die soziale Absicherung im Vordergrund stehen. Der zweite Teil beleuchtet die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die die Entscheidung von Müttern für oder gegen eine Erwerbstätigkeit beeinflussen.
Im nächsten Kapitel werden die Beweggründe aus Sicht des Staates und der Volkswirtschaft erläutert. Dabei wird die Bedeutung der Steigerung der (potentiellen) Erwerbsbeteiligung von Müttern für das Wirtschaftswachstum und den gesellschaftlichen Wohlstand hervorgehoben.
Kapitel 4 widmet sich den familienpolitischen Maßnahmen des Staates in Deutschland. Es werden die verschiedenen Träger und die wichtigsten Maßnahmen wie Mutterschutz, Elternzeit, Kindergeld, Elterngeld und die Infrastruktur für die Kinderbetreuung analysiert.
Kapitel 5 untersucht die Gründe für eine betriebliche Familienpolitik und beleuchtet die Einsparpotentiale und weiteren Vorteile für Unternehmen, die familienfreundliche Maßnahmen umsetzen.
Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung in Unternehmen. Verschiedene Modelle, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienleben werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Frauenerwerbstätigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung, Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Arbeitszeitflexibilisierung, betriebliche Familienpolitik, Humankapital, Wirtschaftswachstum, gesellschaftlicher Wohlstand
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Deutschland problematisch?
Trotz des Wunsches vieler Mütter nach Erwerbstätigkeit verhindern oft mangelnde Betreuungsangebote, historisch gewachsene Rollenbilder und unflexible Arbeitsstrukturen eine erfolgreiche Umsetzung.
Welche Vorteile bietet eine bessere Vereinbarkeit für den Staat?
Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen steigert die Steuereinnahmen, entlastet die Sozialsysteme, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und kann die Geburtenrate positiv beeinflussen.
Was sind die wichtigsten familienpolitischen Maßnahmen in Deutschland?
Dazu gehören der Mutterschutz, die Elternzeit, das Elterngeld sowie der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung (Kitas) und steuerliche Erleichterungen wie das Ehegattensplitting.
Wie können Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern?
Unternehmen können flexible Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Jobsharing, Homeoffice oder Vertrauensarbeitszeit einführen und betriebliche Kinderbetreuung unterstützen.
Was ist das Ziel des Elterngeldes?
Das Elterngeld soll den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abfedern und es beiden Elternteilen ermöglichen, für einen gewissen Zeitraum die Betreuung zu übernehmen.
Welche Rolle spielt das "Ehegattensplitting"?
Die Arbeit diskutiert, ob das Ehegattensplitting ein Hemmnis für die Frauenerwerbstätigkeit darstellt, da es steuerliche Vorteile bietet, wenn ein Partner (oft die Frau) weniger verdient oder zu Hause bleibt.
- Quote paper
- Catrin Röding (Author), Yvonne Littek (Author), 2007, Frauen zwischen Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80559