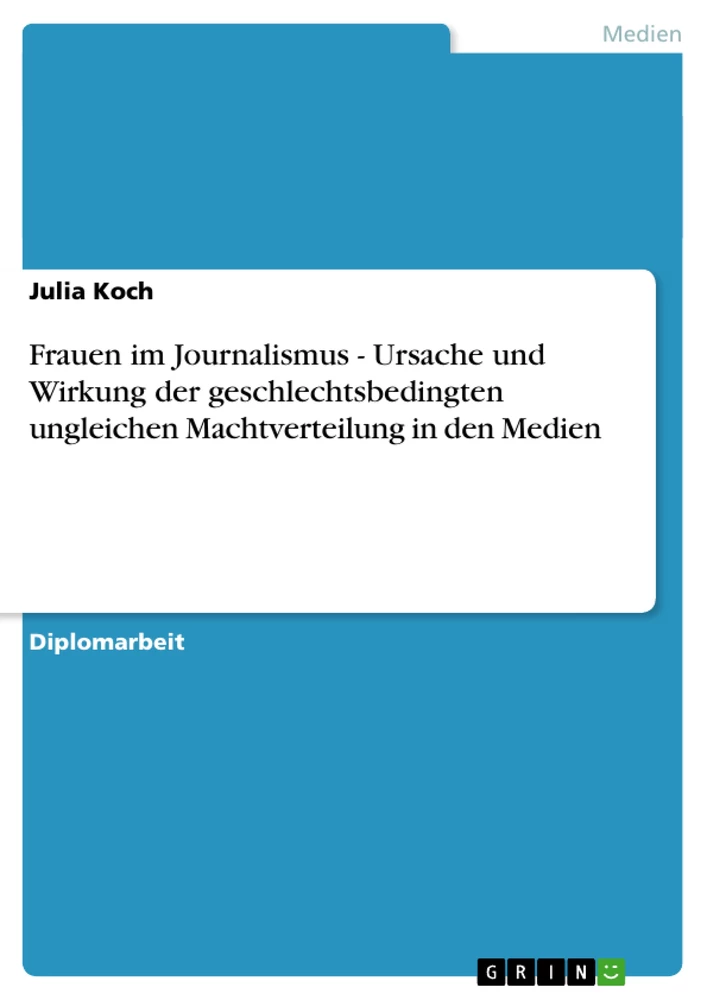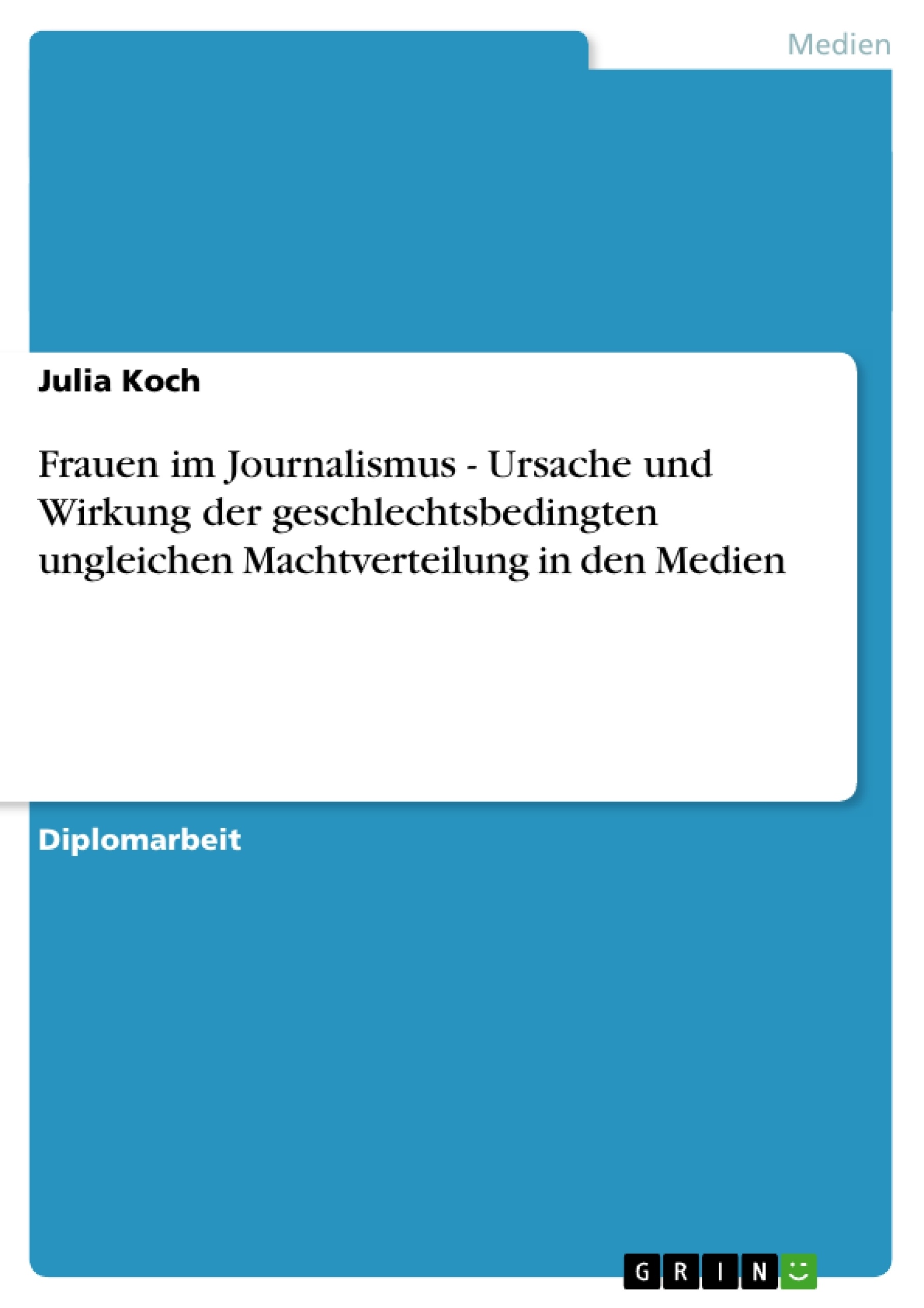Die Moderatorin der Tagesthemen ist eine Frau - aber der mit Prestige verbundene Kommentar wird meistens von einem Mann gesprochen.* Eine Frau moderiert eine politische Talkshow - und bekommt 1999 die "Saure Gurke" für die frauenfeindlichste Sendung des Jahres im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verliehen, weil in 38 Ausgaben von "Sabine Christiansen" nur 43 Frauen zu Gast waren, aber 201 Männer.1 Diese beiden Beispiele aus der ARD sind exemplarisch für die zwei Probleme, die ich in dieser Arbeit behandeln und erklären will: Frauen sind in den angesehensten Bereichen des Journalismus unterrepräsentiert, und ihre Sichtweise wird marginalisiert - auch von den meisten Journalistinnen, in Anpassung an die herrschende Medienkultur.
Nicht alle Journalistinnen würden diese Arbeit für notwenig halten. Monika Zimmermann beispielsweise, Chefredakteurin des Westfälischen Anzeigers in Hamm, habe für das Thema "Frauen und Medien" nur ein müdes Lächeln übrig, steht im Journalist: "Frauenquote, Frauenpower, Frauenbewegung - wenn ich das Wort ′Frau′ schon höre, schalte ich für gewöhnlich ab2." Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin und Programmdirektorin von Radio NRW, glaubt nicht, dass Frauen wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden und nicht die gleichen Chancen haben wie Männer: "Wenn Frauen in diesem Beruf etwas erreichen wollen und hart genug dafür arbeiten, dann schaffen sie das."3
Von Engagement in der Frauenbewegung hält sie nichts: "Man kann entweder für die Sache der Frauen kämpfen oder Karriere machen."4 (Indirekt gibt sie also doch zu, dass ein Kampf nötig ist.) Auf der anderen Seite stehen zum Beispiel die etwa 500 Frauen, die sich im Journalistinnenbund organisiert haben, offensichtlich weil sie das Gefühl haben, nicht die gleichen Chancen zu besitzen. Laut Keil arbeiten Frauen heute selbstverständlich in den Ressorts Wirtschaft und Politik, und nur der Sport bildet als letzte Männerbastion die Ausnahme.5 Dagegen sagt eine Wirtschaftsjournalistin: "In den harten Ressorts tauchen Frauen höchstens als Sekretärinnen auf." .
[...]
* Auf der KommentatorInnenliste der ARD stehen 52 männliche und nur 9 weibliche Namen (Hesse, 2002). Aber selbst diese geringe Zahl von Frauen scheint mir hoch verglichen mit der tatsächlichen Erscheinungsweise auf dem Bildschirm.
[...]
_____
1 Hesse, 2002
2 Kaiser, 1999, S.17
3 Sitter, 1998, S. 497
4 Ebd., S.498
5 Keil, 2002, S.6
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mediensektor und seine Produkte
- Von Männern dominiert
- Entwicklung des Arbeitsmarktes
- Androzentrismus als Konsequenz für die Medienprodukte und die Gesellschaft
- Darstellung der Situation von Journalistinnen in Zahlen
- Frauenanteil im Journalismus
- Horizontale Segregation - Journalistinnen im Medien- und Ressortvergleich
- Vertikale Segregation - Journalistinnen in Führungspositionen
- Familiäre Situation
- Gründe für die ungleiche Machtverteilung
- Diskriminierung durch männlich dominierte Arbeitswelt
- Zur Wahrnehmung von Diskriminierung
- Diskriminierung auf der Strukturebene
- Der Konflikt zwischen Karriere und Familie
- Teilzeit ist selten möglich
- Männliche Unternehmenskultur
- Diskriminierung auf der Verhaltensebene
- Selbstverhinderung und Karriereverzicht als Folge der Geschlechterkonstruktion
- Diskriminierung durch männlich dominierte Arbeitswelt
- Bestehende und mögliche Strategien zum Abbau der kulturellen Hindernisse
- Der feministische Blick
- Feministische Denkrichtungen und ihre Anwendung im Medienbereich
- Feminismus im journalistischen Alltag
- Offizielle Förderung
- Eigeninitiativen
- Frauennetzwerke und Frauengruppen
- Mentoring
- Vorschläge zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Veränderung der Unternehmenskultur
- Der feministische Blick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der ungleichen Machtverteilung im Journalismus, insbesondere mit der Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen und der Marginalisierung ihrer Sichtweise. Die Arbeit untersucht die Ursachen für diese Ungleichheit und analysiert verschiedene Strategien zum Abbau der kulturellen Hindernisse.
- Die ungleiche Machtverteilung im Journalismus und ihre Ursachen
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Geschlechterbildern
- Die Auswirkungen von Diskriminierung und Selbstverhinderung auf den Karriereweg von Frauen im Journalismus
- Feministische Perspektiven auf die Geschlechterfrage im Journalismus
- Strategien zur Förderung der Gleichstellung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der ungleichen Machtverteilung im Journalismus ein und stellt zwei exemplarische Beispiele aus der ARD vor. Kapitel 1 beleuchtet den Mediensektor und seine Produkte, wobei insbesondere der Einfluss der männlichen Dominanz auf die Medienlandschaft thematisiert wird. In Kapitel 2 werden die statistisch messbaren Unterschiede zwischen Journalisten und Journalistinnen anhand von Zahlen zur Arbeits- und Lebenssituation von Journalistinnen dargestellt. Kapitel 3 geht der Frage nach, welche Faktoren Frauen in den Medien auf ihrem Karriereweg behindern und warum es so wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Die Erklärungsmodelle werden in zwei Gruppen eingeteilt: „Das Patriarchat ist schuld" und „Die Frauen sind selbst schuld".
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen der geschlechtsbedingten ungleichen Machtverteilung im Journalismus, der Diskriminierung von Frauen, der Konstruktion von Geschlechterbildern in den Medien, feministischen Perspektiven auf den Journalismus, Strategien zur Gleichstellung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu den wichtigsten Begriffen zählen Androzentrismus, horizontale und vertikale Segregation, Frauenquote, feministische Denkrichtungen, Frauennetzwerke, Mentoring und Unternehmenskultur.
- Citation du texte
- Julia Koch (Auteur), 2002, Frauen im Journalismus - Ursache und Wirkung der geschlechtsbedingten ungleichen Machtverteilung in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8061