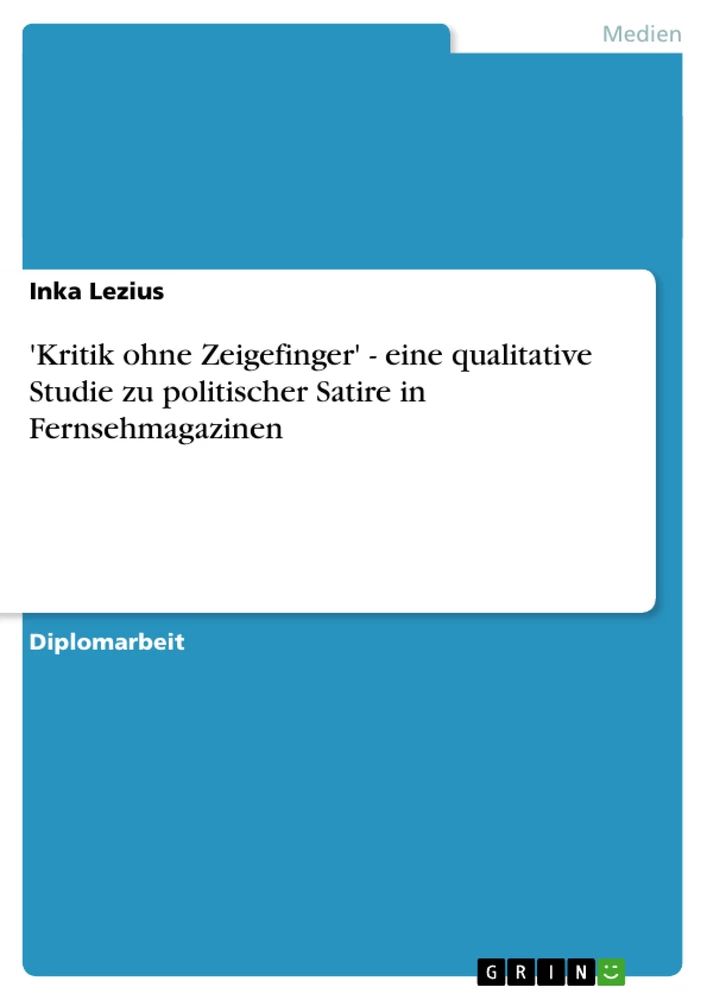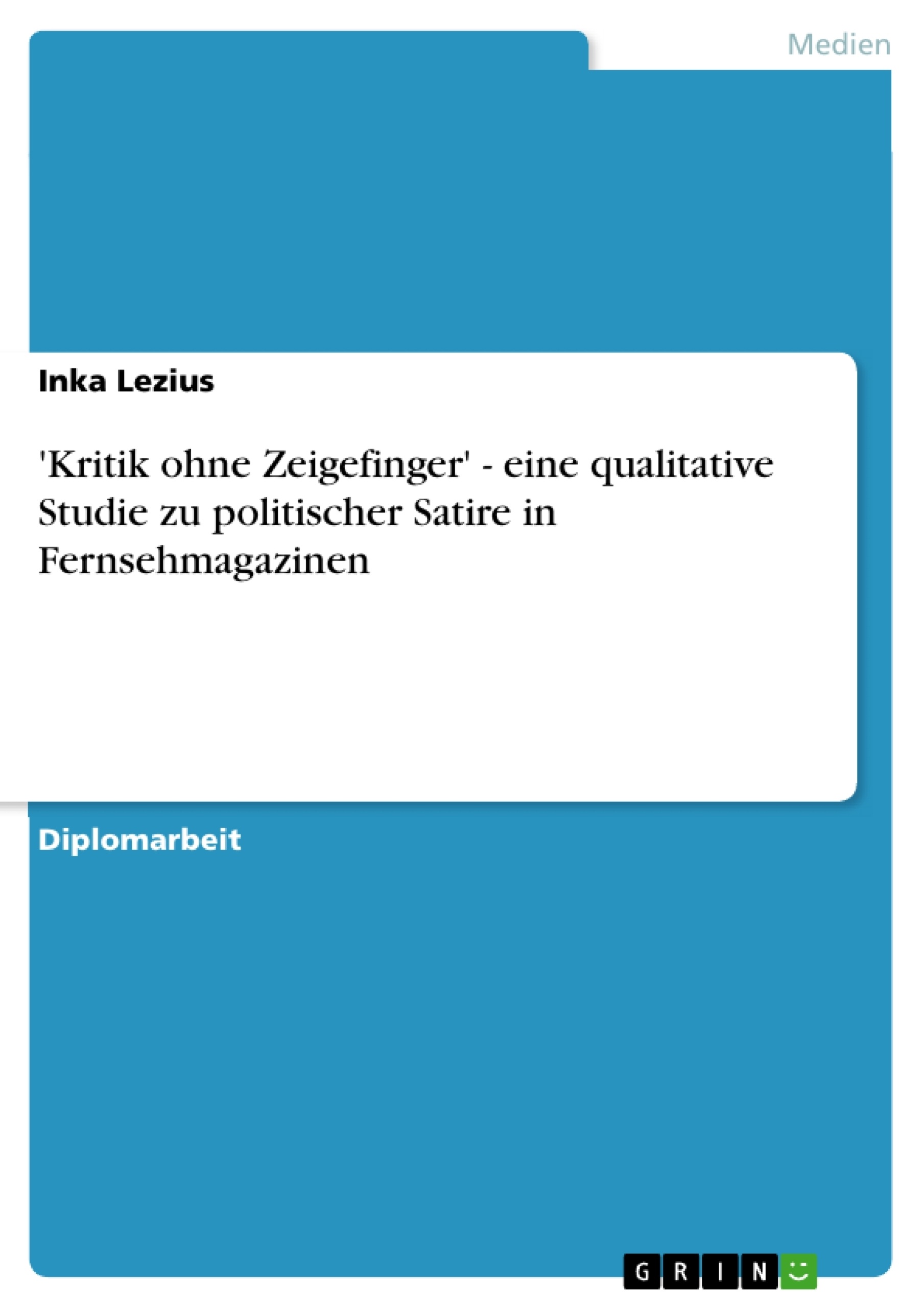Die Arbeit befasst sich mit politischer Satire im Fernsehen. Im theoretischen Teil der Arbeit wird ein Überblick über die Definition und Geschichte der Satire gegeben. Außerdem werden die verschiedenen Stilmittel der Satire im allgemeinen untersucht und Theorien zur Rezeption von Satire vermittelt. Der praktische Teil befasst sich mit der Inhaltsanalyse der Politischen Satire in vier Fernsehmagazinen und untersucht, welche Stilmittel verwendet werden, welche Intentionen die Satire-Macher haben und wie die Satire-Beiträge letztendlich beim Publikum ankommen. Dies wurde anhand von Gruppendiskussionen bei einer Gruppe von Senioren, bei Auszubildenden und bei Studenten untersucht. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass politische Satire im Fernsehen ein gutes Mittel ist, ein breites Publikum zu erreichen und das Image der Sendung aufzubessern, allerdings nur dann, wenn die Satire konsequent angewendet wird und Humor und Schärfe besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. SATIRE UND IHRE TRADITION
- 2.1. Etymologie und Definition
- 2.2. Elemente der Satire
- 2.2.1. Angriff
- 2.2.2. Norm, Ideal und Wirklichkeit
- 2.2.3. Indirektheit
- 2.3. Formen der Ästhetik
- 2.3.1. Komik
- 2.3.2. Komik- und Humortheorien
- 2.3.3. Funktionalisierbarkeit für die satirische Tendenz
- 2.3.4. Ironie
- 2.4. Exkurs: Die Unterscheidung von Glosse und Satire
- 2.5. Geschichtliche Entwicklung der Satire
- 2.6. Zusammenfassung
- 3. POLITISCHE SATIRE
- 3.1. Die Geschichte der politischen Satire
- 3.2. Das Kabarett
- 3.3. Entwicklung politischer Satire im Fernsehen
- 3.4. Satiresendungen in den 90er Jahren
- 3.5. Die satirische Fernsehlandschaft heute
- 3.5.1. Exkurs: Politische Fernsehmagazine
- 3.5.2. Beispiele für politische Satire in Magazin-Formaten
- 3.6. Das Konkurrenzprodukt Comedy
- 3.7. Zusammenfassung
- 4. DAS PUBLIKUM
- 4.1. Cultural Studies
- 4.2. Das „Encoding-Decoding-Modell“ von Hall
- 4.3. Annäherung an den Rezipienten
- 4.3.1. Der Magazinrezipient
- 4.3.2. Der Humorrezipient
- 4.4. Die Wirkungsdiskussion
- 4.5. Wirkung auf das Publikum
- 4.6. Zusammenfassung
- 5. POLITISCHE SATIRE IN FERNSEHMAGAZINEN – EINE QUALITATIVE STUDIE
- 5.1. Methoden
- 5.2. Gruppendiskussion
- 5.2.1. Vorgehen während der Gruppendiskussion
- 5.3. Leitfadengespräche
- 5.3.1. Auswahl des Untersuchungssamples
- 5.3.2. Interviewmethodik
- 5.4. Inhaltsanalyse
- 5.4.1. Film- und Fernsehanalyse
- 5.4.2. Definition des Samples
- 5.4.3. Kategorien der Analyse
- 5.5. Die Operationalisierung der Hypothesen und Forschungsfragen
- 5.6. Vorstellung der Untersuchungsergebnisse
- 6. DIE BEITRÄGE
- 6.1. Stilmittel der Beiträge
- 6.2. Humor
- 6.3. Hilfsmittel
- 6.4. Das Gefäß
- 6.5. Der Gegner
- 6.6. Das Vorwissen der Zuschauer
- 6.7. Zusammenfassung
- 7. DIE SATIRE-MACHER
- 7.1. Zwischen Technik und Talent
- 7.2. Definition von Satire
- 7.3. Bedeutung der Satire
- 7.4. Bedeutung der Satire für die Sendung
- 7.5. Redaktionsabläufe und Produktionsfreiheit
- 7.6. Zuschauerwissen
- 7.7. Zusammenfassung
- 8. DAS PUBLIKUM
- 8.1. Vorstellung der Gruppen
- 8.2. Rezeption von politischer Satire in Fernsehmagazinen
- 8.3. Reaktionen auf die gezeigten Beiträge
- 8.4. Das Humorverständnis
- 8.5. Zusammenfassung
- 9. DISKUSSION DER ERGEBNISSE
- 9.1. Fazit
- 9.2. Verbesserung des Untersuchungsdesigns und weiterführende Untersuchungen
- 9.3. Perspektive von Politsatire im Fernsehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die politische Satire in deutschen Fernsehmagazinen. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der politischen Satire, ihre Wirkung auf das Publikum und die Produktionsbedingungen zu analysieren. Die Arbeit kombiniert qualitative Methoden wie Gruppendiskussionen und Leitfadeninterviews mit einer Inhaltsanalyse von Fernsehbeiträgen.
- Definition und Geschichte der politischen Satire
- Wirkung von politischer Satire auf das Publikum
- Analyse der Stilmittel und Techniken in satirischen Fernsehbeiträgen
- Die Rolle der Satire-Macher und ihre Arbeitsbedingungen
- Rezeption und Verständnis von politischer Satire im Fernsehformat
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2. Satire und ihre Tradition: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Theorie der Satire. Es beleuchtet die Etymologie des Begriffs, definiert Satire, untersucht ihre charakteristischen Elemente wie Angriff, Norm und Ideal, Indirektheit und die Rolle von Komik und Ironie. Der Unterschied zwischen Glosse und Satire wird ebenfalls thematisiert. Die geschichtliche Entwicklung der Satire von ihren Ursprüngen bis in die Moderne wird nachgezeichnet, um das Verständnis für die aktuelle Form der politischen Satire im Fernsehen zu legen.
3. Politische Satire: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung und den aktuellen Stand der politischen Satire, insbesondere im Kontext des Fernsehens. Es erörtert die Geschichte der politischen Satire, die Rolle des Kabaretts und die Entwicklung im Fernsehen von den 90er Jahren bis zur Gegenwart. Es werden Beispiele für politische Satire in Magazinformaten vorgestellt und der Einfluss des Konkurrenzprodukts „Comedy“ analysiert. Der Kapitelteil bietet einen detaillierten Überblick über das spezifische Genre im deutschen Fernsehen und seiner Entwicklung.
4. Das Publikum: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Publikum der politischen Satire und dessen Rezeption. Es werden Theorien aus den Cultural Studies, insbesondere das Encoding-Decoding-Modell von Hall, angewendet, um die vielschichtigen Interaktionen zwischen Sendern und Empfängern zu beleuchten. Es untersucht die Charakteristika des Magazinrezipienten und des Humorrezipienten und analysiert die Diskussionen zur Wirkung von Satire im Allgemeinen.
5. Politische Satire in Fernsehmagazinen – Eine qualitative Studie: In diesem Kapitel werden die Methodik und das Vorgehen der qualitativen Studie erläutert. Es werden die angewendeten Methoden (Gruppendiskussionen, Leitfadeninterviews, Inhaltsanalyse) detailliert beschrieben, die Auswahl der Untersuchungssamples und die Operationalisierung der Hypothesen und Forschungsfragen dargelegt. Dieser Abschnitt dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der empirischen Arbeit.
6. Die Beiträge: Dieser Kapitelteil analysiert die untersuchten Beiträge hinsichtlich ihrer Stilmittel, des Humors, der verwendeten Hilfsmittel, des „Gefäßes“ der Satire, des Gegners und des Vorwissens der Zuschauer. Die Analyse integriert die Erkenntnisse der Inhaltsanalyse und legt den Fokus auf die verschiedenen Strategien und Techniken der politischen Satire in den ausgewählten Beiträgen.
7. Die Satire-Macher: Dieses Kapitel beleuchtet die Perspektive der Satire-Macher. Es untersucht ihre Definition von Satire, ihre Einschätzung der Bedeutung von Satire im Allgemeinen und für die jeweilige Sendung. Redaktionsabläufe, Produktionsfreiheit und das Wissen über das Publikum werden ebenfalls thematisiert, um das kreative und produktive Umfeld der Satire-Produktion zu verstehen.
8. Das Publikum: Hier werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen vorgestellt und analysiert. Die Rezeption der politischen Satire, die Reaktionen auf die gezeigten Beiträge und das Humorverständnis der verschiedenen Gruppen werden detailliert untersucht und verglichen, um ein umfassendes Bild des Publikums und seiner Wahrnehmung der Satire zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Politische Satire, Fernsehmagazine, Qualitative Studie, Rezeption, Humor, Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion, Leitfadeninterview, Cultural Studies, Encoding-Decoding-Modell, Satire-Macher, Publikum, Wirkungsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Politische Satire in deutschen Fernsehmagazinen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die politische Satire in deutschen Fernsehmagazinen. Sie analysiert verschiedene Aspekte der politischen Satire, ihre Wirkung auf das Publikum und die Produktionsbedingungen.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert qualitative Methoden wie Gruppendiskussionen und Leitfadeninterviews mit einer Inhaltsanalyse von Fernsehbeiträgen. Dies ermöglicht eine umfassende Betrachtung des Themas aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Geschichte der politischen Satire, Wirkung auf das Publikum, Analyse der Stilmittel und Techniken in satirischen Fernsehbeiträgen, die Rolle der Satire-Macher und ihre Arbeitsbedingungen sowie die Rezeption und das Verständnis von politischer Satire im Fernsehformat.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Satire und ihre Tradition, Politische Satire, Das Publikum, Politische Satire in Fernsehmagazinen – Eine qualitative Studie, Die Beiträge, Die Satire-Macher, Das Publikum (Ergebnisse der empirischen Untersuchung) und Diskussion der Ergebnisse. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird im Kapitel „Satire und ihre Tradition“ behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Theorie der Satire, einschließlich Etymologie, Definition, charakteristische Elemente (Angriff, Norm und Ideal, Indirektheit, Komik, Ironie), den Unterschied zwischen Glosse und Satire und die geschichtliche Entwicklung.
Was wird im Kapitel „Politische Satire“ behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung und den aktuellen Stand der politischen Satire im Fernsehen, einschließlich der Geschichte, der Rolle des Kabaretts, der Entwicklung im Fernsehen (90er Jahre bis Gegenwart), Beispielen in Magazinformaten und dem Einfluss von Comedy.
Was wird im Kapitel „Das Publikum“ behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rezeption der politischen Satire durch das Publikum. Es werden Theorien aus den Cultural Studies (z.B. das Encoding-Decoding-Modell von Hall) angewendet, um die Interaktionen zwischen Sendern und Empfängern zu beleuchten und die Charakteristika des Magazin- und Humorrezipienten zu untersuchen.
Wie wurde die qualitative Studie durchgeführt?
Die qualitative Studie umfasste Gruppendiskussionen, Leitfadeninterviews und eine Inhaltsanalyse von Fernsehbeiträgen. Die Auswahl der Untersuchungssamples und die Operationalisierung der Hypothesen und Forschungsfragen werden detailliert beschrieben.
Was wird in den Kapiteln „Die Beiträge“, „Die Satire-Macher“ und „Das Publikum (Ergebnisse)“ analysiert?
„Die Beiträge“ analysiert Stilmittel, Humor, Hilfsmittel, „Gefäß“, Gegner und Vorwissen der Zuschauer. „Die Satire-Macher“ beleuchtet deren Perspektive, Definition von Satire, Bedeutung, Redaktionsabläufe und Produktionsfreiheit. „Das Publikum (Ergebnisse)“ präsentiert und analysiert die Ergebnisse der Gruppendiskussionen hinsichtlich Rezeption, Reaktionen und Humorverständnis.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Kapitel „Diskussion der Ergebnisse“ zieht ein Fazit, schlägt Verbesserungen für das Untersuchungsdesign und weiterführende Untersuchungen vor und gibt eine Perspektive auf die Zukunft der Politsatire im Fernsehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politische Satire, Fernsehmagazine, Qualitative Studie, Rezeption, Humor, Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion, Leitfadeninterview, Cultural Studies, Encoding-Decoding-Modell, Satire-Macher, Publikum, Wirkungsforschung.
- Quote paper
- Inka Lezius (Author), 2007, 'Kritik ohne Zeigefinger' - eine qualitative Studie zu politischer Satire in Fernsehmagazinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80684