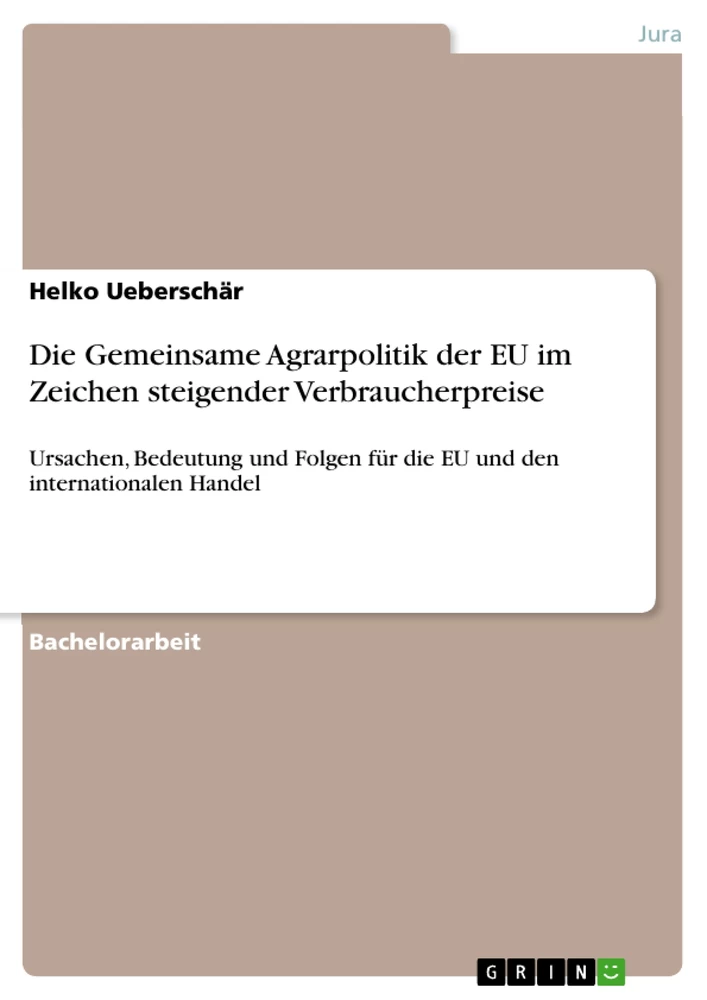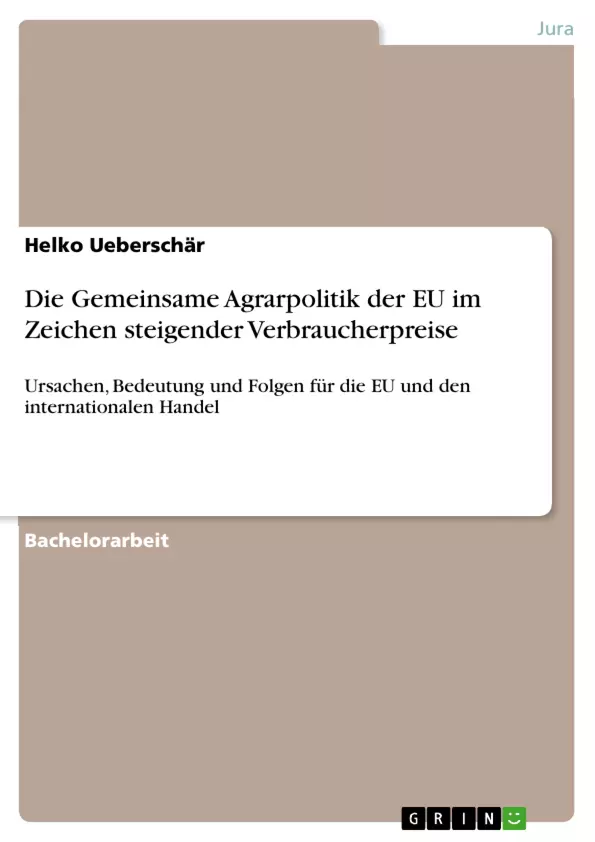Während die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union von wirtschaftsliberalen Prämissen bestimmt scheint, nimmt hierzu traditionell der Agrarsektor eine konträre Stellung ein. Hier nimmt die EU erstaunlich starke Eingriffe in die Wirtschaft vor, wie man sie sonst nur in wenigen entwickelten Ländern vorfindet. Seit Ende der 1960er Jahre findet sich eine protektionistische Preis- und Mengenpolitik, die sich in Marktordnungen mit Preisverordnungen niederschlägt.
Bereits seit den 1970er Jahren sind die Fehlsteuerungen im geregelten Agrarsektor bekannt und für jeden offen sichtbar gewesen: war die EG bislang ein Nettoimporteur, wurde sie jetzt zu einem Nettoexporteur, der nicht alle seine Produkte auf dem Weltmarkt zeitnah absetzen konnte. Milchseen, Butterberge und Getreidegebirge als Inbegriff voller Lager bestimmten daraufhin die Meldungen in den Nachrichten.
Trotz vieler Reformversuche der letzten Jahrzehnte ist eine grundlegende Deregulierung ausgeblieben, so dass die Entwicklung der EU-Agrarpolitik eindrucksvoll belegt, wie schwierig es ist, einmal geschaffene Institutionen zu ändern.
Gerade in den letzten Monaten sind die Lebensmittelpreise stark gestiegen und haben die Diskussion um die Kosten und den Nutzen des Agrarprotektionismus für die EU und ihre Bürger wieder in den Blickwinkel der Öffentlichkeit geholt.
Dennoch wird auch in dieser Diskussion die wichtige Frage nach den Folgen dieser Politik für den Weltmarkt und die Entwicklungsländer nicht gestellt.
Für das kommende Jahr 2008 ist eine grundlegende Überprüfung der europäischen Agrarpolitik angesetzt. In Anbetracht der fundamentalen Veränderungen seit Gründung der EG und der immer nur kleinen Reformen tut dies auch dringend not.
Die vorliegende Arbeit zeigt eingangs die Besonderheiten des Agrarsektors gegenüber den anderen Wirtschaftssektoren auf, bevor die grundlegenden Mittel der EU zur Regulierung dieses Sektors erläutert werden. Anschließend erfolgt die Darstellung der handelstechnischen Folgen der EU-Agrarpolitik, aus der die ökonomischen Konsequenzen für Entwicklungsländer abgeleitet werden.
Danach wird die aktuelle Situation im europäischen Agrarmarkt vorgestellt und als Ergebnis der EU-Agrar-Reformen interpretiert und evaluiert, bevor sich der Autor zum Schluss mit den Konsequenzen auseinandersetzt und aufzeigt, wie die Auswirkungen reduziert werden sollten, damit sowohl die europäische als auch die Volkswirtschaft vieler Entwicklungsländer profitieren könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz und Aufbau dieser Arbeit
- Problemrelevanz: Der Agrarsektor als Sonderweg
- Aufbau der Arbeit
- Wettbewerbs- und Agrarpolitik der Europäischen Union
- Akteure der EU-Agrarpolitik
- Prämissen der Wettbewerbspolitik: Marktwirtschaft
- Prämissen der Agrarpolitik: Regulierung
- Ökonomische Grunddaten und Geschichte des Agrarsektors
- Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU
- Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik
- Gemeinsame Marktordnungen
- Wirtschaftspolitik im Rahmen der GAP
- Die Finanzierung der Agrarpolitik
- Die europäischen Fonds für die Landwirtschaft
- Einnahmen der EU und ihre Ausgaben für die GAP
- Außenhandel für Agrarprodukte
- Grundlagen eines liberalen Außenhandels
- GATT und WTO im Agrarhandel
- EU-Protektionismus im Außenhandel für Agrarprodukte
- Rolle der EU als Agrarexporteur und Wohlfahrtswirkungen für Drittländer
- Einfluss der GATT auf den EU-Agrarhandel
- Zwischenfazit: nationale und internationale Folgen der EU-Agrarpolitik
- Folgen der EU-Agrarpolitik für Entwicklungsländer
- Folgen der EU-Agrarpolitik für die EU-Länder
- Die Gemeinsame Agrarpolitik nach der EU-Osterweiterung
- Reformen der GAP im Überblick
- Agrarpolitik heute - Die neue Milchknappheit?
- Gestaltungsempfehlungen für eine Optimierung des Agrarsektors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union im Kontext steigender Verbraucherpreise. Dabei werden die Ursachen dieser Preissteigerungen analysiert und deren Auswirkungen auf die EU und den internationalen Handel beleuchtet.
- Entwicklung und Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
- Wettbewerbsbedingungen im Agrarsektor
- Einfluss der EU-Agrarpolitik auf den internationalen Handel
- Folgen der Agrarpolitik für Entwicklungsländer
- Zukünftige Herausforderungen für den Agrarsektor
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Relevanz und dem Aufbau der Arbeit. Es werden die Problematik des Agrarsektors als Sonderweg und die Struktur des Textes beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Wettbewerbs- und Agrarpolitik der Europäischen Union. Hierbei werden Akteure, Prämissen und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) mit ihren Zielen, Marktordnungen und der Finanzierung näher betrachtet. Im dritten Kapitel werden die Grundlagen eines liberalen Außenhandels, die Rolle des GATT und der WTO im Agrarhandel sowie der EU-Protektionismus im Außenhandel für Agrarprodukte behandelt. Abschließend wird die Rolle der EU als Agrarexporteur und die Wohlfahrtswirkungen für Drittländer diskutiert. Das vierte Kapitel fasst die nationalen und internationalen Folgen der EU-Agrarpolitik zusammen, indem die Auswirkungen auf Entwicklungsländer und die EU-Länder beleuchtet werden. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Gemeinsamen Agrarpolitik nach der EU-Osterweiterung und untersucht die Reformen der GAP sowie die aktuelle Situation in der Agrarpolitik. Das sechste Kapitel enthält Gestaltungsempfehlungen für eine Optimierung des Agrarsektors.
Schlüsselwörter
Gemeinsame Agrarpolitik, EU-Agrarpolitik, Verbraucherpreise, Agrarsektor, Wettbewerbspolitik, Marktwirtschaft, Regulierung, Außenhandel, GATT, WTO, Protektionismus, Entwicklungsländer, Wohlfahrtswirkungen, Reformen, Milchknappheit, Gestaltungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU?
Die GAP ist ein System von Subventionen und Marktregulierungen, das die landwirtschaftliche Produktion in der EU stützen und die Versorgung der Bevölkerung sichern soll.
Warum stehen die EU-Agrarsubventionen in der Kritik?
Kritiker bemängeln die hohen Kosten, die Marktverzerrungen durch Überproduktion (Milchseen, Butterberge) und die negativen Folgen für Bauern in Entwicklungsländern.
Wie beeinflusst die EU-Agrarpolitik die Entwicklungsländer?
Durch Exportsubventionen werden EU-Überschüsse billig auf Weltmärkte gebracht, was die lokalen Märkte in Entwicklungsländern zerstört, da heimische Bauern preislich nicht mithalten können.
Was sind "gemeinsame Marktordnungen"?
Dies sind Regelwerke für bestimmte Produktgruppen (z.B. Milch, Getreide), die Preise festlegen und Mengen durch Quoten oder Interventionskäufe steuern.
Warum steigen die Lebensmittelpreise trotz Subventionen?
Ursachen sind globale Nachfragesteigerungen, Missernten und die Nutzung von Agrarflächen für Biokraftstoffe, während das EU-System oft zu träge auf Marktveränderungen reagiert.
- Quote paper
- Helko Ueberschär (Author), 2007, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU im Zeichen steigender Verbraucherpreise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80910